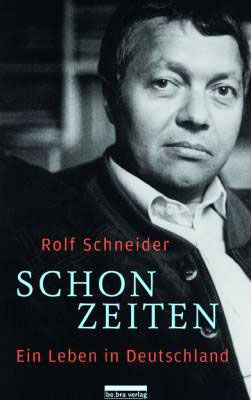
Rolf Schneider, "Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland". € 20,60 / 316 Seiten. be.bra verlag, Berlin 2013
STANDARD: Ihre Lebenserinnerungen tragen zwar den Untertitel "Ein Leben in Deutschland", aber Sie haben sich über Deutschland hinaus stets mit Österreich sehr verbunden gefühlt. Was stand am Beginn dieser "Liaison"?
Rolf Schneider: Das Wort "Liaison" ist gar nicht falsch, es handelt sich wirklich um eine Liebesbeziehung. Zwei Erfahrungen standen am Beginn: Die eine war meine Lektürebegegnung mit Robert Musil. Ich wollte über diesen Autor auch promovieren, was aber gescheitert ist, da Hans Mayer, mein Doktorvater, plötzlich nicht mehr vorhanden war: 1963 kehrte er nach einer Reise zu den Bayreuther Festspielen nicht in die DDR zurück. Ich habe diese Liebe dann umkanalisieren können, in eine für die DDR zusammengestellte Robert-Musil-Ausgabe. Die andere Erfahrung war Ende der 60er- Jahre die Inszenierung meines Prozess in Nürnberg am Burgtheater. Es war die Zeit des Dokumentartheaters, dem ich damals zuneigte. Mein Stück erzählt den ersten Kriegsverbrecherprozess der Alliierten, 1946. So kam ich erstmals nach Wien, und so konnte diese Liebe auch sinnlich werden.
STANDARD: Welchen Eindruck vermittelte die Stadt auf Sie als DDR-Bürger damals?
Schneider: Es ist ein Bündel verschiedenartiger Eindrücke. Wenn man in die Schatzkammer der Hofburg geht und dort vor der Reichskrone steht, begegnen einem 600 Jahre deutsche Geschichte. Solche Tradition macht jemanden, der Geschichtssinn hat, schon betroffen. Ich kehrte an einen der Ursprünge des Deutschen Reiches zurück, und dies alles geschah hier in Zeiten der deutschen Zweistaatlichkeit. Ich erfuhr, museal ausgestellt, die untergegangene Utopie einer gesamtdeutschen Staatsexistenz.
Es ist das Identische und das Andersartige, was mich an Österreich immer angezogen hat. Das kleine Österreich stand der kleinen DDR in mancherlei Hinsicht näher als die mächtige, reiche Bundesrepublik. Ich habe Österreich noch als armes Land erlebt. Das gegenwärtige Wirtschaftswunder gab es damals noch nicht. Die Kärntner Straße war eine unansehnliche Verkehrsmeile, in der nach Einbruch der Dunkelheit Huren auf- und abmarschierten.
STANDARD: Welche Empfindungen weckte Österreich in Ihnen als Schriftsteller?
Schneider: Was mich immer beschäftigt hat, ist der merkwürdige Umstand, dass die untergehende k. u. k. Monarchie plötzlich zu einer kulturellen Großmacht aufstieg. Je schwächer es politisch zuging, desto stärker wurde man kulturell. Die Avantgarde um 1900, ob in Musik, bildender Kunst oder Literatur, hatte eine eminent österreichische Prägung. Schnitzler fasziniert mich bis heute. Aus meiner Sicht ist er ein deutscher Tschechow. Nur: Die Deutschen wissen das nicht. Figuren wie Klimt oder Schiele sind absolut singulär, zu ihnen gibt es in Deutschland fast keine Parallele. Erst mit dem deutschen Expressionismus holen wir sie ein.
STANDARD: Als Sie Anfang der 50er-Jahre Musil lasen, war die literarische Moderne in der DDR offiziell verpönt. Inwieweit hat Musil Ihr Schaffen beeinflusst?
Schneider: Es war nachbarliches Interesse, das mich zur österreichischen Literatur hingezogen hat. Bei Musil war es außerdem die stilistische Brillanz. Hinzu kommt: Musil ist so etwas wie ein Frauenversteher. Seine weiblichen Figuren erscheinen durchweg eindrucksvoller als die männlichen Protagonisten. Das gilt nicht nur für Vereinigungen und Drei Frauen, sondern ebenso für den Mann ohne Eigenschaften: Agathe ist interessanter als Ulrich. Solche Art literarischer Feminismus hat mich sicher beeinflusst.
STANDARD: Auch Hermann Broch erwähnen Sie in Ihren Erinnerungen ...
Schneider: Broch, mit den Schlafwandlern, habe ich früher gelesen als Musil. Ich war durch Zufall auf ihn gestoßen, und er faszinierte mich. Gelegentlich bin ich nach Altaussee gereist, wo Broch regelmäßiger Gast war. Er ist eine große Figur. Dass er nicht so bekannt ist wie Musil und die anderen österreichischen Avantgardisten des 20. Jahrhunderts, ist eine Tragödie.
STANDARD: Und Doderer?
Schneider: Mit dem habe ich Probleme. Ich kenne fast alle seine Bücher. Die Strudlhofstiege gehe ich jedes Mal, wenn ich in Wien bin, hinauf und hinab. Gleichwohl, vor allem seine konservativ-elitäre Haltung irritiert mich. Joseph Roth, gegen Ende seines Lebens politisch nah bei Doderer, mag ich ungleich mehr.
STANDARD: Wie erklären Sie sich den immensen und auch qualitativ hohen Anteil der zeitgenössischen österreichischen Literatur an der deutschsprachigen Literatur in ihrer Gesamtheit?
Schneider: Die moderne Belletristik in Deutschland wird derzeit immer privater. Die österreichische Literatur betreibt das in dieser Radikalität nicht und hat es nie getan. Österreichs Geistigkeit entsteht, unter anderem, durch eine ständige Reibung an den gegebenen Umständen, die in aller Regel gesellschaftliche und politische sind. Ein Buch wie Arno Geigers Es geht uns gut haben wir in Deutschland nicht. Hinzu kommt das, was Karl Kraus "sprachverbuhlt" nennt und was die meisten österreichischen Autoren auszeichnet, bis hin zu den stilistischen Manierismen Ernst Jandls und Elfriede Gerstls. Dies alles hat Österreichs Gegenwartsbelletristik, finde ich, der deutschen voraus.
STANDARD: Dankbare Kapitel Ihrer Erinnerungen widmen Sie Hans Weigel und Friedrich Torberg. Waren sie es, die Ihnen Österreich besonders nahe gebracht haben?
Schneider: Es war eine Begegnung auf halbem Wege. Ich kannte Österreich damals schon gut. Ich hatte mich mit Nestroy auseinandergesetzt und versuchte, seine Stücke für uns Norddeutsche zu adaptieren. Der Sprachklang Nestroys ist wienerisch, man kann das im deutschen Norden wenig nachvollziehen. Ich musste eine andere Sprachform finden. Meine Bearbeitungen wurden öfter gespielt, was dazu führte, dass man mich zu einer Nestroy-Tagung nahe Schwechat einlud. Hans Weigel war auch dort. Er wurde ein enger Freund. Bis zu seinem Tode. Friedrich Torberg habe ich 1977 beim ersten Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt kennengelernt. Ich war eingeladen, Torberg saß in der Jury. Nach meiner Lesung kam er auf mich zu, wir fanden schnell engen Kontakt zueinander. Mein heimlicher Ehrgeiz war es, Weigel und Torberg, die heftig miteinander verzankt waren, zu versöhnen. Es ist mir nicht gelungen. Torberg ist darüber gestorben.
STANDARD: Ingeborg Bachmann selbst kannten Sie auch?
Schneider: Ich habe sie flüchtig erlebt, als sie mit Max Frisch Peter Huchel traf. Ich halte sie für eine der großen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts, so wie auch Christine Lavant, Christine Busta und Hertha Kräftner. Sie alle sind zuerst von Hans Weigel gedruckt worden.
Es gibt noch weitere österreichische Lyriker, die ich schätze, Paul Celan, Jura Soyfer, vor allem auch Theodor Kramer. In Norddeutschland kennt ihn niemand, so wenig wie Jury Soyfer oder Peter Hammerschlag. Beide sind eminent politische Figuren. Es gibt eine österreichische Art der Verbindung von Literatur und Politik. Bruno Kreisky, was kaum jemand weiß ist, hat während seines Exils angefangen, Robert Musil ins Schwedische zu übertragen. Meine enge Bekanntschaft mit Kreisky wurde durch Musil gestiftet, und Kreisky verdanke ich meine Einblicke in die österreichische Politik.
STANDARD: Hat sich nach der Wende die politische Kultur Österreichs gewandelt?
Schneider: Österreichs Politik wurde marginalisiert. Die Drehscheiben-Funktion zu Zeiten des Kalten Krieges ist weggefallen. Beibehalten hat Österreich sein Interesse an Osteuropa und vor allem Südosteuropa.
STANDARD: Kreisky befand gegen Ende seines Lebens, je älter er werde, desto linker werde er. Sie lehnen am Schluss Ihres Buches jedwedes wie auch immer geartete sozialistische Modell ab. Welche gesellschaftspolitischen Perspektiven schweben Ihnen vor?
Schneider: Gäbe es in Deutschland einen Sozialstaat wie in Skandinavien, würde ich sagen: Das ist ein System, zu dem ich mich bekenne. Freilich sehe ich, dass in Schweden die Finanzierung dieses sozialdemokratischen Modells heftige Probleme bereitet. Die dortigen Korrekturen in Richtung Spätkapitalismus haben wirtschaftliche Gründe. Nun bin ich kein Ökonom. Ich sehe bloß, was ist und was werden könnte. Da ich von Natur aus Skeptiker bin, sehe für unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Konflikte keine sozialistisch inspirierte Lösung.
STANDARD: Nach wie vor aber halten Sie Karl Marx, wiewohl dies zu sagen etwas unzeitgemäß sei, für "einen bedeutenden Anreger" ...
Schneider: Gelegentlich nenne ich mich einen unverdrossenen Marxisten. Seine Schriften sind aktuell und werden aktuell bleiben. Da bin ich mir ganz gewiss. (Adelbert Reif, Album, DER STANDARD, 2./3.3.2013)