
Videospiele machen gewalttätig. Gamer sind Sexisten. Viele Eltern interessieren sich nicht für das digitale Hobby ihrer Kinder. Es gibt sehr viele harte Meinungen rund um Videospiele und die Spielenden, die aber weder auf Auseinandersetzung basieren noch in Taten umgesetzt werden. Das sei "kulturwissenschaftlich interessant und gleichzeitig unfair den Spielenden gegenüber", sagt Harald Koberg, Kulturanthropologe und Buchautor. Für sein neuestes Werk hat der gebürtige Grazer mit zahlreichen Menschen diskutiert, ab wann sich jemand als Gamerin oder Gamer bezeichnet und warum viele noch immer ein Problem mit oder Angst vor der digitalen Spielkultur haben.
STANDARD: Wie kamen Sie auf den Titel "Streitpunkt Games"?
Koberg: Der ist in seiner Letztform nicht von mir, sondern vom Büchner-Verlag. Der Weg dahin war ein langer. Begonnen hat er mit meinen Vorschlägen, dann gab's Kritik von Freundinnen und Freunden und Rückmeldungen vom Verlag. Ich habe sogar ChatGPT bemüht, aber da hat sich gezeigt, dass die KI eben auch nur Bekanntes neu aneinanderreiht. Wichtig war mir, dass der Titel für sich allein schon eine Idee vermittelt, worum es geht. Ich denke, das ist ganz gut gelungen.
STANDARD: Was waren die Themen, derentwegen Sie in Ihrer Jugend beziehungsweise beim Erstkontakt mit digitalen Spielen streiten beziehungsweise diskutieren mussten oder wollten?
Koberg: In der Anfangszeit war das alles noch recht entspannt. Ich habe in den frühen 1990ern am PC meines Vaters zu spielen begonnen. Da habe ich mit den Eltern darüber diskutiert, wie lange ich spielen darf, aber das war's so ziemlich. Einmal hat mein Vater gemeint, wir sollten ein Spiel wieder deinstallieren, weil es in seinen Augen zu brutal für mich und meinen Bruder war. Das haben wir, glaube ich, anstandslos getan. Die größeren Diskussionen sind dann erst nach und nach rund um den Jahrtausendwechsel losgegangen. Da wurde dann aber wenig mit uns Spielenden, sondern vor allem über uns diskutiert. In diese Diskussionen – allen voran die Gewaltdebatten – bin ich dann als junger Erwachsener eingestiegen.
STANDARD: Sie nehmen im Buch Stellung zu der langjährigen Kritik an Videospielen, Gewalt zu verherrlichen, fragen dann aber sehr richtig, warum nie schnelle und entschlossene Maßnahmen gesetzt wurden, etwa von einzelnen Regierungen. Warum, glauben Sie, blieben diese Maßnahmen aus?
Koberg: Weil in Wahrheit kaum jemand wirklich daran glaubt, dass die Videospiele ein Hauptgrund für soziale Probleme sind. Die Wissenschaft widerspricht dieser These schon lang, und die Kriminalstatistiken tun das auch. Im Buch analysiere ich vor allem diesen Teil der Debatte als Scheindiskurs, der davon ablenkt, dass dort, wo junge Menschen gewalttätig werden, ganz andere, viel unangenehmere Fragen gestellt werden müssten. Welche Rolle spielt das soziale Umfeld, das Bildungssystem? Da ist es viel leichter, über die bösen Medien zu schimpfen.
Besonders faszinierend ist aber der Umstand, dass die Jugend in den vergangenen Jahrzehnten, in denen schon sehr viel digital gespielt wurde, ja gar nicht gewaltbereiter geworden ist. Da gibt es, wie etwa auch jetzt seit der Pandemie, kleine Spitzen in den Kriminalstatistiken, aber über die Jahre hat die Jugendgewalt kontinuierlich abgenommen.
STANDARD: Sie stellen fest, dass sich sowohl manche Eltern als auch Teile der Lehrerschaft nicht ausreichend mit der Materie Videospiele auseinandersetzen wollen. Was waren genannte Gründe, warum es offenbar noch immer für viele Menschen solch eine Hürde ist, sich für diese riesige Entertainmentbranche zu interessieren?
Koberg: Oberflächlich ist da oft ein ehrliches Desinteresse, das manchmal auch mit einem gewissen Stolz nach außen getragen wird. So in der Art von: "Ich habe ja nie gespielt. Mir ist es da schade um die Zeit." In meiner Arbeit mit Eltern und Lehrerinnen und Lehrern erlebe ich auch die Angst davor, sich nicht auszukennen oder sich ungeschickt anzustellen. Spielen heißt ja auch, sich auf die Möglichkeit des Scheiterns einzulassen, und damit tun sich Erwachsene schwer. Kulturwissenschaftliche Theorien legen aber nahe, dass es schon auch einen tieferen, wohl weniger bewussten Grund gibt: Wenn man Videospiele dafür verantwortlich machen will, dass sich Jugendliche nicht so entwickeln, wie man das gerne hätte, dann darf man auch nicht zu genau hinschauen, weil das Argument dann schnell in sich zusammenfällt.
STANDARD: Sie beschreiben in dem Buch auch die Problematik, dass es sich bei digitalen Spielen mittlerweile um ein sehr breites Feld handelt, angefangen von einem harmlosen Zeitvertreib bis hin zu Glücksspielmechaniken. Erschwert auch diese Tatsache den Einstieg und das Verstehen für Außenstehende?
Koberg: Das ist sicher auch ein Faktor. Videospiele sind genauso wie die Gamingkulturen um sie herum unglaublich vielfältig. Da ist es schon wirklich aufwendig, sich einen Überblick zu verschaffen, und es liegt auf der Hand, dass Pauschalurteile über "die Videospiele" nicht greifen. Gleichzeitig fragt aber auch niemand, ob Bücher ganz allgemein gut oder schlecht sind, ob Filme wertvoll sind oder gefährlich. In einem ersten Schritt genügt es also schon, sich der Vielfalt bewusst zu sein und zu wissen, dass für Videospiele wie für Bücher und Filme gilt, dass es gute, schlechte, kluge, dumme, simple und hochkomplexe gibt.
STANDARD: Sie erwähnen, dass es in vielen Gesprächen noch immer starke Ressentiments gegenüber Videospielen gibt. Basieren diese Vorurteile Ihrer Erfahrung nach auf realen Problemen, wie etwa dem Boom an Lootboxen oder Glücksspielmechanismen in manchen Spielen, oder tragen digitale Spiele noch immer die Bürde des Neuen und Unbekannten?
Koberg: Ich habe dieses Buch vor allem auch deswegen geschrieben, weil ich beobachte, dass Debatten, die von Vorurteilen und Halbwissen getragen werden, oft die eigentlich notwendigen Diskussionen in den Hintergrund drängen. Mit Lootboxen war das lange der Fall. Da wurde weiterhin über real nicht festmachbare Gewalteskalationen diskutiert, während ein Teil der Spieleindustrie weitgehend unbemerkt von der pädagogischen Öffentlichkeit Glücksspielmechaniken für Kinder und Jugendliche normalisiert hat. Die Ressentiments und die fehlende Bereitschaft, genauer hinzuschauen, tragen also dazu bei, dass reale Probleme oft nicht oder erst spät gesehen werden.
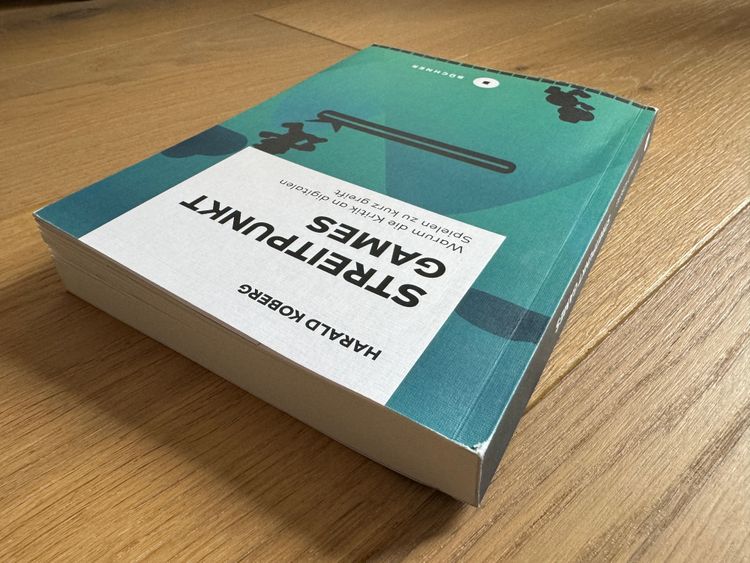
STANDARD: Einen sehr wichtigen Punkt fand ich den von Ihnen angesprochenen Aspekt, dass aufgrund zahlreicher Suchtdebatten rund um Videospiele die Gefahr bestünde, die tatsächlich Gefährdeten würden in der Masse an nicht Betroffenen verschwinden. Ist dem Ihrer Erfahrung nach so? Erkennen Menschen Spielsucht bei "World of Warcraft" oder "Counterstrike", oder ist das speziell hierzulande noch ein Tabuthema?
Koberg: Ich denke, es ist das Gegenteil von einem Tabu: Alle, die spielen, stehen unter Verdacht, abhängig zu sein. Und wenn dann jeder Erwachsene, der große Teile seiner Freizeit mit Spielen verbringt, und jede Jugendliche, die gelegentlich ein Wochenende durchzockt, als süchtig abgestempelt wurde, gibt es auch keinen Raum für die notwendige Differenzierung zwischen einem zeitintensiven Hobby und einer Abhängigkeit. Ich erlebe das in konkreten Fällen durchaus so, dass viel zu früh von Sucht die Rede ist, aber wenn es wirklich problematisch wird, wird dann oft kaum reagiert – vor allem auch weil Videospielabhängigkeit häufig Erwachsene betrifft und trotzdem fast ausschließlich als Jugendthema verhandelt wird.
STANDARD: Sie erwähnen in dem Buch mehrfach, wer sich als Gamer oder Gamerin titulieren würde und wer nicht. Welches Genre muss ich spielen oder wie oft muss ich zum Joypad oder Handy greifen, damit ich Ihrer Meinung nach ein Gamer bin?
Koberg: It's a trap! Auf diese Frage gibt es wohl nur falsche Antworten. Im Buch schreibe ich über die verbindenden und ausgrenzenden Dynamiken, die mit der Bezeichnung Gamerin oder Gamer in Verbindung stehen. Da geht es ja unter anderem darum, wem die Gamingkultur gehört, wer über sie urteilen darf, und das ist alles nicht unproblematisch. Für mich als Kulturanthropologen geht es darum zu analysieren, wer sich selbst und andere in welchen Kontexten als Gamerin oder Gamer bezeichnet und woran das liegen kann. In meinen Augen sind Sie also ein Gamer, wenn Sie sich als solcher wahrnehmen und bezeichnen.
STANDARD: Ich frage auch deshalb, weil speziell die hitzigen Debatten im Netz von Gamern immer wieder sehr negative Auswüchse produzieren. Da sind zum einen die Hassnachrichten und sogar Morddrohungen an Entwickler, weil ein Spiel nicht so geworden ist, wie viele gehofft hatten, und zum anderen natürlich die persönlichen Angriffe auf Einzelpersonen, wie etwa am Beispiel "Shurjoka" in den vergangenen Monaten leider sehr gut zu beobachten war. Wie toxisch ist diese Community Ihrer Meinung nach? Wie gilt es die "Community" zu differenzieren?
Koberg: Das sind genau die Ausgrenzungsdynamiken, die ich gemeint habe. Die Angriffe auf Shurjoka entsprechen leider ziemlich genau dem, was ich im Kapitel über verunsicherte Männlichkeiten in Gamingsphären beschreibe – in dem Fall wohl zusätzlich angeheizt durch die Aufmerksamkeitslogiken der großen Videoplattformen. Da eskalieren einzelne, üblicherweise männliche Spieler, weil irgendjemand etwas sagt oder tut, das in ihrem engen und ausgrenzenden Verständnis von Gaming keinen Platz hat. Meinungsstarke Frauen sind da ein wiederkehrender Trigger.
So schwappen dann die großen gesellschaftlichen Konflikte unserer Zeit in die Gamingsphären und treffen auf Menschen, die behaupten, Genderdebatten hätten hier keinen Platz, während sie selbst leidenschaftlich darüber debattieren, welche Körper in Videospielen weiblich oder männlich genug sind, um ihren Ansprüchen zu genügen. Die, die da eskalieren, sind allerdings eine laute und für viele nervende Minderheit. In meinen Interviews mit Spielenden bin ich auf weit mehr Menschen getroffen, die sich über die Aggressivität und Frauenfeindlichkeit in einzelnen Communitys beschweren, als auf solche, die diese Angriffe nachvollziehen können.

STANDARD: Wird in Österreich noch immer zu wenig über digitale Spiele diskutiert?
Koberg: Ja. Vor allem, wenn mit "diskutieren" eine intensive, kritische Auseinandersetzung gemeint ist.
STANDARD: Welche Fragen gilt es in nächster Zeit unbedingt in diesem Zusammenhang noch zu beantworten, und braucht es dafür ein neues Buch?
Koberg: Ein Thema, dem ich ein Kapitel gewidmet habe, aber zu dem es noch sehr viel zu fragen gäbe, ist die Durchdringung des Spielens durch Konsumlogiken. Für jüngere Spielende ist es oft schon selbstverständlich, dass Videospiele ständig Geld von ihnen wollen und dass man immer Geld ausgeben könnte, um das Spielerlebnis noch ein bisschen toller zu machen. Diese höchst erfolgreichen Monetarisierungssysteme schwappen aus den digitalen in die analogen Spielräume – wenn ich zum Beispiel beim Spar an der Kassa kleine Päckchen von Lego Ninjago kaufen kann. Das, was ich habe, ist nie genug. So wird die so wertvolle Tätigkeit des Spielens nach und nach zu einem Konsumieren, und das ist auf vielen Ebenen sehr bedenklich. Ob daraus ein Buch entsteht, kann ich heute aber noch nicht sagen. (Alexander Amon, 8.4.2024)