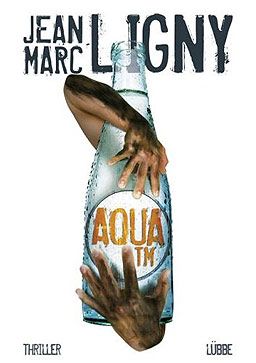
Jean-Marc Ligny: "AquaTM"
Gebundene Ausgabe, 813 Seiten, € 25,70, Lübbe 2009.
In die Tradition dystopischer Science Fiction stellt der Bretone Jean-Marc Ligny seinen im Original 2006 veröffentlichten Roman "AquaTM", auch wenn der nun - Zeichen der Zeit - als "Thriller" deklariert wird wie eine Agentenschmonzette. Die Anklänge an 70er-Jahre-Romane mit ähnlicher Umwelt-Thematik, allen voran John Brunners "The Sheep Look Up", sind unverkennbar: Sie beginnen beim umfangreichen Personen-Ensemble und gehen bis zu den Newsflashes oder Werbebotschaften fiktiver Firmen, die am Beginn jedes Kapitels stehen. All das fügt sich zu einem Mosaik mit Panoramawirkung zusammen, Generalthema ist die klimawandelbedingte "Umverteilung" des Wassers und deren katastrophale Auswirkungen in den 2030er Jahren. Im Norden Europas und Amerikas kämpfen die Menschen mit Orkanen und Überflutungen, weiter südlich herrscht zunehmende Dürre. Am schlimmsten in Burkina Faso, wo seit Jahren kein Regen mehr gefallen ist. Die Hilfsorganisationen haben das Land längst verlassen, in den Straßen liegen die Toten als Fressen für die Geier herum.
Ausgerechnet dort wird aber unerwarteterweise ein riesiges unterirdisches Süßwasser-Reservoir entdeckt, welches das Land vor dem endgültigen Aus retten könnte ... oder auch jede Menge Dollars einbringen, sollte sich ein westlicher Konzern das Wasser krallen. Eine Reihe von Personen - allesamt mehr oder weniger gebrochene Charaktere - setzt sich zu diesem Reservoir in Bewegung. Zunächst die Bretonin Laurie Prigent, die für die Hilfsorganisation SOS ("Save Ourselves" heißt das bezeichnende Motto in einer ungemütlich gewordenen Weltlage) arbeitet. Im Grunde will sie nur weg aus Europa, der Auftrag kommt ihr in ihrer Ziellosigkeit also gerade recht, gestaltet sich allerdings weit beschwerlicher als gedacht. Laurie muss sich mit einem LKW quer durchs anarchische Nordafrika durchschlagen, reguläre Verbindungen nach Burkina Faso gibt es keine mehr. Ihre einzige Begleitung ist der Holländer Rudy Klaas, einer von vielen heimatlos gewordenen Ökoflüchtlingen. Ursprünglich war er ein Softie, doch das Herumgeschobenwerden und speziell die zwangsweise Ausbildung in einem deutschen Fascho-Camp haben ihn brutalisiert - immerhin hat er dabei ein paar Fertigkeiten gelernt, die ihm beim Albtraumtrip durch das glühend heiße Afrika zugute kommen.
Zum Hauptkontrahenten der beiden wird Anthony Fuller, Vorstandsvorsitzender des US-amerikanischen Infrastruktur-Konzerns Resourcing - der auch am deutlichsten zeigt, dass Ligny männliche Charaktere etwas facettenreicher zeichnen kann als weibliche. Fuller hat weder ein Problem damit, zwecks eigenem Profit ein ganzes Land in den politischen Umsturz zu treiben noch die Nanny seines Sohnes sexuell auszubeuten. Zugleich verabscheut er als Mann der Aufklärung sowohl Rassismus als auch religiösen Wahn. Mit Entsetzen reagiert er darauf, dass seine Frau der Göttlichen Legion beitritt, einer immer mächtiger werdenden Sekte massenmörderischer Fundamentalchristen, die in der Love Parade Giftgas freigesetzt, die schwarze Bevölkerung von New Orleans mit einem Virus dezimiert und durch eine Deichsprengung die "verteufelt" weltlichen Niederlande überflutet haben. - Im Vergleich zu Fuller nimmt sich Fatimata Konaté, die als Hoffnungsträgerin ganz Afrikas idealisierte Präsidentin Burkina Fasos, wieder recht eindimensional aus. Die einzige schwerwiegende Schwäche bei den Roman-Charakteren ist allerdings die Idee, einen körperlich Schwerstbehinderten - Fullers Sohn - zur geradezu übernatürlichen Ausgeburt des Bösen hochzustilisieren; das beißt sich etwas mit der rationalen Grundausrichtung des Romans.
"AquaTM" entwirft ein ausgesprochen düsteres Szenario - nicht nur für den sterbenden Süden, sondern auch für die nicht mehr ganz so reichen Länder des Nordens. Enklaven als Weiterführung heutiger Gated Communities sind längst auch in Europa die Regel; wer sich das beschützte Leben dort nicht leisten kann, muss sich als Outer im nicht mehr kontrollierten Umland durchschlagen. Wie schon bei Richard Morgans "Profit" oder Jean-Christophe Rufins "Globalia" hat sich die Zweidrittelgesellschaft in ihr noch schrecklicheres Gegenteil verkehrt. Mit Kritik an den USA wird nicht gespart, und die kann durchaus auch mal platt ausfallen - zu beachten ist dabei, dass der Roman noch in der Bush-Ära geschrieben wurde. Wenn beschrieben wird, wie die USA ihr Weltreich nach einer missglückten ökonomisch motivierten Invasion Mexikos verloren haben, wie die staatliche Infrastruktur dem ultraliberalen Teufelskreis zum Opfer fiel und der Dow Jones nun unter fünfhundert liegt (heutiger Stand: irgendetwas über 8.000), dann klingt da eine seltsame Mischung aus Genugtuung und europäischem Wunschdenken an. Allerdings muss man auch einräumen, dass Jean-Marc Ligny im Vergleich zu Brunner in "The Sheep Look Up" geradezu versöhnlich bleibt: Der ließ immerhin in einem der zynischsten Finali der SF-Geschichte die ganzen USA zum Wohle der Welt abfackeln. - Unter dem Strich bleibt "AquaTM", das auch als Hörbuch erhältlich ist, auf jeden Fall ein lesenswerter Roman.
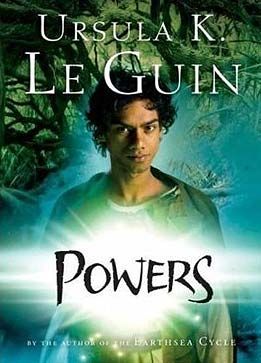
Ursula K. Le Guin: "Powers"
Broschiert, 502 Seiten, Houghton Mifflin 2009.
Hier also die Gewinnerin des heurigen "Nebula"-Preises für den besten Roman mitsamt ihrem Siegerbuch: "Powers" ist nach "Gifts" und "Voices" die dritte Folge in Ursula K. Le Guins Zyklus "Annals of the Western Shore". Diese Folgen spielen zwar vor dem Hintergrund derselben Welt, stehen aber jeweils für sich allein - was nicht zuletzt für diejenigen relevant ist, die lieber Übersetzungen als die Originalfassungen lesen. Denn während "Gifts" vor ein paar Jahren ins Deutsche übertragen wurde und bei Piper als "Die wilde Gabe" erschien, sind laut Verlag vorerst keine Übersetzungen der weiteren Bände geplant.
Schauplatz der "Annals" ist ein Flickenteppich von Klein- und Stadtstaaten an der Westküste eines nicht näher spezifizierten Kontinents; der kulturelle Entwicklungsstand entspricht in etwa dem der europäischen Spätantike. "Powers" ist exakt in der geographischen Mitte der Schauplätze von Teil 1 und 2 angesiedelt (mit denen es übrigens erst im Schlusskapitel eine personelle Zusammenführung geben wird; für NeuleserInnen spielt dies aber keine Rolle): Und zwar in den City States, einem Konglomerat von Stadtstaaten, die einander trotz oder gerade wegen ihrer großen Ähnlichkeit laufend bekriegen, Allianzen bilden und wieder brechen. Im Gegensatz zu anderen Staaten praktizieren alle City States Sklaverei, so auch Etra, wo der Roman-Protagonist Gavir aufwächst. "Powers" schildert, rückblickend aus der Persepktive eines freien Gavir erzählt, dessen Lebensweg vom Elfjährigen bis zum Erwachsenen.
Als Angehöriger des Volks der Marsh people wurde Gav als Kleinkind zusammen mit seiner Schwester Sallo entführt und lebt seitdem als Haussklave bei einer reichen Familie. Die behandelt ihn zwar überdurchschnittlich gut, doch bestimmt die Kluft zwischen children of the House und children of the Family sein Leben von klein an. Le Guin vermag es, diese Kluft mit genauem Blick in scheinbar kleinen Szenen zu verdeutlichen: Etwa wenn Familiennachwuchs und Sklavenkinder, die immerhin gemeinsam unterrichtet werden, ganz unschuldig zusammen die "Verteidigung Etras" spielen. Als das Familienoberhaupt sie ertappt, zwingt er sie ihre Holzschwerter zu verbrennen - Sklaven haben keine Waffen zu tragen. Dennoch fühlt Gav ein Grundvertrauen in die Gerechtigkeit des Systems, das er seinerseits sogar gegenüber noch niedriger gestellten Landwirtschaftssklaven weiterführt. Erst durch eine persönliche Tragödie verliert er dieses Vertrauen und flieht aus Etra; eher in schlafwandlerischem Schockzustand als wirklich geplant.
Der Titel "Powers" ist durchaus mehrschichtig zu verstehen: Auf den ersten Blick scheint er auf Gavs besondere Gabe anzuspielen, Visionen der Zukunft zu erhalten (er selbst nennt es remembering). Doch auch wenn die "Annals" mitunter unter der Bezeichnung "Children's book series" laufen, hat Le Guin mehr hineingepackt als nur den Fantasy-typischen Teenager-mit-besonderer-Gabe-Plot. Eine "Power" ist auch die Macht der Bildung, die Gav immer wieder zu bevorzugter Behandlung verhelfen wird, sei es als Gehilfe des Hauslehrers oder später als Geschichtenerzähler für einen Potentaten im Ausland. Und natürlich geht es um Herrschaftsstrukturen an sich, und hier spielt Le Guin in einer ansonsten nicht herausragend innovativen Geschichte ihre gewohnten Stärken aus. Denn sie lässt es nicht bei der simplen Gegenüberstellung eines ungerechten Gesellschaftssystems mit einem paradiesischen Zufluchtsort bewenden. Vielmehr geht es um Gavs persönliche Weiterentwicklung: Sein gutgläubiges Naturell wird in Etra in eine erste traumatische Krise gestürzt - doch lernt er daraus allmählich Machtstrukturen generell zu hinterfragen. Auf den weiteren Stationen seines Weges begegnet er Gesellschaftsformen, die von denen Etras stark abweichen; auch sie haben aber ihre Schattenseiten, wie der zunehmend kritisch werdende Gav feststellt. Erwachsenwerdung als Entwicklung eines tiefen Gerechtigkeitssinnes zu schildern macht "Powers" zu einem Coming-of-Age-Roman im besten Sinne.
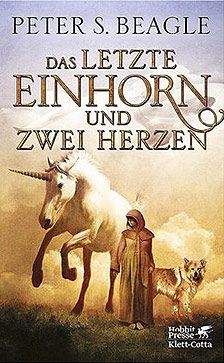
Peter S. Beagle: "Das letzte Einhorn und Zwei Herzen"
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, € 20,50, Klett-Cotta 2009.
Das Einhorn lebte in einem Fliederwald, und es lebte ganz allein. Als Eröffnungssatz ist das fast so berühmt wie: In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Und zumindest eine Gemeinsamkeit weist der 1968 veröffentlichte Klassiker von Peter S. Beagle mit dem Werk von Tolkien auf: In beiden Fällen geht es um das allmähliche Verschwinden der Magie aus der Welt. "Ein Pferd soll ich sein? Seh ich so aus?" empört sich das Einhorn über die für jeden Zauber blind gewordenen Menschen: "Sie erkennen mich ja nicht einmal, sie sehen mich an und sehen etwas ganz anderes!" - Doch während sich durch Tolkiens Gesamtwerk der Rückzug der Magie aus einer geringer werdenden Welt wie ein unausweichlicher historischer Prozess zieht, verbunden mit der Abwanderung der Elben, erhält die Magie beim ungleich romantischer eingestellten Beagle eine neue Chance.
Doch vor der Queste steht die Selbsterkenntnis - und zu der gelangt das Einhorn, als es von ein paar vorbeiziehenden Jägern die Bemerkung aufschnappt, es sei das letzte seiner Art. Unrast macht sich in ihm breit, und so wird es aus seiner zeitlosen Abgeschiedenheit gerissen und gezwungen, die sterbliche Welt zu betreten. Wo es der Reihe nach all den Figuren begegnet, die entweder vom Buch selbst oder der Zeichentrick-Verfilmung aus dem Jahr 1982 wohlvertraut sind: Der schusselige Zauberer Schmendrick, die Räuberbraut Molly Grue, Mammy Fortunas Mitternachtsmenagerie mit all den darin gefangenen falschen und echten Geschöpfen, König Haggard, der für das Verschwinden der Einhörner verantwortlich ist, und dessen adoptierter Thronfolger Prinz Lír. Eines ist allen gemeinsam: Jeder von ihnen ist bemüht, seiner (vielleicht nur vermeintlichen) Rolle gerecht zu werden: Lír der des Helden, Schmendrick der des mächtigen Magiers und die Räuber um Molly ihrem Selbstbild: Wie Robin Hood wären sie gerne, und sind doch nur eine Bande von Halunken, die Reich und Arm bestehlen. Einer Täuschung über ihre wahre Macht sitzt sogar Mammy Fortuna, die doch selbst mit Illusionen handelt, auf - und ausgerechnet der düstere Haggard verkündet die Maxime "Lebt wie ich: ohne Täuschungen!" und begeht damit an sich selbst den größten Betrug von allen. Und schließlich droht sich sogar das Einhorn zu verlieren - doch wie heißt es im Text: Helden wissen Bescheid mit der Ordnung und dem Ablauf von Geschichten, und vor allem mit dem glücklichen Ende.
Poesie, Humor und Selbstreflexion machen die besondere Atmosphäre des "Letzten Einhorns" aus - und nicht nur die Geschichte, sondern auch die Sprache, in der diese erzählt wird, ist schlicht und einfach wunderschön (an dieser Stelle gebührt auch der alten und zum Glück wiederverwendeten Übersetzung von Jürgen Schweier hohe Anerkennung). Und nach 248 Seiten wundert man sich einmal mehr, wie kurz ein Klassiker sein kann - verglichen mit den Mastodonten, die sich unserer Tage auf den Markt wälzen.
Anlässlich eines Doppeljubiläums (die "Hobbit-Presse" von Klett-Cotta ist 40, Peter S. Beagle am 20. April 70 geworden) erscheint "Das letzte Einhorn" in Neuausgabe, ergänzt um die 2006 veröffentlichte und nun erstmals auf Deutsch erhältliche Novelle "Two Hearts" ("Zwei Herzen"). Dabei handelt es sich um keine direkte Fortsetzung, sondern um eine Episode, die Jahre später angesiedelt ist - das berühmteste Huftier der Fantasy-Literatur, das sich der sterblichen Welt wieder entzogen hat, spielt darin nur eine kleine Nebenrolle. Im Zentrum stehen Schmendrick und Molly, die den alt gewordenen Lír aus seinem Dämmerzustand rütteln, damit er noch ein letztes Mal die Heldenrolle übernehmen kann. In deutlich schlichterer Sprache als beim Hauptwerk - doch passend zur Ich-Perspektive des neunjährigen Mädchens Sooz, das die Ereignisse ins Rollen bringt und aus seiner Warte schildert - erfüllt sich in "Zwei Herzen" das Schicksal eines der "Einhorn"-Protagonisten. Weitere Episoden sind bislang nicht erschienen, aber denkbar.
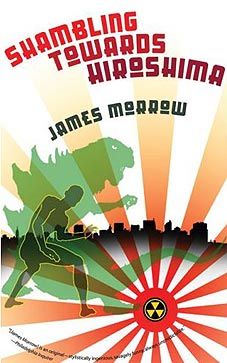
James Morrow: "Shambling Towards Hiroshima"
Broschiert, 192 Seiten, Tachyon 2009.
"Uncle Sam wants you in a monster suit" ... den Satz hört man auch nicht alle Tage. Aber Syms Thorley hört ihn, als ihn zwei FBI-ler abholen und für ein ultrageheimes Militärprojekt rekrutieren. Wir schreiben das Jahr 1945, der Krieg in Europa ist gewonnen - im Pazifik jedoch steuert alles auf eine voraussichtlich katastrophal verlustreiche Invasion der japanischen Inseln zu. Um dieses Schreckensszenario abzuwenden, lässt die US-Regierung an Überweapons forschen, um Japan zur Kapitulation zu zwingen. Welche letztlich zum Einsatz kam, wissen wir - doch hat die Welt nie erfahren, welche Alternative im Knickerbocker Project ausgebrütet wurde.
Während das Manhattan Project der Army mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat, läuft das auch als "New Amsterdam Project" (...) bezeichnete Parallelprogramm der Navy in der Wüste nebenan auf Hochtouren: Drei aus Leguanen gezüchtete flammenspeiende Riesenechsen mit Namen Dagwood, Blondie und Mr. Dithers stehen bereit, in Japan Angst und Schrecken zu verbreiten. Doch hatte die Navy eine humane Idee: Erst versucht man es mal mit einer Vorführung. Ein Schauspieler im Gummikostüm soll vor den Augen einer japanischen Delegation eine Modellstadt in Schutt und Asche legen, um die "Feuerkraft" der Monster zu demonstrieren. Und Syms Thorley (eigentlich Isaac Margolis), der als B-Moviedarsteller in Rollen wie Kha-Ton-ra the living mummy oder Corpuscula the alchemical creature glänzte, soll diese Rolle übernehmen. Weil er - siehe Romantitel - so schön watscheln kann.
"Shambling Towards Hiroshima" bezieht seine Komik nicht zuletzt aus dem Clash zweier gegensätzlicher Welten: Der steinernen Humorlosigkeit der Lamettaträger von der Navy und den Primadonnen-Allüren der überkandidelten Hollywood-Leute, die der Reihe nach zu dem Projekt hinzugezogen werden. Der ganz alltägliche Wahnsinn des B-Filme-Drehens, wo man schon mal einem schläfrigen Orang-Utan ein Stromkabel in den Arsch steckt, damit er endlich bedrohlich vor die Kamera springt, erklimmt die höchsten Höhen der Absurdität. Syms' Bekannte Brenda hat zwar das Drehbuch für das Katastrophenfilmchen geschrieben, aber lesen darf sie es nicht - so geheim ist es. Der Regisseur droht alles hinzuschmeißen, ein eigentlich gänzlich unnötiges Filmorchester gibt zur Zerstörungschoreographie sein letztes und Syms' Freundin Darlene entdeckt, wieviel Spaß der Sex mit ihm macht, wenn er im Monsterkostüm steckt. - Wieder einmal hat James Morrow für ein Buch genaue Recherche betrieben, um die Atmosphäre der Goldenen Ära des B-Monsterfilms einzufangen; reale Protagonisten jener Zeit wie Stop-Motion-Zauberer Willis O'Brien oder "Frankenstein"-Regisseur James Whale haben Cameo-Auftritte.
Aber es wäre nicht James Morrow, wenn das Ganze eindimensional auf der Bruhaha-Ebene ablaufen würde. Sein Können hat der Satiren-Spezialist aus Pennsylvania ja unter anderem mit der "Godhead"-Trilogie, in der der (ausgesprochen GROSSE) Leichnam Gottes gefunden wird, unter Beweis gestellt. Zum Humor und der liebevollen Huldigung an Godzilla & Co kommen in "Shambling" auch verblüffende Ideen wie die Theorie, dass billige Monsterfilme Pionierleistungen für den Feminismus erbracht hätten, weil Love Interests nur als weibliche Wissenschafterinnen in die Handlung zu quetschen waren. Viel ernster natürlich das naive aber sehr menschliche Gedankenspiel: Was wäre gewesen, wenn man Japan wirklich eine verfilmte Vorwarnung gegeben hätte - immerhin ist es der ganze Sinn und Zweck des Knickerbocker-Projekts, nicht erst "ein oder zwei Städte zerstören zu müssen", um den Feind in die Knie zu zwingen. Tragikomisch bis tieftraurig schließlich die Einschübe aus den Jahrzehnten nach dem Filmdreh, wenn Syms auf Fan Conventions seinem uninteressierten Nerd-Publikum Predigten gegen Rüstungswettlauf und Atomwaffen hält. - All diese verschiedenen Ebenen laufen im Schlusskapitel zusammen, Tränen sind da nicht verboten. Ganz tolles Buch!
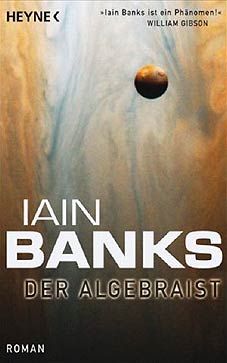
Iain Banks: "Der Algebraist"
Kartoniert, 798 Seiten, € 10,30, Heyne 2009.
Jetzt auch als halb so schweres "Taschenbuch" erhältlich, was in der broschierten 2006er Ausgabe noch ein ziemlicher Ziegel war: "The Algebraist", im Original 2004 erschienen, gehört nicht zu Iain Banks' bekanntem "Kultur"-Zyklus, spielt sich aber vor einem Hintergrund ab, der durchaus einige Parallelen aufweist. Auch hier hat sich eine die Galaxis umspannende Meta-Zivilisation ausgebreitet, der verschiedenste Spezies angehören, und auch hier scheinen Entwicklungsstand und wachsende Exzentrizität Hand in Hand zu laufen.
Diese Meta-Zivilisation - genauer gesagt: die jüngste von vielen - nennt sich Merkatoria und ist ein recht rigides, aber in seinen Machtstrukturen schwer durchschaubares Gebilde mit einem Alter von 9.000 Jahren. Ein Klacks mithin, denn die gesamtgalaktische Geschichte reicht Milliarden von Jahren zurück - fast so lange wie die Geschichte der Dweller, die sich kurz nach der Entstehung der Milchstraße mit Unterlichtgeschwindigkeit ausgebreitet und inzwischen so gut wie alle Gasriesen kolonisiert haben. Der Merkatoria gehören sie weder an noch scheren sich sich auch nur im geringsten um sie, auch wenn man sich zahllose Sonnensysteme teilt. Was soll man auch mit den Zivilisationen der Schnellen anfangen, die kommen und gehen wie die Jahreszeiten, während man selbst durchaus ein individuelles Lebensalter von Millionen oder gar Milliarden Jahren erreichen kann? Wer sich jetzt unendlich überlegene oder weise Geschöpfe ausmalt, sieht sich allerdings getäuscht: Banks zeichnet die Dweller als erstaunlich chaotische Anarchos, die ihren nicht immer verständlichen Hobbies nachgehen, und als (vermeintliche?) Kindsköpfe mit einem skurrilen Sinn für Humor. Die Dweller präsentieren sich als ein Haufen quasselnder Riesen-Yo-Yos, die in ihren schwebenden Städten und Freizeit-Clubs ein Stück mit dem Titel "Zivilisation" spielen; eine Travestie - allerdings steht diese seit Milliarden von Jahren auf dem Spielplan. Irgendwie kriegen sie's also besser hin als die schnell entstehenden und vergehenden Nachbarvölker.
Der einzige Kontakt zwischen Dwellern und Merkatoria läuft über die Seher: zugelassene Kontaktleute und Dweller-Forscher. Einer davon ist der Mensch Fassin Taak, die Hauptfigur des Romans. Der findet sich unversehens im Zentrum des allgemeinen Interesses wieder, weil einer seiner Dweller-Kontakte einen unerwarteten Informationsschnipsel geliefert hat: Im uralten Werk "Der Algebraist" finden sich Hinweise auf ein mythenumranktes Wurmloch-Netzwerk der Dweller, das die Merkatoria schlagartig auf ein neues Infrastruktur-Level katapultieren würde. Während ein benachbartes Sternenreich eine Invasionsarmee in Fassins Heimatsystem Ulubis schickt, um sich die begehrte Dweller-Liste unter den Nagel zu reißen, wird Fassin selbst von einer militärisch-religiösen Teilorganisation der Merkatoria rekrutiert, um die Liste seinerseits sicherzustellen. Und das wird zum Ausgangspunkt einer Odyssee mit wachsend absurden Zügen, in der Banks' überbordende Fantasie gleichermaßen zu Fluch und Segen wird.
Wenn Fassin im Zuge der wilden Jagd irgendwann stöhnt, dass er solange weitermachen würde, bis er so orientierungslos war, so verblödet von den vielen Betäubungen, dass er vergaß, worum es bei der ganzen irrwitzigen Suche eigentlich ging, dann kann der Leser das in gewisser Weise nachfühlen. Denn der wird geradezu geflutet mit einer nicht enden wollenden Kaskade von Namen und - auch das eine Parallele zu den "Kultur"-Romanen - wildwuchernden Bezeichnungen. Die Dweller-Population des Ulubis-Systems beispielsweise trägt den Titel der Auftriebsneutrale Flächendeckende Gasriesen-Dweller-Stamm Erster Ordnung im Klimaxstadium; das geht doch flüssig von der Zunge. Einen Hang zur Geschwätzigkeit kann man Banks nicht absprechen, dazu kommen die barocke Üppigkeit des Settings, jede Menge groteske Situationen, ein locker aus der Hüfte geschossener Stil und humoristische Einsprengsel, die die Handlung immer wieder zu einem grellen Panoptikum machen. Die Stringenz leidet darunter naturgemäß etwas, was aber durchaus beabsichtigt sein dürfte. "Der Algebraist" ist der typische Fall eines Buchs, das man am besten mit der Philosophie Der-Weg-ist-das-Ziel angeht und dann auch ohne größere Enttäuschungen über den Verlauf und Abschluss des Plots genießen kann. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es Iain Banks' Vorstellung von Heidenspaß sein müsste, einen Einsiedler mit dem Hubschrauber zu entführen und mitten in der Love Parade abzuwerfen.
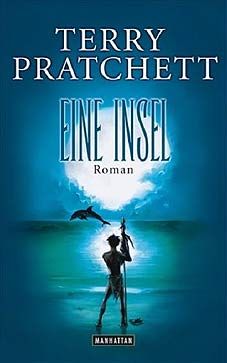
Terry Pratchett: "Eine Insel"
Gebundene Ausgabe, 445 Seiten, € 20,60, Manhattan 2009.
Ein Mensch allein ist nichts. Zwei Menschen sind eine Nation. Mit diesem Credo machen sich die ProtagonistInnen von Terry Pratchetts jüngstem Roman (der im Original auch den Titel "Nation" trägt und nicht zur "Scheibenwelt" gehört) an ein großes Projekt auf kleinem Raum: den Aufbau einer Hoffnung gebenden Gemeinschaft von Versprengten, einer Nation im Zeichen von Selbsterkenntnis, Aufklärung und Wissenschaft. Angesiedelt ist die Handlung in der Epoche, in der diese Weltanschauung am vehementesten vertreten wurde, dem 19. Jahrhundert .... wenn auch nicht ganz in "unserem" 19. Jahrhundert, wie Abweichungen in der britischen Thronfolge und einige Anachronismen bald erahnen lassen. Schauplatz des Geschehens ist ein Inselchen im ... auch nicht ganz dem Pazifik, sondern dem Großen Südlichen Pelagischen Ozean, wo sich Segelflossenkrokodile und Baumkraken tummeln und Archipele wie die Rosenmontagsinseln liegen. Und wo Menschen mit den Geistern ihrer Ahnen oder dem Totengott Locaha sprechen können - selbst wenn ihren lieber wäre, die würden endlich mal die Klappe halten.
Die Keimzelle der neuen Nation bilden zwei höchst unterschiedliche Charaktere: Der Eingeborenenjunge Mau, der von der absolvierten, doch noch nicht offiziell bestätigten Initiation zum Mann auf seine Heimatinsel zurückkehrt und diese von einem Tsunami verwüstet vorfindet. Und Daphne (eigentlich Ermintrude, aber den Namen kennt zu ihrem Glück in der Neuen Welt ja niemand), ein Hosenmenschen-Mädchen aus Europa, das durch denselben Tsunami auf der Insel schiffbrüchig wurde. Es kommt zu einigen kulturell bedingten Missverständnissen - immerhin hält man sich in einer Region auf, wo das Kompliment "Du bist sehr klug" durchaus vom Nachsatz "Eines Tages würde ich gern dein Hirn essen" gefolgt werden kann (wofür sich Daphne auch artig bedankt). Doch raufen sich die beiden zusammen und empfangen nach und nach weitere Überlebende der Katastrophe auf ihrer Insel: Das Nation Building setzt sich in Gang und wird in Folge allerlei Schwierigkeiten zu bewältigen haben.
Es wäre nicht Terry Pratchett, wenn der Roman nicht von hochkomischen Szenen durchsetzt wäre: Da muss Mau zum Beispiel waghalsig eine Sau melken, die er zuvor mit Bier betäubt hat, und dann hat noch zum Leidwesen aller der Schiffspapagei überlebt, der zu den unpassendsten Gelegenheiten "Zeig uns deinen Schlüpfer!" plärrt.
... doch werden "Scheibenwelt"-Fans feststellen, dass der Humor hier in der Regel subtiler und dünner gesät ist als in früheren Romanen. Die Ausgangssituation ist schließlich eine tragische: Mau ist "schuld" am Tod seiner gesamten Familie, weil die ihn freudig am Strand erwarteten, als der Tsunami kam. Er glaubt nun keine Seele zu haben, hadert mit seiner Religion und würde sich sofort umbringen, wenn er sich nicht um andere Menschen kümmern müsste. Und Daphne hat ihrerseits mit den Dämonen der Vergangenheit und Gegenwart zu ringen. Diese seelischen Konflikte zu bewältigen und eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, wird zur zentralen Aufgabe der beiden und ihrer MitstreiterInnen. - "Eine Insel", das für Pratchett-Verhältnisse stark in Moll-Töne getaucht ist, entwickelt sich damit letztlich zu einer schönen Utopie - mit einem Nachwort, das die Sehnsucht nach Verwirklichung noch größer macht.
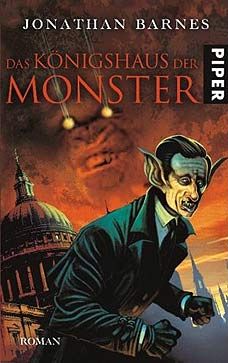
Jonathan Barnes: "Das Königshaus der Monster"
Gebundene Ausgabe, 395 Seiten, € 20,60, Piper 2009.
Dieses Cover ist ein heißer Anwärter auf den Titel Scheusälchen der Saison - aber zum Glück ist es um ein interessantes Buch gewickelt. Einmal mehr weiß der Brite Jonathan Barnes, der es bereits mit "The Somnambulist" ("Das Albtraumreich des Edward Moon") zu einigem Renommee gebracht hat, von gar seltsamen Vorkommnissen in London zu berichten.
"Das Königshaus der Monster" (im Original erst 2008 unter dem Titel "Domino Men" erschienen) dreht sich um Henry Lamb, einen wenig bemerkenswerten Archivar im öffentlichen Dienst Ende 20. Ohne sein Zutun wird er in haarsträubende Vorkommnisse hineingezogen - spätestens als er seinen im Koma liegenden Großvater im Krankenhaus besucht und kurz danach ein Fensterputzer vor ihm zu Boden klatscht, der wiederholt die ominösen Worte Die Antwort ist "ja" stammelt. Bei Henry geben sich in der Folge die seltsamsten Gestalten die Klinke in die Hand: Vom Abgesandten des Direktoriums Mister Jasper und dessen Vorgesetztem Mr. Dedlock, der als halb menschliches, halb fischartiges Wesen in einem verborgenen Wassertank im Londoner Riesenrad lebt, bis zu den titelgebenden Dominomännern: zwei durchgeknallten Massenmördern, die die Uniformen von Schuljungen tragen. Sie alle sind Akteure eines im Geheimen geführten Krieges zwischen dem schon von "Edward Moon" bekannten Direktorium und dem britischen Königshaus. Als Henry der entsetzlichen Wahrheit über das Haus Windsor - seiner irrsinnigen Niedertracht und heimlichen Gelüste ansichtig wird, muss er sich erst mal übergeben - will diese Wahrheit aber noch nicht mit den LeserInnen teilen, um ihre Albträume nicht anzufachen ...
... mit anderen Worten: Barnes spielt gerne mit seinem Publikum. Das geht schon damit los, dass der Roman mit einer ganzen Serie von Anfängen beginnt: Auf eine Anmerkung des (fiktiven) Herausgebers folgt eine Rückblende auf ein blutiges Ritual, das sich Jahrzehnte vor Henrys Lebzeiten abgespielt hat, dann dessen Kindheitserinnerungen an den Großvater und mit der Schilderung eines öden Arbeitstages schließlich der Beginn des eigentlichen Geschehens. Das ist ein bisschen so, als könnte sich jemand vor lauter Erzählbegeisterung gar nicht einkriegen und müsste deshalb mehrfach von vorne anfangen - wie der Großvater, der ausgerechnet dann ins Koma fällt, als er einen Witz erzählen will (um gleich darauf von den real gewordenen Protagonisten ebendieses Witzes umringt zu werden: seltsam, indeed). Später schieben sich zwischen Henrys aus der Ich-Perspektive geschilderte Erlebnisse Kapitel, die heimlich von jemand anderem eingefügt wurden: Henry entdeckt den Handlungsklau mit Entsetzen - und Barnes hat einmal mehr spielerisch die Form aufgebrochen. Ganz schön frech auch, was er in Form des unbedarften 60-jährigen Thronerben Prinz Arthur (Urururenkel einer namentlich nicht genannten, aber eindeutig nach Queen Victoria aussehenden Herrscherin) mit Prince Charles anstellt: der darf sich nicht nur im Titelbild wiedererkennen.
Nicht nur der Prolog, in dem der vor Tod oder Verwandlung stehende Erzähler seinen Bericht mit bedeutungsschwangeren Anmerkungen würzt, lässt an Lovecraft denken - auch das Katastrophenszenario, auf das der Geheimkrieg zusteuert, und das unvermeidliche Nachwort des "Herausgebers" sind entsprechend gestaltet. Das ganze als Lovecraft-Persiflage zu sehen, greift aber auch zu kurz: Bleibt es doch letztlich unentschieden, ob Barnes "nur" unterhalten oder sehr wohl auch erschrecken will; blutig genug sind die Ereignisse allemal, und das Schicksal einiger nach Genre-Regeln vermeintlich unantastbarer Nebenfiguren widersetzt sich auch den Erwartungen. Der literaturwissenschaftliche Fachterminus für ein Buch wie dieses wäre wohl: strange.
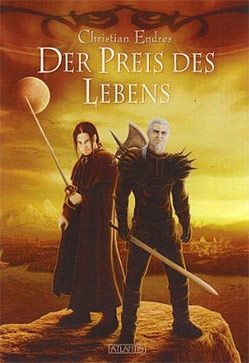
Christian Endres: "Der Preis des Lebens"
Broschiert, 192 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.
Der Würzburger Christian Endres war bislang ein Mann des Kurzformats, "Der Preis des Lebens" wurde als sein erster Roman herausgegeben; wobei "Roman" eher großzügig auszulegen ist: Es handelt sich um eine Reihe loser verbundener Fantasy-Episoden, die zwar um die beiden selben Hauptfiguren kreisen, aber inhaltlich und auch vom Grundton her recht stark voneinander abweichen - genausogut könnte man von einer Kurzgeschichtensammlung, in handlungschronologische Reihenfolge gebracht, sprechen.
Das zentrale Duo bilden Visco deRául, ein geläuterter "Halbvampir", der früher seine Nächte damit verbrachte seitensprungwillige Adelsdamen auszusaugen - jetzt allerdings sterblich und zu seinem Leidwesen für Frauen nicht mehr ganz so unwiderstehlich ist. Und Lorn, der Jagam: Ehemaliger Krieger einer Kirche, die Kreaturen wie Visco bis aufs Blut bekämpft. Lorn ist desillusioniert, mürrisch und nicht eben einfühlsam. Wenn ihn Dorfbewohner in Bedrängnis um Rat bitten, dann sieht das so aus: "Ich an Eurer Stelle würde meine sieben Sachen zusammenpacken und verschwinden", sagte der Jagam, ehe er zusammen mit der Hoffnung aus dem Haus stiefelte. - Aber natürlich lässt er sich beizeiten breitschlagen; Probleme mit dem Schwert aus der Welt zu schaffen, ist schließlich die gemeinsame Aufgabe, die das ungleiche Duo eint.
Die stilistische Bandbreite der sechs Episoden ist groß: "Pilze und Götter" beispielsweise kommt fröhlich und unbeschwert daher - und springt mit einer verführerischen Troll-Frau von unwiderstehlicher Sexyness gängigen Fantasy-Stereotypen mit Freude ins Gesicht. Das düstere und massakerselige "Wölfe im Nebel" hingegen verbindet mit der Schilderung des Kampfes um ein von Werwölfen belagertes Dorf Sword & Sorcery mit Horror-Elementen. - Am schwächsten ist ausgerechnet die Episode, die der Chronologie wegen am Anfang stehen muss: Im titelgebenden "Der Preis des Lebens" geht es darum, wie Visco und Lorn zum Team wurden - aber so wirklich plausibel wird einem weder des Vampirs Läuterung noch Lorns schnelle Akzeptanz, sich mit einem potenziellen Erzfeind zu verbünden. Auch sprachlich steht der "Preis" den späteren, besseren Episoden gefährlich im Wege. Wenn (kurzer Rückblick zum "Letzten Einhorn") Peter S. Beagle beispielsweise eine löwenfarbene Sonne aufgehen lässt, dann ist das nicht nur eine Farbaussage, sondern fängt die gesamte Stimmung des Augenblicks in einem einzigen Wort ein. In Endres' Eröffnungsepisode hingegen ist statt poetischer Verdichtung Wort-Overkill angesagt: Da fühlt sich Visco an den seelischen Abgrund gedrängt, aus dem die kreischenden Flammen des Wahnsinns empor loderten wie das Höllenfeuer der Verdammnis, worauf sich gleich die scharfen, in das Gift der Schuld getauchten Krallen der Erinnerung ausstrecken. Uff. Aber zum Glück bleibt es nicht so.
Episode 1 kann man also getrost überspringen, sie erweckt ohnehin den Eindruck einer Serien-Pilotfolge, in der es nur darum geht, möglichst schnell die Grundkonstellation zu erarbeiten. Schon ab der zweiten Episode sind Visco und Lorn eingespielt wie ein altes Ehepaar, und dann geht es auch erst richtig los. Die grundsätzliche Chemie zwischen den Protagonisten passt und Endres' Konzept für eine neue Action-Serie, deren Auftakt dieser Band bilden soll, könnte aufgehen.
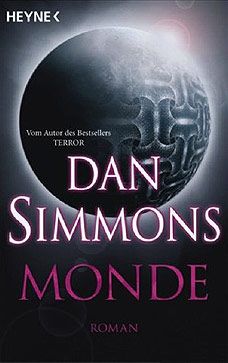
Dan Simmons: "Monde"
Broschiert, 415 Seiten, € 9,20, Heyne 2009.
Der Ehrlichkeit halber sei gleich zu Beginn festgehalten: "Monde" ist kein Science Fiction-Roman. Das deshalb in aller Deutlichkeit gesagt, weil der Klappentext mit ominösen Sätzen wie Ist der Mond wirklich nur ein leerer, verlassener Ort? oder ... bis er eine geheimnisvolle junge Frau kennenlernt, die ihn auf eine phantastische Reise mitnimmt (zweiteres nur mit reichlich Streckung den Inhalt beschreibend, ersteres vollkommen aus der Luft gegriffen) falsche Erwartungshaltungen weckt.
Die gute Nachricht: "Monde" ist ein sehr guter Roman - und er könnte den Titel "Erinnerungen an das Raumfahrtzeitalter" tragen, wenn der nicht schon vergeben wäre. Im Original 1989 veröffentlicht, erschien "Phases of Gravity" 1994 zum ersten Mal auf Deutsch (unter dem Titel "In der Schwebe", ebenfalls bei Heyne). Und das Frappierende: Die sich durch den Roman ziehende Niedergangsstimmung, damals noch unter dem Eindruck der "Challenger"- und Tschernobyl-Katastrophen und dem damit einhergehenden Vertrauensverlust in die Hochtechnologie stehend, ist 20 Jahre später ganz dieselbe. Inzwischen haben wir auch die "Columbia"-Katastrophe erlebt, die Space Shuttles stehen kurz vor dem endgültigen Aus - und seien wir uns ehrlich: Mit der Glorie früherer bemannter Weltraumreisen ließ sich der Pendelverkehr in den Erdorbit und zurück ohnehin schon lange nicht mehr vergleichen. Der Weltraum, einst eine so furchterregende Herausforderung, dass Experten sich Sorgen gemacht hatten, selbst die jüngsten, kühnsten und stärksten Testpiloten der Nation würden sie nicht ertragen, war heute zur Domäne von Männern mit Lesebrillen und Prostataleiden geworden, zieht Roman-Protagonist Richard Baedecker gallig Bilanz.
Baedecker war einst selbst auf dem Mond - in der Endphase des "Apollo"-Programms, als die TV-Stationen das Interesse verloren, weil das Drehbuch zu schwach war und die Astronauten eher kritisiert als zu Helden verklärt wurden. Jetzt ist er in seinen 50ern und geschieden, arbeitet für ein Flugzeugunternehmen und musste längst feststellen, dass Beschäftigt- und Glücklichsein nicht das Gleiche ist. Dan Simmons schildert ihn als Menschen, der in merkwürdiger Distanz zu seiner Umwelt lebt: Den Feiertag, den man in seinem Heimatstädtchen ihm zu Ehren abhält, erlebt er als ebenso unwirklich wie einst die Flaggenhissung und Nixons Anruf auf dem Mond. Genau wie in den Simulationen, schoss ihm damals als einziger Gedanke durch den Kopf. Diese Erinnerungspassagen verschmelzen im ersten Kapitel mit Baedeckers geschäftsbedingter Landung in Indien, wo sein Sohn in einem Ashram lebt; von ihm hat er sich genauso entfremdet wie von allem anderen.
Noch melancholischer wird es, wenn Baedecker seine ehemaligen Astronautenkollegen wiedertrifft: Einer davon ist mittlerweile ins evangelikale Erlösungsgeschäft eingestiegen, der andere leidet an einer schweren Krankheit. Nur ein Hoffnungsschimmer ist geblieben und beginnt langsam immer heller zu strahlen: Maggie Brown, eine Freundin seines Sohnes und besagte geheimnisvolle junge Frau des Klappentexts, macht sich an die schwierige Mission, Baedecker wieder an die Menschen und das Leben heranzuführen. Das Thema Religion - naheliegend im Zuge einer Sinnsuche und von Simmons immer wieder mal gerne aufgegriffen - blitzt an mehreren Stellen und in verschiedenster Form auf. Doch weit wichtiger ist, hier zumindest, der zwischenmenschliche Aspekt. - "Monde" ist ein Roman der leisen Töne über einen Menschen, der alle Bindungskräfte verloren zu haben scheint, in einen Zustand der Zentrumslosigkeit abgedriftet ist und daraus langsam wieder zurückfinden muss.

David Whitley: "Die Stadt der verkauften Träume"
Broschiert, 380 Seiten, € 8,20, Goldmann 2009.
Eine positive Überraschung zum Schluss: Mit "Die Stadt der verkauften Träume" ("The Midnight Charter") ist dem 25-jährigen Briten David Whitley ein Fantasy-Roman gelungen, der sich jenseits ausgetretener Trampelpfade bewegt. Fast schon schade, dass der Klappentext - oder auch diese Rezension - einen Handlungsausblick geben muss, denn der surreale Beginn lässt einen verdutzt innehalten: Da muss der halbwüchsige Mark miterleben, wie nacheinander seine Geschwister und seine Mutter grau werden, der maskierte Schnitter sie und schließlich auch ihn selbst abholt, worauf Mark im Nachleben erwacht. - Gleich darauf wird diese traumartige Sequenz aber aufgeklärt: Der Schnitter ist ein mit Schutzbrille bewehrter Arzt, an den Mark von seinem Vater verkauft wurde, um ihn von der tödlichen Grauseuche zu heilen.
Doch wird die Surrealität damit noch nicht vorbei sein, im Gegenteil: Mark muss nun ebenso wie die ein wenig ältere Lily für den renommierten Sterndeuter Stelli in dessen Turm arbeiten: Ein hermetisches Ambiente, das sich vor den Turmmauern in der eigenartigen Stadt Agora widerspiegelt. Die wimmelt zwar vor Leben, scheint aber in einem seltsam zeitlosen Zustand zu verharren. Nur sporadisch fließen ein paar Informationen über die in Sternzeichen-Bezirke unterteilte und vom Empfangsdirektorium regierte Stadt ein: So etwas wie Geld oder Tempel gab es früher einmal, nicht jedoch im jetzigen Goldenen Zeitalter. Und irgendwie ist man gar nicht überrascht, wenn man zwischendurch erfährt, dass niemand je einen Weg aus den riesigen Stadtmauern hinausgefunden hat: Agora zu verlassen ist zu einem Synonym für sterben geworden.
Doch auch wenn es kein Geld gibt, lebt Agora - ganz seinem Namen entsprechend - vom Handel: Jeder schlägt sich durch, indem er irgendetwas zum Tausch anbietet, denn es gibt immer jemanden, der bereit ist zu handeln, lautet das oberste Gesetz. Zur Ware können auch Gefühle werden, wie Lily am eigenen Leib erfährt, als sie an einen Destillierapparat angeschlossen wird, der ihren Ekel in Flakons abfüllen soll: Eine Erfahrung, die Lily zur Kämpferin gegen ein System werden lässt, das alle, die nichts mehr zum Tauschen haben, zum Ausschuss macht. - Lily und Mark durchleben in der Folge beide einen enormen gesellschaftlichen Aufstieg, zugleich verkörpern sie zwei antagonistische Prinzipien ... und werden dabei, ohne es zu wissen, die ganze Zeit über genau beobachtet.
Die Sprache von "Die Stadt der verkauften Träume" mag schlicht wirken, doch ist sie dies auf eine gute Weise, passend zum Schwebezustand der eigentümlichen Welt von Agora. Immer wieder sorgen die Personenkonstellationen für Überraschungen, und buchstäblich bis zur letzten Seite weiß man nicht, worauf der Roman letztlich hinauslaufen wird. Nichtsdestotrotz ist der in einigen Rezensionen als "überhastet" bezeichnete Schluss der einzig folgerichtige. - Und noch ein besonderes Goodie: Durch eine Verzögerung bei der Veröffentlichung der Originalausgabe von "The Midnight Charter" kommen deutschsprachige LeserInnen schon einige Monate vor den englischsprachigen zum Zuge. Das hat man auch nicht alle Tage.
Und für die nächste Rundschau gibt's mal keine nebulosen Andeutungen, sondern appetitanregendes Namedropping: Greg Bear! Neil Gaiman! Lynn Flewelling! Stephen Baxter!
(Josefson)