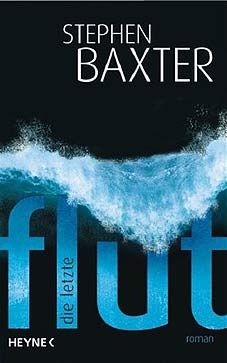
Stephen Baxter: "Die letzte Flut"
Gebundene Ausgabe, 751 Seiten, € 20,60, Heyne 2009.
Stephen Baxter hat eine echte Begabung, den Menschen in die richtige Relation zu kosmischen Dimensionen zu setzen - selbst wenn er die Weiten von Raum und Zeit einmal gegen den vergleichsweise überblickbaren Schauplatz Erde eintauscht und die Handlung in der allernächsten Zukunft beginnen lässt. Denn als unser Planet in ein neues Erdzeitalter - bezeichnenderweise Hydrozän genannt - eintritt, wird es keine irrwitzig-lächerlichen Rettungsprojekte geben, mit denen alles wieder ins rechte Lot gezwungen werden kann (Atombomben wirken nur im TV-Katastrophenzweiteiler als Allheilmittel). Wie Sturmkrähen ziehen die WissenschafterInnen in "Die letzte Flut" ("The Flood") von einem prognostizierten Ereignis zum nächsten und sehen hilflos mit an, wie die Vorhersagen Realität werden: Von der Überschwemmung Londons und New Yorks über einen Mega-Tsunami, der West-Großbritannien überflutet bis zur Ozeanischen Transgression, als sich das Kaspische Meer über Schwarzes und Mittelmeer dem Weltozean anschließt. Und unerbittlich immer weiter: Vier Karten auf den Einbandinnenseiten zeigen die Weltkarte mit einem um sechs, 100, 400 (da ist Europa bereits weitestgehend dahin) und 1.000 Meter erhöhten Meeresspiegel und stimmen damit schon vorab auf das Geschehen im Roman ein.
Baxter bleibt seinem Ruf, ein Vertreter der Hard SF zu sein, treu - auch wenn die wissenschaftlichen Bezüge diesmal nicht in Astro- und Quantenphysik zu finden sind, sondern auf vertrauter erscheinenden Gebieten wie Klimaforschung, Ozeanographie und Geologie. Wenn manche LeserInnen daher schnell wittern, dass Ausmaß und Geschwindigkeit der Weltenflut in kein bekanntes Klimamodell passen, haben sie Recht. Allerdings bezieht sich Baxter auf eine - spekulative, aber real existierende - Hypothese ganz anderer Art. Diese zu verifizieren, bricht die Wissenschafterin Thandie Jones im Roman zum Mittelatlantischen Rücken auf. Während erst Verkehrswege, dann die Infrastruktur und schließlich ganze Nationen zerfallen, wird es aber bald nicht mehr um die Frage gehen: Warum steigt weltweit das Wasser? Sondern nur noch um: Wann hört es endlich auf?
Die Winzigkeit des Menschen zu demonstrieren ist aber keineswegs dasselbe wie ein inhumaner Grundton, im Gegenteil: Schon für die Einführung der ProtagonistInnen hatte Baxter eine geniale Idee: USAF-Hubschrauberpilotin Lily Brooke, NASA-Klimaforscher Gary Boyle und der britische Offizier Piers Michaelmas verbrachten mehrere Jahre zusammen in Geiselhaft in einem durch Bürgerkriege libanonisierten Spanien. Von Splittergruppe zu Splittergruppe wurden sie weitergereicht und durch die erlittenen Traumata zusammengeschweißt, sodass sie sich nach ihrer Befreiung schwören in Kontakt zu bleiben. Man schreibt inzwischen das Jahr 2016 - und als die frisch Befreiten nach London kommen, stellen sie fest, dass sie in der Gefangenschaft einiges verpasst haben. Aufgestapelte Sandsäcke und Wasserschäden an den Gebäuden gehören in der Metropole bereits zum Alltag, ohne dass deswegen jemand groß besorgt wäre - erste milde Vorzeichen der Dinge, die da kommen werden.
Durch die enge Verbindung zwischen den Hauptpersonen kann Baxter die räumlichen und zeitlichen Distanzen ("Die letzte Flut" reicht als Chronik bis ins Jahr 2052), die sich aus der globalen Katastrophe ergeben, überbrücken. Mit der Unterstützung des Milliardärs Nathan Lammockson vom Infrastruktur-Unternehmen AxysCorp bereisen Lily, Gary, Piers und Thandie unter immer schwierigeren Umständen die versinkende Welt. Das Mädchen Grace wiederum, als Baby einer weiteren Geisel geboren, wird für die ProtagonistInnen, die allesamt nur geringe persönliche Bindungen haben, nicht nur zu einem familiären Ersatz. Die Fürsorge für Grace wird auch zum Symbol für die Verantwortung gegenüber der Menschheit an sich; zugleich illustriert Graces Entwicklung eine wachsende Entfremdung zwischen deren - möglicherweise letzten - Generationen.
Es gibt so Bücher, auf die freut man sich Monate lang im Voraus - und wenn sie dann da sind, erfüllen sie die Erwartungen voll und ganz. Umso besser, dass noch diesen Sommer die Fortsetzung "Ark", zunächst in der englischen Fassung, erscheinen wird. Beeindruckend!

William Sanders: "East of the Sun and West of Fort Smith"
Broschiert, 588 Seiten, Norilana Books 2008.
... der Titel ist gewissermaßen als Lageplan dafür zu verstehen, wo eine echte literarische Schatztruhe vergraben liegt - gut versteckt zumindest für deutschsprachige LeserInnen, da sich bislang kein Verlag darum bemüht hat, den in Oklahoma lebenden Autor zu übersetzen. Und dabei ist "East of the Sun and West of Fort Smith" fast schon ein Nachruf - nicht weil William Sanders gestorben wäre, sondern weil er angekündigt hat, seine immerhin fast zwanzigjährige literarische Tätigkeit im Großen und Ganzen zu beenden. Eine gute Gelegenheit also, nachträglich die besten Werke eines Autors kennenzulernen, der grummelnd zur Kenntnis nehmen musste, dass er in seinem Wikipedia-Eintrag als writer primarily of short fiction dargestellt wird, dies aber mit demselben Sarkasmus hinnimmt, der sich auch durch viele seiner Geschichten zieht. 27 Kurzgeschichten aus den Jahren 1993 bis 2007 sind in dem prächtigen Sammelband vereint - diese reichen von (hauptsächlich) Science Fiction und Alternativwelterzählungen bis zum Magic Realism.
Einen Sonderposten machen Geschichten aus, in denen Sanders seine Cherokee-Abstammung zum Ausgangspunkt nimmt, um aus der Perspektive von Native Americans (eine Bezeichnung übrigens, über die sich selbige in den Geschichten laufend lustig machen) zu schildern. Diesen Geschichten ist ein vergnügliches Schäuferl Revanchismus nicht abzusprechen - und das Wort yoneg - offenbar die Cherokee-Bezeichnung für "Bleichgesichter" wie uns - lernen wir recht bald kennen. Da engagiert beispielsweise der Rassist Marvin in "The Scuttling" einen indianischen Kammerjäger - ohne zu berücksichtigen, dass der vielleicht ganz andere Vorstellungen davon hat, was so alles bioinvasives Ungeziefer sei. Oder ein Cherokee-Hexer ("Going After Old Man Alabama") reist in der Zeit zurück, um die Landung Kolumbus' zu verhindern - landet aber mangels Geschichtskenntnissen auf dem falschen "Dampfer". In "World on Fire" brandet White Trash auf der Flucht vor den Fluten einer klimagewandelten Welt an die Grenzen eines Reservats - und in "Elvis Bearpaw's Luck" sind die Weißen durch selbstverschuldete biologische Kriege überhaupt ausgestorben - sodass sich die Cherokee und ihre Nachbarn ungestört einem altehrwürdigen indianischen Ritual widmen können: dem Bingo-Spiel. Auch Sanders' berühmteste Kurzgeschichte, das ebenso humorvolle wie sprachlich herausragende "The Undiscovered", hat Cherokee-ProtagonistInnen. Allerdings begegnen sie hier einem William Shakespeare, den es in die Neue Welt verschlagen hat. Und dem fallen im Verlauf der Jahre nicht nur mysteriöserweise die Haare aus (für die Cherokee ein Phänomen!), er will auch etwas den Cherokee gänzlich Unbekanntes machen: ein Stück aufführen. Begeistert wollen alle akta in seinem plei werden - und so landet der bald vor dem Nervenzusammenbruch stehende Spearshaker (die Möglichkeiten, einen Namen pantomimisch darzustellen, sind begrenzt ...) mit seinem "Hamlet" einen Riesenerfolg. Wenn auch nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie er sich's vorgestellt hat.
Alternative Welten und Eingriffe in den Verlauf der Geschichte sind ein weiteres Schwerpunktthema: In "Sitka" kommt es zur unseligen Begegnung von Lenin und Jack London, die einen etwas anderen, aber nicht minder schrecklichen Ersten Weltkrieg auslösen, in "Billy Mitchell's Overt Act" wiederum vereitelt der gleichnamige US-General den Überraschungsangriff auf Pearl Harbour - mit weitreichenden und nicht unbedingt positiven Folgen für die Weltpolitik. Diese Geschichte ist auch stilistisch bemerkenswert, weil in Form eines Mosaiks von Zeitzeugen-Zitaten geschrieben; versteckt darunter sogar zwei authentische, viel Glück bei der Suche! General Douglas MacArthur als tragischer Heldentor ("Not Fade Away") und Napoleon als Herrscher des Kaiserreichs Louisiana ("Empire") vervollständigen das alternative Historien-Kabinett. Und daran zeigt sich auch ein weiterer Grundzug von Sanders' Geschichten: Mehr oder weniger ehrenwerte Männer bei der Erfüllung ihrer - oft blutigen - Pflicht: Sei es der glücklose US-General, sei es der Reservatspolizist Davis Blackbear im oben genannten "World on Fire" - oder der Leiter einer Luftbrigade, die Passagierflugzeuge gegen die Attacken von "Engel" genannten Kreaturen verteidigt ("Angel Kills"): Bewusst wird dabei der Hintergrund der Angriffe ausgespart und der Fokus ausschließlich auf das Verhalten von Menschen im Stress des Krieges gerichtet. Nicht umsonst weist Autorenkollege Richard Bowes, der ebenfalls ein Vorwort zu der Sammlung beigesteuert hat, darauf hin, dass Sanders ein großer Bewunderer von Ernest Hemingway ist - mit "Amba" ist sogar eine astreine Hemingway-Hommage enthalten.
Keine Zweifel über das Geschehen aufkommen lassende Klarheit, trockener Humor und gelegentliche Kraftmeiereien ergeben einen auf sehr positive Weise männlichen Stil. Die gewählten Szenarien können dabei ebenso düster wie komisch sein: In "He Did The Flatline Boogie And He Boogied On Down The Line" engagiert ein Blues-Musiker einen Dealer für die Suche nach einem Mädchen, das von Necrodone abhängig ist: einer synthetischen Droge, die den zeitlich befristeten klinischen Tod hervorruft. Die Geschichte ist dreckig, morbide - und ausgesprochen gut. Ebenso wie das in einer ähnlichen Nahzukunft spielende aber genial komische "Looking for Rhonda Honda", einer klassischen Detektivgeschichte inklusive geheimnisvoller Unbekannter, die in die Agentur des public investigators Johnny Noir(!) gestöckelt kommt. Als hätte der mit seiner gendergemorphten Ex-Frau, die jetzt als Wrestler Mad Marvin auftritt, nicht schon genug Probleme, muss Noir es auch noch mit mörderischen Motorradbräuten aufnehmen. Mit Knalleffekt am Schluss!
Selten - und dann gar nicht so schlecht - steht eine Frau im Mittelpunkt. Im beklemmenden "Creatures" besucht Erzählerin Alison eine Cocktail-Party von Unsterblichen, auf der die Gastgeberin Exemplare seltener Spezies präsentiert; als Hauptattraktion sogar eine alte Frau, die The Process nicht durchlaufen hat und sterblich geblieben ist. Nur am Rande erfährt man, dass der Großteil der Erdbevölkerung einst für The Process einen unmenschlichen Preis bezahlen musste - umso schrecklicher, als dies für die Erzählerin keinerlei Rolle spielt, da sie die ganze Zeit über nur daran denkt, wie sie die verhasste Gastgeberin übertrumpfen kann. - Abschließend sei noch "At Ten Wolfe Lake" erwähnt, in dem Sanders aus der Warte eines Bigfoot - pardon: Hominid American - so manchen Eiertanz der Political Correctness gnadenlos verarscht. Gallig wägt der als Frachtpilot in Alaska arbeitende Bigfoot ab, ob Dynamit oder doch Passagiere die schlimmere Ladung seien: Well, at least they wouldn't explode. On the other hand dynamite doesn't get airsick. Or want to talk. - Nicht umsonst heißt es in einer am Einband zitierten Rezension: Sanders is witty, caustic, clever, cynical, and not very PC at all. Eindeutige Leseempfehlung!
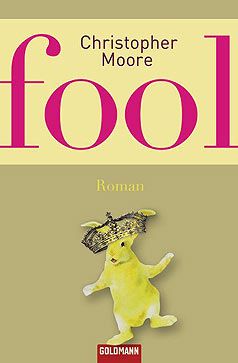
Christopher Moore: "Fool"
Broschiert, 351 Seiten, € 15,40, Goldmann 2009.
Hatte William Shakespeare bei Sanders noch einen kurzen Direktauftritt, dann setzt es hier einen indirekten, aber dafür umso längeren: Denn das neueste Buch des spätestens seit "Die Bibel nach Biff" auch hierzulande beliebten US-Autors Christopher Moore ist nichts anderes als eine Verarsche von Skakespeare's "König Lear". Ein Stück, das seinerseits auf alten Sagen basiert und mit dem haarsträubenden Plot vom König, der sein Erbe unter dem Gesichtspunkt verteilt, welche seiner Töchter ihm die glühendste Liebeserklärung macht, geradezu ein gefundenes Fressen für Moore darstellte. "Neuestes" Buch ist übrigens nicht übertrieben - "Fool" ist auch im Original erst 2009 erschienen.
Dieses ist ein derber Schwank, randvoll mit entbehrlichem Beischlaf, Mord, allerlei Maulschellen, Verrat und einem ehedem ungeahnten Maß an Geschmacklosigkeit und Profanität, stellt Moore seinem Roman als "Warnung" voraus. Und übertreibt damit keineswegs: Schon nach wenigen Seiten haben sämtliche flüssigen, gasförmigen und feststofflichen Absonderungen, die der menschliche Körper zu erbringen vermag, Erwähnung gefunden - und werden auch in der Folge prominenten Platz einnehmen. François Rabelais hätte an "Fool" seine helle Freude gehabt.
Wie schon bei "Biff" arbeitet Moore mit dem Trick, eine große Geschichte aus neuer Perspektive zu beleuchten, in diesem Fall aus der des königlichen Hofnarren. Bei Shakespeare bloß eine Nebenfigur, durfte er dem König immerhin seine Meinung über dessen absurden Liebeswettbewerb und dessen Folgen kundtun. Moore baut diesen Ansatz aus und macht den Narren zum allesdurchschauenden und mehr und mehr auch -steuernden Dreh- und Angelpunkt der Ereignisse. Pocket heißt der stets schwarz gekleidete Narr hier, nachdem er als Waisenkind vor einem Kloster abgelegt wurde und die Nonnen den Zwergwüchsigen in beuteltierhafter Liebe in ihren Taschen herumtrugen. Seine ersten sexuellen Eskapaden erlebte er ebendort mit einer eingemauerten Eremitin - zotenhafte Erinnerungen, an die sich noch viele weitere anschließen werden (dass sämtliche drei Königstöchter dem unansehnlichen Narren immer wieder verfallen, zieht sich als Running Gag durchs ganze Buch, lässt aber auch irgendwie an die Wunschvorstellung eines Autors in seinen 50ern denken ...). Und so hätte es auch weitergehen können, hätte Lear mit seiner Wahnsinnsidee nicht den beiden verlogenen Schwestern Regan und Goneril die Macht überlassen und just die gutherzige und von Pocket verehrte Cordelia (die sich später aber als durchaus Eiserne Lady entpuppen wird) ins Exil getrieben. Grund genug für Pocket an sämtlichen verfügbaren Strippen zu ziehen und ein ebenso blutiges wie schmuddeliges Intrigenspiel in Gang zu setzen. Vom bequemen Leben zu Hofe mitten in die Action katapultiert, zieht er als Agent im Dienste der guten Sache durchs nasskalte Britannien. Wäre er bloß nicht so saugfähig ...
Bewusst gesetzte Anachronismen und zeitgenössische Anspielungen sind ebenso enthalten wie zwanglose Entnahmen aus anderen Stücken - darunter die hier Kräuternamen tragenden drei Hexen aus "Macbeth" oder ein Geist, der die Nerven Pockets mit orakelhaften Weissagungen strapaziert - denn ohne Geist geht's nicht. Moore versuchte dabei Jahrhunderte überspannende Varianten des Englischen zu einem Amalgam zu verschmelzen, das jeden Übersetzer vor Probleme stellen muss. Mangels Übertragbarkeit kann daher auch nicht jeder Gag zünden (speziell die Fußnoten kann man anders als bei Terry Pratchett großteils vergessen) - bleiben aber immer noch genug im Lauftext über. Im Original gleichermaßen wie auf Deutsch kann Pockets atemberaubende Schimpfkanonade - wie jeder auffällige Stil - natürlich mit der Zeit zu einem gewissen Abnützungseffekt führen; gänzlich unabhängig davon, ob man sonderlich etepetete eingestellt ist (derart gehandikappte LeserInnen hätten aber ohnehin schon nach wenigen Seiten kreischend die Flucht ergriffen). Ob man "Fool" also als das empfindet, was gerne als "tolldreister Streich" bezeichnet wird, oder ob einen das orale, anale & vaginale Dauerfeuer mit der Zeit etwas ermüdet, hängt ganz vom persönlichen Geschmack ab.

Arthur C. Clarke & Gentry Lee: "Die nächste Begegnung"
Broschiert, 635 Seiten, € 8,20, Bastei Lübbe 2009.
Der Urahn dieses Romans, das 1973 erschienene "Rendezvous with Rama", war vor gut einem Jahr der Startschuss dieser Rubrik. 1989 griff Arthur C. Clarke die Idee noch einmal auf und entwickelte daraus gemeinsam mit dem NASA-Mann Gentry Lee einen Mehrteiler, der sich sowohl in der Grundausrichtung wie auch in der Qualität deutlich vom Original unterscheidet. Die erste Folge dieser Serie, "Rama II" (1989; im Jänner bei Lübbe als "Rendezvous mit Übermorgen" erschienen), ist deshalb zwar anders als das ursprüngliche "Rendezvous". Sie weist aber doch genug Parallelen in der Handlung auf (wieder erscheint ein außerirdischer Riesenzylinder im Sonnensystem, wieder wird er von einem Missionsteam erkundet), dass wir sie an dieser Stelle überspringen können und an der Stelle einsteigen, an der sich gänzlich Neues tut.
Drei Mitglieder des Expeditionskorps sind an Bord des "Rama"-Zylinders zurück geblieben, als dieser uneinholbar aus dem Sonnensystem verschwindet: Das Ehepaar Nicole und Richard Wakefield und ihr Freund Michael O'Toole. Noch sind es drei, denn Nicole gebiert im Lauf der Reise nicht weniger als fünf Kinder - und die sich daraus ergebenden Herausforderungen bestimmen über die erste Hälfte des Romans hinweg die Handlung von "Die nächste Begegnung" ("Garden of Rama"), das damit im Prinzip ein Familienroman ist, der im All spielt. Was für manche nicht sonderlich aufregend klingen mag, aber immerhin eine klare Linie hat.
... welche in der zweiten Hälfte verloren geht, als die Wakefields - nachdem sie eine Raumstation der niemals selbst in Erscheinung tretenden Ramaner im Sirius-System erreicht haben - mehr oder weniger postwendend zurückgeschickt werden. Nun sollen sie 2.000 Menschen anwerben, um den Zylinder zu besiedeln - tatsächlich lockt die aus Angst vor den überlegenen Aliens kooperierende Erdregierung Emigrationswillige mit dem falschen Versprechen einer Mars-Kolonisierung ins Ungewisse. Erstaunlicherweise nehmen die Geprellten den Betrug aber ähnlich widerstandslos hin wie zuvor die Wakefields das jahrelange Ausgeliefertsein an die Wünsche und Pläne der Ramaner. Unwahrscheinlich scheint das auch deshalb, weil die KolonistInnen ansonsten keine braven Schäfchen sind: In Rekordkürze entwickelt die New Eden getaufte Rama-Kolonie soziale Ungleichgewichte und allerlei unappetitliche Begleiterscheinungen. Den beiden Autoren ging es offensichtlich darum, die menschliche Gesellschaft anhand eines Modells im Kleinformat zu beschreiben und zu kritisieren - inklusive Problemen wie Klimawandel und dem Auftreten eines durch Blut und Sperma verbreiteten Retrovirus, das zu Schwulenfeindlichkeit und Ghettoisierung führt ... Ein ehrbares schriftstellerisches Vorhaben, wenn auch in der Durchführung etwas plakativ geraten.
Für den Handlungsbogen ist der Wechsel bei ProtagonistInnen und Themenschwerpunkten ungünstig: Nachdem der Roman ohnehin mittendrin abbrechen wird ("Cliffhanger" wäre zuviel gesagt), wäre es vielleicht besser gewesen, Teil 1 mit der Hälfte von Teil 2 (bis zur Rückkehr der Wakefields ins Sonnensystem) in einem herauszugeben und die zweite Hälfte an den folgenden dritten Teil "Rama Revealed" ("Nodus"; soll noch heuer erscheinen) anzuflanschen. Denn die Hauptfiguren, an die man sich bis dahin gewöhnt hat, werden plötzlich über weite Strecken an den Rand gedrängt, statt dessen strömt eine Vielzahl neuer Charaktere mitsamt all ihren Problemen, Konflikten und in Erinnerungsflashes geschilderten Vorgeschichten nach - da braucht es schon einige Bereitwilligkeit, sich weiter auf die Figuren einzulassen. - Mangelnde Plausibilität, eine doch ziemlich unausgewogene Entwicklung der Handlung und dazu einige Schlampigkeiten bei der Übersetzung (speziell über die notorisch zur Buchstabenvertauschung neigenden Eigennamen wäre besser noch mal ein Korrekturprogramm drübergegangen): "Die Nächste Begegnung" ist eine in Relation zum Umfang kostengünstige Ergänzung für die Arthur C. Clarke-Sammlung, Glanzlicht ist es keines.
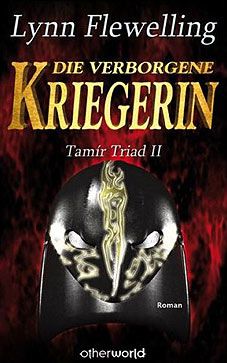
Lynn Flewelling: "Die verborgene Kriegerin (Tamír Triad II)"
Broschiert, 608 Seiten, € 16,40, Otherworld 2009.
Das ist jetzt eine wirkliche Premiere: Denn wie schon in der Rezension zu Teil 1 von Lynn Flewellings "Tamír Triad" ("Der verwunschene Zwilling") erwähnt, brach der Bastei-Verlag die erste deutschsprachige Ausgabe der gefeierten Trilogie vor dem Erscheinen von Teil 2 ab. Otherworld gibt die "Tamír Triad" in vollem Umfang heraus, endlich lässt sich also auch auf Deutsch lesen, was mit Tobin weiter geschieht: Jenes Mädchen, dem durch einen blutigen Zauber der Körper eines Jungen gegeben wurde, um sie vor der Ermordung durch einen König zu retten, der die wichtigste Tradition des Königreichs Skala missachtet: Solange eine Tochter der Linie des Thelátimos über das Reich herrscht und es verteidigt, wird Skala niemals unterjocht werden, lautet ein alter Orakelspruch. Zugunsten seines Sohnes Korin ließ der Usurpator-König Erius alle legitimen Anwärterinnen auf den Thron ermorden (Teil 2 wird allerdings zeigen, dass Erius nicht der alleinige Herr seiner Machtpolitik ist ...); nun ist Tobin die letzte Hoffnung auf Erfüllung des Spruchs. Und längst zeigen Seuchenausbrüche und ein heraufdämmernder Krieg, dass die Götter Skala nicht mehr gewogen sind.
Am Ende von Teil 1 musste der Zauber erneuert werden, da Tobin inzwischen in die Pubertät gekommen ist. Er weiß nun darüber Bescheid, dass in seinem männlichen Körper eine weibliche Identität darauf wartet, ans Licht kommen zu dürfen. Einige persönliche Verwirrungen hat dies gelöst - leichter ist sein Leben (denn noch empfindet Tobin sich als er) dadurch aber nicht geworden. War es vorher noch die Scham darüber sich für Mädchenspielzeug zu interessieren, so hat er jetzt mit seinen wachsenden Gefühlen für seinen Knappen und besten Freund Ki zu ringen. Überdies gerät er in einen starken Loyalitätskonflikt gegenüber dem jetzigen Thronerben Korin: Einerseits ist er ihm durch Treueeid und ehrliche Freundschaft verbunden - andererseits weiß Tobin, dass er Korins Thronanspruch dereinst zunichtemachen muss, wenn er als künftige Königin seine Bestimmung erfüllen soll. Immer noch sinnt der Geist von Tobins Bruder, dessen Tod das magische Ritual zum Geschlechterwechsel überhaupt erst ermöglicht hat, auf Rache an allen Beteiligten. Und einer davon, der Zauberer Arkoniel, hat am Ende von Teil 1 weitere Lasten auf seine Seele gelegt: Um Tobins Tarnung zu wahren, hätte er Ki töten müssen - doch blieb sein Angriff halbherzig; nun fühlt er sich als Verräter an Ki und an seiner Pflicht gleichermaßen.
... das alles mag nach einer allzu heftigen Anhäufung von Schuld und Scham klingen, selbst für einen stark auf die Psychologie der Hauptfiguren fokussierenden Roman - und Teil 1 nahm mit dem vermeintlichen Tod Kis in der Tat Züge einer griechischen Tragödie an. Doch ist die komplexe emotionale Gemengelage direkte Folge einer einzigen Entscheidung (eben Tobins "Verwandlung"), Flewelling hat somit einen vollkommen stimmigen Plot entworfen und folgerichtig weiterentwickelt. - Und keine Angst, auch die Action kommt nicht zu kurz: Zwar ist "Die verborgene Kriegerin" ("Hidden Warrior") primär eine Coming-of-Age-Geschichte unter gendermäßig erschwerten Bedingungen - doch steigt Flewelling gegen Ende hin ordentlich aufs Gaspedal: Intrigen, Invasion und Schlachtengetümmel werfen das zuvor eher bedächtige Voranschreiten der Handlung über den Haufen - und letztlich geschehen sogar einige Dinge, die man sich vielleicht erst im abschließenden Teil der Trilogie erwartet hätte. Inklusive des vermutlich einzigen Mals in der Fantasy-Geschichte, dass jemand den Aufruf zur Schlacht an die versammelten Getreuen mit den Worten einleitet: "Ich habe euch etwas Merkwürdiges mitzuteilen ..."
... doch noch sind längst nicht alle losen Fäden aufgesammelt. Der abschließende Teil 3, "Die prophezeite Königin" ("The Oracle's Queen") wird Ende Sommer erscheinen.

Kai Meyer: "Die Sturmkönige", Teil 1 + 2: "Dschinnland" und "Wunschkrieg"
Gebundene Ausgaben, jeweils 428 Seiten, € 18,50 bzw. 19,50, Lübbe 2008/2009.
Teil 2 von Kai Meyers "Sturmkönige"-Trilogie, "Wunschkrieg", ist im Frühling erschienen, baut aber so unmittelbar auf Teil 1 ("Dschinnland") auf, dass die Ereignisse für NeueinsteigerInnen besser noch einmal kurz rekapituliert werden: Wir befinden uns in der Zeit des Kalifats von Harun al-Raschid, und seit einem Ausbruch der Wilden Magie vor gut einem halben Jahrhundert ist zwischen Persien und Zentralasien nichts mehr, wie es war. Armeen von Dschinnen (genau denen, die man sich darunter vorstellt, abzüglich der Lampe) haben einen Vernichtungskrieg gegen die Menschheit geführt; Samarkand und Bagdad konnten sich als letzte belagerte Inseln halten, rings um sie ist das Land entvölkert. Aus Samarkand macht sich der ehemalige Schmuggler Tarik al-Jamal mit der schwer durchschaubaren Sabatea nach Bagdad auf. Unterwegs treffen sie auf den Dschinnfürsten Amaryllis, der eine wichtige Rolle in Tariks Vergangenheit spielte, und begegnen erstmals den Sturmkönigen: Menschen, die auf Wirbelstürmen reiten und sich als einzige der Macht der Dschinne entgegenstellen.
Meyer vermischt Elemente aus "1001 Nacht" und eigene Ideen zu einem in jeder Beziehung bunten Gesamtbild: Im Himmel über Bagdad kreisen Schwärme von fliegenden Teppichen (Tarik seinerseits ist ein begnadeter Teppichreiter und nimmt an illegalen Rennen teil), zwischen den Dächern verstecken sich mechanische Elfenbeinpferde mit Pegasus-Schwingen. Durch die Straßen kriechen Silberschlangen und geben verzweifelten Menschen falschen Rat - und draußen in der Wüste stößt man auf noch viel ungewöhnlichere Wesen ... sogar ein paar letzte Ifrits, die gute, Wunsch-erfüllende Variante der Dschinne. - "Bunt" ist die neue Trilogie des Lübecker Autors aber auch in dem Sinne, dass Farbbeschreibungen eine große Rolle spielen: Die Szenen sind in satte Töne von Ocker, Violett und Blutrot getaucht - ein bisschen wähnt man sich wie in einem Zeichentrickfilm der alten Prä-3-D-Schule, und das ist kein unangenehmes Gefühl. Soziokulturelle Tiefendetails spielen in einem solchen Technicolor-Orient erwartungsgemäß keine Rolle - an Religion beispielsweise zeigen Meyers ProtagonistInnen ebensowenig Interesse wie er selbst; da kann auch schon mal einem Muslim ein "Herrje!" entschlüpfen.
... was aber keine Rolle spielt, da das mythische Morgenland der "Sturmkönige" ohnehin nur die exotische Kulisse für die verschlungenen Pfade der Charaktere bildet, die wie oft bei Meyer einen sehr modernen Eindruck machen. Tarik, obwohl der Held der Geschichte, ist aufbrausend und gewaltbereit und kann ausgesprochen rücksichtslos agieren - ebenso wie Sabatea, die zur Durchsetzung ihrer Geheimpläne ihre Mitreisenden gekonnt manipuliert und gegeneinander ausspielt (und nichtsdestotrotz ebenso wie Tarik dabei durchaus sympathisch bleibt). Zwischen Tarik und seinem Bruder Junis hat sich ein komplexes Gebräu aus Schuld, Scham und Rivalität angesammelt - und generell ist das vorherrschende Gefühl zwischen allen Beteiligten Misstrauen. - Spannung beziehen die "Sturmkönige" daher ebensosehr aus der Frage, was die Hauptfiguren antreibt und wie sie sich angesichts der drohenden Gefahren zusammenraufen werden, wie aus der straight erzählten Action, vor allem den atemberaubenden Luftkämpfen, die Dschinne, Sturmkönige und Teppichreiter einander liefern.
Achtung Spoiler-Grenze - wer Teil 1 noch lesen möchte, sollte an dieser Stelle zum nächsten Bild weiterklicken. Am Ende von Teil 1 haben die Reisegefährten nicht nur Bagdad erreicht, sondern auch einige Überraschungen zu verdauen. Sabatea, die von ihrem machtlüsternen Vater dazu erpresst wird, den Kalifen von Bagdad zu ermorden, trifft auf ein schwermütig gewordenes Opfer, das sich den Tod sogar wünscht. Tarik wurde vom sterbenden Dschinnfürsten ein Stück von dessen Substanz einverpflanzt, mit dem er die Welt so sieht wie Amaryllis: Ohne Dschinne, ohne jegliche Magie. Von Sabatea getrennt, schlägt sich Tarik durch die Unterwelt Bagdads und lernt dabei neue schillernde Figuren wie den kindlichen Koloss Nachtgesicht und dessen kratzbürstige Schwester Ifranji kennen. Außerdem musste Tarik zur Kenntnis nehmen, dass seine einstmals von Amaryllis entführte Geliebte Maryam nicht nur überlebt hat, sondern sogar die Sturmkönige anführt: Die von der holden Angebeteten zur skrupellosen Kämpferin Gewandelte stößt in Teil 2 in den Kreis der Hauptfiguren vor.
"Wunschkrieg" ist im Vergleich zum linearen Vorgänger etwas statischer ausgefallen - man bewegt sich sowohl geografisch als auch handlungsbezogen eher kreuz und quer als auf einer klar vorgegebenen Linie: im Grunde typisch für den Mittelteil einer Trilogie, bei dem es meistens darum geht, die Ausgangslage für den Abschluss, der alle Handlungsfäden zusammenführt, vorzubereiten. Zum Beispiel durch eine Große Eröffnung - und die erfolgt hier durch den Hofmagier Khalis und hat es für einen Fantasy-Roman wirklich in sich, Hut ab vor dieser Idee (und auch vor den ProtagonistInnen, die die welterschütternde Erkenntnis bemerkenswert cool wegstecken). Und so allmählich, nach neu geschlossenen Bündnissen und überraschenden Todesfällen, wird sich eine spannungsverheißend heterogen zusammengewürfelte Gemeinschaft herauskristallisieren, die sich auf eine alles entscheidende Reise begeben muss. "Glutsand", der abschließende Teil 3, erscheint im September.
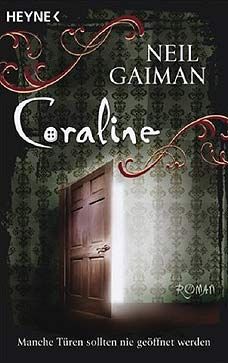
Neil Gaiman: "Coraline"
Broschiert, 175 Seiten, € 8,20, Heyne 2009.
Mit dem Wort "Märchen" muss man vorsichtig umgehen, weil viele damit automatisch Assoziationen wie "niedlich" oder "kitschig" verbinden - was die Furcht erzeugenden Aspekte von Märchen gänzlich ausklammert. Die Atmosphäre von "Coraline", das Star-Autor Neil Gaiman 2002, also zwischen seinen Erfolgsromanen "American Gods" und "Anansi Boys", veröffentlicht hat, lässt sich am besten auf einem Umweg beschreiben: Die Novelle wurde inzwischen als Stop-Motion-Abenteurer von Henry Selick verfilmt - jenem Regisseur, der schon Tim Burtons "Nightmare Before Christmas" in Szene gesetzt hat.
Im Mittelpunkt steht das Mädchen Coraline - zu seinem Leidwesen von seiner Umwelt meist "Caroline" genannt, eine für das Folgende durchaus symbolische Vertauschung -, das mit seinen Eltern in ein neues Haus gezogen ist. Stubenhockerei ist Coralines Sache nicht; als sie von Nachbarinnen ermahnt wird, einen gefährlichen Brunnenschacht im Garten zu meiden, reagiert sie auf die einzig folgerichtige Weise: Also zog Coraline los, um ihn zu erkunden, damit sie wusste, wo er war, und sich auch ordentlich von ihm fern halten konnte. Auf ihren Entdeckungszügen durchs neue Eigenheim gerät sie auch an eine geheimnisvolle blinde Tür, hinter der nur eine Backsteinwand zu sein scheint. Doch für Coraline wird sie sich zu einem "Alice hinter den Spiegeln"-artigen Szenario öffnen - einem Ebenbild des Hauses, in dem sie von ihren anderen Eltern freudig willkommen geheißen wird. Eine gute Sache im Prinzip, immerhin haben Coralines wirkliche Eltern kaum Zeit für sie ... hätten die Spiegelbildeltern bloß nicht Knöpfe statt Augen und würde hinter der Freundlichkeit ihrer anderen Mutter nicht beständig etwas Lauerndes aufblitzen. Also besser zurück nach Hause.
Als aber Coralines wirkliche Eltern verschwinden, sieht sie sich genötigt in das surreale Haus zurückzukehren, dessen latent bedrohliche Atmosphäre immer gefährlichere Züge annimmt. Intelligente Ratten und noch unheimlichere Wesen bewegen sich durch die Räume, in denen irgendwo Coralines Eltern versteckt sein müssen. Und immer mehr schält sich heraus, dass die andere Mutter die zentrale Figur zu sein scheint, während die Spiegelbildwelt rundherum allmählich an Konturen verliert und zu einem Nichts zusammenschrumpft. "Ein Spinnennetz muss nur gerade so groß sein, dass man Fliegen darin fangen kann", wird Coraline von einem wertvollen Helfer erklärt - denn auch solche findet sie auf der anderen Seite, und Angsterzeugung hin oder her: eigentlich müssten Märchen doch auch immer ein glückliches Ende haben, oder?
"Coraline" wird dem Alter der Protagonistin entsprechend in kurzen, einfachen Sätzen erzählt, was Gaimans Begabung in Sachen Stil und schwarzem Humor aber keineswegs schmälert. Gaimans Werken im Bereich "Young-adult fiction" zugerechnet, ist die Novelle für keine bestimmte Altersgruppe geschrieben - Kindern dürfte sie allerdings zu unheimlich sein. Zum ersten Mal auf Deutsch ist sie 2003 im Arena Verlag herausgegeben worden - und dort ist Anfang diesen Jahres auch Gaimans vielgelobtes "The Graveyard Book" (schlicht als "Das Graveyard-Buch") erschienen: ebenfalls empfehlenswert.

Greg Bear: "Die Stadt am Ende der Zeit"
Broschiert, 895 Seiten, € 16,50, Heyne 2009.
Nach und nach hatten sie gemerkt, dass dieses Buch völlig anders war als die Geschichten, die die Alten dem Nachwuchs erzählten, denn die begannen stets in der Mitte, in einem gefährlichen Augenblick, und führten erst nach weiteren Abenteuern zum Anfang, der erklärte, was all diese Abenteuer zu bedeuten hatten. - Also ungefähr so wie in diesem Buch hier, auch wenn am Ende nicht alle dieser Erklärungen einleuchten und viele offene Fragen zurückbleiben werden. - US-Starautor Greg Bear, den viele wohl eher mit Romanen an der Schnittstelle von Science Fiction und Wissenschaftsthriller ("Blutmusik", "Das Darwin-Virus") assoziieren, war in der Vergangenheit der Fantasy nicht ganz abgeneigt. Und die lugt auch in "Die Stadt am Ende der Zeit" in verschiedenster Weise um die Ecke - dass das Buch paradoxerweise auch der Hard SF zugerechnet werden könnte, liegt daran, dass Bear sich darin mit spekulativ ausgerichteten physikalischen Konzepten wie der Retrokausalität oder der Viele-Welten-Theorie befasst. Was nicht nur den Plot des Romans bestimmt, sondern auch die Erzählstruktur.
Grob gesagt zerfällt das Buch - bis zu einer Verschmelzung ziemlich genau ab der Romanmitte - in zwei zeitliche Ebenen. Eine davon ist das Seattle der Gegenwart, die andere die fernste Zukunft. In 100 Billionen Jahren hat das Universum seine Expansionsphase längst hinter sich, nun breitet sich zwischen den Resten seiner extrem ausgedünnten Substanz etwas gefährliches Neues aus: Seit Äonen löst der Typhon - in etwa das Chaos an sich verkörpernd - das Raum-Zeit-Gefüge auf. Als letzte Insel der Existenz hat sich die Kalpa genannte Stadt auf der guten alten Erde gehalten; eine Stadt, in der Körperliches und Imaginäres verschmelzen (und die einem, nicht überraschend, auch nie so ganz plastisch vorstellbar wird). Von Realitätsgeneratoren geschützt, existieren hier Wesen wie die quasi-virtuellen Eidola, die die höchstmögliche Stufe der menschlichen Evolution erreicht haben, aber auch Hominiden wie Jebrassy und Tiadba, Nachgezüchtete der alten Art. Sie werden ihrer altertümlichen Fähigkeiten wegen gebraucht, dem bevorstehenden Ende von Raum und Zeit entgegen zu wirken - und auch, um einen Weg in eine mögliche weitere Überlebensinsel zu finden.
Im Vergleich zu diesem recht abstrakt wirkenden "Schauplatz" bietet die Gegenwartsebene aber nur vermeintlich leichtere Nachvollziehbarkeit - bei der Vorstellung der ProtagonistInnen gewinnt man zunächst nämlich den Eindruck, es fehlte einem das Vorwissen aus einem (nicht existierenden) Teil 1; zumindest dafür wird es später aber eine Erklärung geben. Jack, Ginny und Daniel haben, zunächst ohne voneinander zu wissen, die Fähigkeit, ihre Weltlinie zu verlassen und fast nach Belieben auf eine für sie günstigere Parallelwelt zu wechseln. Zwei von ihnen haben überdies geistige Aussetzer, während derer sie als Träumer in Verbindung mit Jebrassy und Tiadba in der Zukunft stehen. Sie stellen zunehmend merkwürdige Veränderungen in ihrem Umfeld fest (etwa das Auftauchen mythologischer Tiere) und sind auf der Flucht vor Glücksjägern wie Max Glaucous, die im Auftrag metaphysischer Wesen nach Schicksalswandlern wie ihnen suchen: per Annonce oder auch mit handgreiflicheren Mitteln. Sie treffen zusammen, als die Auflösung der Zukunft - Stichwort Retrokausalität - rückwirkend an die Gegenwart heranjagt und die unendlich vielen Weltlinien möglicher Entwicklungen sich der Null nähern. - Einmal kurz über den Kamm geschoren könnte man auch sagen, dass Bear ein Personenensemble à la Clive Barker durch ein Stephen-Baxter-Szenario vom Ende von Raum und Zeit hetzt und das auf eine Weise schildert, die ansatzweise an Hal Duncans "Vellum" erinnert. Das ist nicht der leichte Sushi-Gang zwischendurch.
Im öffentlichen Echo auf Bears Roman klingt Begeisterung ebenso an wie bittere Enttäuschung und Frust; immerhin ist er fast 900 Seiten lang und dabei durchaus anstrengend. Nichtlinearität und Aufsplitterung in einander überlappende Ebenen fordern aufmerksames Lesen - zudem spielt Bear mit verschiedenen Dichotomien wie der von Wahrnehmung und Realität oder der von Substanz und Information (das Motiv vom Buch als eigene Welt, die andere Welten nicht nur beschreibt, sondern auch beinflusst oder gar erschafft, zieht sich durch den ganzen Roman). Mythologische Verweise sind durchaus passend für ein Gebiet an der Grenze von Physik und Philosophie, in dem auch WissenschafterInnen mitunter auf Entsprechendes zurückgreifen. Zu altgriechischen Entitäten wie Mnemosyne oder Typhon gesellen sich dabei mit der Kalpa, Kali, den Devas oder Shiva freundliche Übernahmen aus dem Hinduismus, dessen Götterhimmel mit seiner Unzahl von Manifestationen und unterschiedlichen Teilaspekten von Meta-Persönlichkeiten wie maßgeschneidert für's Thema wirkt; immerhin haben hier auch die Avatare des virtuellen Zeitalters ihren Wortursprung. - Insgesamt eine recht gewagte Verquickung wissenschaftlicher und mythologischer Elemente also, die aber über weite Strecken aufgeht. Besser jedenfalls als die Schilderung des Chaos, das immerhin über einige hundert Seiten hinweg die Kulisse abgibt: Kein neues Problem, denkt man etwa an Jack Chalkers "Soul Rider"-Zyklus oder Stuart Gordons "One-Eye"/"Two-Eyes"/"Three-Eyes", die ebenfalls ein dem Kosmos entgegengesetztes (Nicht-)Ordnungsprinzip, das unsere Wahrnehmung zerstört, zu beschreiben versuchten. Entweder bleibt dies unbefriedigend (weil doch nicht so chaotisch) - oder das Geschehen ist beim Lesen nicht mehr nachvollziehbar. "Die Stadt am Ende der Zeit" spielt zwar auf einem deutlich höheren Komplexitätslevel als diese auf Action bedachten Romane, zeigt aber genau dieselben beiden Effekte - mal so, mal so.
Eine Schwäche ist die wenig plastische Zeichnung der Charaktere, die mit Ausnahme des zwielichtigen Max Glaucous allesamt blass bis austauschbar wirken - immerhin hat Bear einen Roman geschrieben, kein Essay über die Viele-Welten-Theorie. Die Personifizierung physikalischer Vorgänge wird gegen Ende hin (zu) weit getrieben - und Katzen im Gegensatz zu ihren Mit-Tieren übernatürliche Fähigkeiten anzudichten ist in der Regel ein untrügliches Anzeichen für verquaste Gedankengänge (außer natürlich in der Fantasy, wo das Übernatürliche Teil der Prämisse und damit bloß Normalität auf anderem Niveau ist). Am schwersten wiegen allerdings eindeutige Inkonsistenzen in der Beschreibung zentraler Vorgänge wie dem Weltlinienwechseln oder der Traumverbindung (mal scheinen die ProtagonistInnen die Körper mit ihren zukünftigen Pendants zu tauschen, mal führen sie als zwei Geister in einem Kopf Zwiegespräche) - es ist schwer den Überblick zu wahren, wenn sich einem immer wieder der Eindruck aufdrängt, Bear hätte ihn selbst nicht mehr so ganz gehabt.
Genial konstruiertes Werk oder die Strandung eines Autors in der Orientierungslosigkeit? Das muss jede(r) für sich selbst entscheiden - gewarnt sei nur vor allen veröffentlichten Meinungen über "Die Stadt am Ende der Zeit", die für sich reklamieren die richtige Interpretation parat zu halten. Es könnte sich dabei durchaus um einen Fall von Selbsttäuschung handeln.
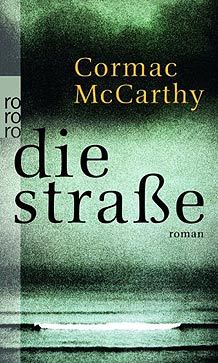
Cormac McCarthy: "Die Straße"
Broschiert, 252 Seiten, € 9,20, rororo 2008.
Nachdem es in dieser Rundschau bereits einige Weltuntergangsszenarien gab, sei hier noch einer der diesbezüglich besten Romane der letzten Jahre nachgereicht. Cormac McCarthys Pulitzer-preisgekröntes Werk "The Road" ist dazu angetan die Legionen an postapokalyptischen Romanen bis auf den innersten Kern zu reduzieren - und der ist pure Menschlichkeit. Die eigentliche Handlung ist daher rasch zusammengefasst: Ein Vater und sein Sohn - immer nur der Mann und der Junge genannt, Namen werden wir nie erfahren - schieben einen Einkaufswagen mit ihren wenigen Habseligkeiten eine Straße entlang nach Süden. Das Land, irgendwo im Osten der USA, ist verbrannt, die Sonne hinter einem Schleier verborgen, Schnee und Ascheregen sind seit Jahren ihre einzigen Begleiter.
Was genau passiert ist, wird nur angedeutet: Von einer Lichtklinge am Himmel, die die Uhren zum Stehen brachte, ist in einem Erinnerungssplitter kurz die Rede, von Erschütterungen und einem rosigen Schimmer im Fenster - mehr nicht, und es spielt auch keinerlei Rolle. Wichtig ist nur, was übrig geblieben ist - nichts. Nie mehr ist eine lange Zeit. Aber der Junge wusste, was er wusste. Dass nie mehr im Handumdrehen passiert war. So sehr sind die beiden auf das Nichts zurückgeworfen, dass ihnen ein schneefreies Plätzchen unter einer toten Zeder als "kostbar" erscheint - und als sie zwischendurch einen vergrabenen Bunker mit Lebensmitteln und Decken finden, kann der Junge nur ungläubig fragen: "Ist das echt?"
Der vielfach ausgezeichnete US-Autor Cormac McCarthy überzeugt in "Die Straße" einmal mehr mit detailgenauen Beobachtungen und stimmigen Bildern: Etwa wenn er Vater und Sohn im Regen stehend wie Tiere auf einem Bauernhof beschreibt oder sie in den Städten nur noch mumifizierte Tote mit nackten Füßen finden lässt - deren Schuhe haben in den Jahren nach der Katastrophe längst andere herumirrende Überlebende an sich genommen. In kurzen, fast mantra-artig wirkenden, Frage-Antwort-Dialogen wiederholen die beiden fortwährend die Worte des jeweils anderen, als wollten sie sich damit ihrer Existenz versichern. Besonders bedrückend dabei, dass eine so durch und durch vertraute Situation wie ein Kind, das seinem Vater Fragen stellt, hier die gleiche ist, wie sie Eltern jeden Tag erleben. Nur die Fragen sind andere: "Wir sind die Guten, oder?" "Wir würden nie jemanden essen?" Oder einfach nur: "Werden wir sterben?"
Was die beiden immer weiter gehen lässt, ist die kleine Hoffnung, dass sie anderswo vielleicht die Chance zu überleben haben - der Leser wird dies kaum noch mit ihnen teilen können: Außer anderen Menschen - die meisten davon zu Kannibalen geworden - finden sie auf ihrem gesamten Weg mit Ausnahme einer Morchel, die sie ausgraben und essen, kein einziges Lebewesen: Alle Pflanzen sind verkohlt, der Strand von Millionen Fischskeletten gesäumt, am Himmel sind keine Vögel zu sehen, die Flüsse sind tot. Einmal spekuliert der Mann vage über "Tiefseekraken", die es noch geben könnte ... es ist einer der wenigen Momente, in denen er über die unmittelbare Situation hinauszudenken wagt. Ein wirkliches Ziel der Reise scheint es angesichts des Todes des gesamten irdischen Bioms nicht zu geben. Erst gegen Ende wird erstmals die Idee ausgesprochen, andere Menschen - Gute - zu finden. Diese Hoffnung mag nüchtern betrachtet vollkommen sinnlos sein - ist aber zugleich berechtigt und gut, denn außer einander haben die Überlebenden nichts mehr.
Dieses Buch steht am Ende, weil danach nichts mehr kommen kann - nach einem Monat zum Atemschöpfen wird es dann mit etwas leichterer Kost weitergehen. Unter anderem von Sergej Lukianenko und Neal Asher - und, damit's nicht zu leicht wird, einem Philip K. Dick-Schnäppchen.
(Josefson)