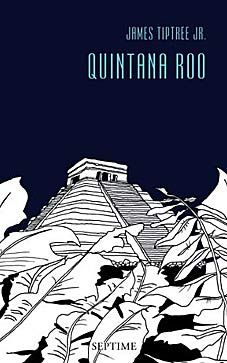
James Tiptree Jr.: "Quintana Roo"
Gebundene Ausgabe, 160 Seiten, € 18,90, Septime 2011.
Das neben der großen Strugatzki-Werkausgabe schönste Reissue-Projekt dieser Tage ist die Wiederveröffentlichung der Werke von James Tiptree Jr., der wohl besten Kurzgeschichten-Autorin, die die Science Fiction jemals vorzuweisen hatte. Richtig, -in. Dass Frauen unter männlichem Pseudonym schrieben, war vor dem großen Triumphzug diverser SF-Autorinnen in den 70ern nicht so ungewöhnlich - aber nie davor und nie danach sollte die Geschlechterverwirrung derartige Ausmaße annehmen wie im Fall der US-Amerikanerin Alice Bradley Sheldon. Korrespondenz nur über ein Postfach abzuwickeln und sich von den für Vernetzung und Popularität so wichtigen SF-Cons fernzuhalten, bescherte der Science Fiction ihren eigenen Thomas-Pynchon-Mythos. Und der hätte sich niemals derart auswachsen können, wären Sheldons Erzählungen nicht so spektakulär gut und neuartig gewesen: Da traf genaue Psychologisierung der Figuren auf einen kraftvollen Stil, da wurden Geschichten aus ungeahnten Blickwinkeln erzählt, sei es aus der Warte fremdartiger - wirklich fremdartiger - Wesen, durch eine Umkehrung der zeitlichen Kausalität oder durch Perspektivenwechsel, die das Gelesene im letzten Moment in ein völlig neues Licht rückten. Da wurde unbeschwert mit sexuellen Tabus gebrochen, da trafen knallige Ideen aus dem Genre-Fundus auf Metaphysik und eine unverkennbare Faszination für den Tod.
Als das Pseudonym "James Tiptree Jr." 1977, ein Jahrzehnt nach den ersten Veröffentlichungen, endlich offiziell gelüftet wurde, war es eine doppelte Überraschung: Selbst diejenigen, die im Zuge des jahrelangen Rätselratens die These, Tiptree könnte auch eine Frau sein, zumindest für möglich gehalten hatten, hätten nicht damit gerechnet, dass sie es nicht mit einer Jungen Wilden, sondern mit einer honorigen Dame in ihren 60ern zu tun hatten; von Beruf Psychologin. Wer die Bücher aus dieser Zeit zuhause hat, kann sich dem diebischen Vergnügen hingeben, den Ablauf der Tiptree-Debatte zeitversetzt nachzuerleben. Bei den ersten ins Deutsche übersetzten Werken ist noch ganz selbstverständlich von einem Mann die Rede. Richtig unterhaltsam wird es aber mit der Geschichtensammlung "Warme Welten und andere", die 1981 auf Deutsch herauskam, als Tiptrees wahre Identität bereits bekannt war - während das englischsprachige Original noch kurz vor der Enthüllung erschienen war, als immerhin schon diverse Gerüchte kursierten. Im Vorwort nahm der große Robert Silverberg dazu Stellung - und Wolfgang Jeschke, Herausgeber der deutschen Ausgabe, druckte dieses "aus historischen Gründen" (erkenne ich da einen Anflug von Schadenfreude?) mit ab. Silverberg darin: "Auch wurde gemutmaßt, Tiptree sei eine Frau. Diese Theorie finde ich absurd; denn Tiptrees Geschichten haben für mich etwas unverkennbar Maskulines." - Tja, manchmal hast du kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu.
Der Sammelband "Tales of the Quintana Roo" ist im Original 1986 erschienen und umfasste neben einer Vorbemerkung der Autorin drei Kurzgeschichten, die im gleichnamigen Bundesstaat Mexikos angesiedelt sind ... aufmerksamen LeserInnen des Wissenschaftsressorts wird er als die Region in Erinnerung sein, in der in jüngster Zeit mehrfach Skelette von Menschen des Eiszeitalters aus Unterwasserhöhlen geborgen wurden. Für Tiptree spielte allerdings eine sehr viel spätere Kultur die Hauptrolle: Nämlich die der Maya, deren Spuren auch in unserer Zeit noch nicht restlos verschwunden sind. Zwei winzige - und für die Handlung völlig bedeutungslose - Details der ersten Erzählung, "Was die See bei Lirios anspülte" ("What Came Ashore at Lirios"), verorten sie in der nahen Zukunft; ein mögliches Zugeständnis der Autorin an ihre SF-LeserInnengemeinde, das nur von denen gefunden wird, die danach suchen. Genre-Grenzen sind in "Quintana Roo" aber nicht das Thema. Nicht von ungefähr beginnt der österreichische Septime-Verlag seine Tiptree-Reihe mit diesem, im Inneren als "Band 5" gekennzeichneten, Werk. LeserInnen, die mit Phantastik nichts am Hut zu haben glauben, können so auf sanfte Weise an das Werk einer Frau herangeführt werden, die in erster Linie eine große Autorin war ... das Attribut große SF-Autorin ergibt sich gleichsam nebenher.
In den drei vorliegenden Geschichten verband Tiptree das, was heute als "Magic Realism" bezeichnet wird (im Nachwort verweist Tiptree-Kennerin Anne Koenen auf die lange Tradition des Magischen Realismus in der lateinamerikanischen Literatur), mit der Erzählweise, in der westliche Spukgeschichten vor 100 Jahren gerne erzählt wurden: Der Protagonist begegnet einem Fremden, der ihm etwas Unerhörtes berichtet. In "Hinter dem toten Riff" ("Beyond the Dead Reef") ist dies ein zugereister Bürger Belizes, der sich seine Erschütterung über eine beängstigende Begegnung unter Wasser aus dem Kopf zu spülen versucht, in "Der Junge, der auf Wasserskiern in die Ewigkeit fuhr" ("The Boy Who Waterskied to Forever"; Tiptree war nebenbei bemerkt auch stets meisterlich in der Titelgebung - siehe etwa "Your Faces, O My Sisters! Your Faces Filled of Light!", "Your Haploid Heart" oder "Her Smoke Rose Up Forever") schlüpft der Kapitän eines Fischerboots in diese Rolle. In "Was die See bei Lirios anspülte" schließlich ist es ein junger "Gringo", der halbverdurstet an der Küste auftaucht und ebenso in Quintana Roo gestrandet ist wie der ältliche Ich-Erzähler der Geschichte, der in seinem Kabäuschen lebt und das Meer als seinen Supermarkt betrachtet, oder der eigentümlich anziehende androgyne Schiffbrüchige, dem der junge Mann begegnet sein will. Alle drei sind also Erzählungen aus zweiter Hand, in denen sich mythologische Bezüge und Seemannsgarn frei entspinnen können. Einmal räumt der Ich-Erzähler, der in allen drei Episoden derselbe sein könnte, ein: Mein Informant stellt natürlich keine vertrauenswürdige Quelle dar.
Obwohl "Quintana Roo" eindeutig keine Science Fiction ist, finden Tiptree-Fans hier viele vertraute Elemente wieder: Das Aufeinandertreffen verschiedener Denkweisen (vor allem zwischen Maya-Nachfahren und US-AmerikanerInnen) oder auch die Gender-Thematik. Die Beobachtung einer Fischart, die das Geschlecht wechseln kann, verleitet den Ich-Erzähler zum Gedanken: Man stelle sich einmal unsere Welt vor, wenn alle erwachsenen Männer, all die O. J. Simpsons und Walter Cronkites und Leonid Breschnews, als kleine Mädchen und junge Mütter angefangen hätten. Ich verkniff mir gerade noch rechtzeitig das Lachen, sonst wäre ich ertrunken. Auch das Motiv der Vergänglichkeit ist hier so stark vertreten wie bei Tiptree seit eh und je - besonders in der ersten Erzählung ist die Todessehnsucht unverkennbar. Quintana Roo gibt dazu den stimmigen Hintergrund ab: Die lange Zeit weitgehend unberührte Region vermittelt einen Eindruck von Zeitlosigkeit, verstärkt durch das unerwartete Eindringen der Vergangenheit in die Gegenwart - etwa wenn der Wasserskifahrer auf eine längst versunkene Maya-Stadt zuhält, die sich plötzlich wieder in voller Pracht zeigt. Doch auch dieses zeitlose Land kann sich einer historischen Entwicklung nicht entziehen, denn die westliche Zivilisation ist in Form von Müll und Touristen auf dem Vormarsch. Die letzte Erzählung zeigt, dass diese Bedrohung nicht unbeantwortet bleiben könnte: Tiptree schildert hier die ersten Vorboten eines "Rache der Natur"-Motivs, zugleich ein kleiner Vorgeschmack auf die Untergangsszenarien, die sie in anderen Erzählungen entwarf.
Eine davon, das preisgekrönte "The Screwfly Solution", wird Teil der nächsten Tranche sein, die im Juni erscheinen soll; begleitet von der endlich ins Deutsche übersetzten Biografie "James Tiptree Jr. - Das Doppelleben der Alice B. Sheldon" von Julie Phillips, die dafür den "Hugo" erhielt. Ganz große Empfehlung!
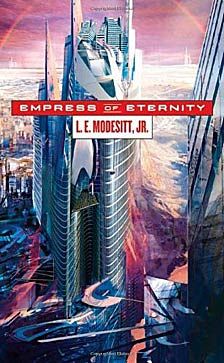
L. E. Modesitt, Jr.: "Empress of Eternity"
Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, Tor Books 2010.
US-Autor Leland Exton Modesitt, Jr. dürfte im deutschsprachigen Raum, wo seine vielteilige "Saga of Recluce" erschienen ist, hauptsächlich als Verfasser von Fantasyromanen bekannt sein. Doch hat der 67-Jährige auch schon eine ganze Reihe von Science-Fiction-Romanen unterschiedlichster Couleur geschrieben - sein jüngstes Werk, der BDO-Roman "Empress of Eternity", wagt sich sogar auf das Gebiet der Hard SF vor. Und bereits der Prolog, in dem die Erde von kosmischen Gezeitenkräften geschüttelt wird und eine Gigatechnologie sich dem herabstürzenden Mond entgegenstemmt, ruft hinaus: Gonna be big! Und lässt damit auf ein ähnliches Spektakel wie Robert Charles Wilsons "Spin" hoffen.
Das BDO vulgo "Big Dumb Object" ist im konkreten Fall ein zweitausend Kilometer langer Kanal, der sich seit Menschengedenken - wir befinden uns in ferner Zukunft - quer durch den "Mittelkontinent" zieht; Erbauer unbekannt. Designed to outlive eternity itself, wie es an einer Stelle heißt, besteht der Kanal aus einem unbekannten Material, das sich weder anmessen noch zerstören lässt; selbst plattentektonische Bewegungen lassen die schnurgerade verlaufende Struktur unberührt. Im Roman wird der Kanal zur wissenschaftlichen Herausforderung für drei menschliche Zivilisationen, die voneinander jeweils durch hunderttausende von Jahren getrennt sind. Seine größten Stärken hat "Empress of Eternity", wenn es darum geht ein Gefühl dafür hervorzurufen, welch immense Zeiträume zwischen den drei Kulturen (und irgendwann davor der unseren) verstrichen sind. So groß sind diese, dass am Strand nanotechnologische Fossilien angespült werden oder schon mal ein Satz wie "What about terraforming Mars again?" fällt. Ähnlich wie in Alastair Reynolds' "Haus der Sonnen" türmen sich hier Hochzivilisationen auf den nahezu vergessenen Resten anderer, technologisch gleich- oder sogar höherstehender Kulturen. Doch trotz der enormen Intervalle sind alle drei geschilderten Kulturen direkt miteinander verbunden - jede badet in ihrem Zeitalter die Klimapfuschereien ihrer Vorgängerin aus. Da der Kanal - ohnehin eine einzige gigantische Projektionsfläche für menschliche Wünsche - auch keinerlei Temperaturschwankungen unterliegt, wird er zum Hoffnungsträger für die Rettung des Weltklimas. Dieses ist in der Ära der Unity of Caelaarn, als man den einstigen Mond nur noch als Selene Ring kennt, durch eine Eiszeit bedroht, in der späteren Hu-Ruche Technocracy durch globale Desertifikation und in der am weitesten in der Zukunft liegenden Vaniran Hegemony wiederum durch eine Eiszeit.
In einem Gespräch zweier Caelaarn-Politiker fällt ein Satz, der für die gesamte Struktur des Romans ausschlaggebend ist: "There are only so much patterns. It's only the young or the arrogant that think there's much new in the world ... and they're the ones who most often repeat those patterns." Modesitt lässt in der Tat nichts aus, um das Motiv der Muster-Wiederholung zu unterstreichen: Alle drei Zeitebenen stellen ein am Kanal lebendes Mann-Frau-Duo in den Vordergrund (dies in allen drei möglichen Konstellationen geschlechtsspezifischer Machtverhältnisse), alle drei Kulturen befinden sich zudem in einer gewaltsamen Umbruchphase. In der auf biologische Forschung konzentrierten Caelaarn-Kultur drückt sich dies noch relativ zivilisiert in Form ministerieller Intrigen und einiger Polit-Morde aus, während die Putschisten der Hu-Ruche-Zeit mit Bomben und auch schon mal einem Meteoriten werfen. Mit Kanonen auf Spatzen zu schießen erlangt aber eine gänzlich neue Dimension, wenn Abtrünnige der Vanir-Hegemonie eine Waffe entwickeln, die Einfluss auf die Dunkle Energie bzw. Dunkle Materie (so genau geht dies nicht hervor) nimmt und bei wiederholtem Einsatz das Universum selbst zerstören würde. Wie schon gesagt: Gonna be big ...
Eine derart starke Betonung von Konzept und Konstruktion lastet natürlich auf den Hauptfiguren, auf deren Namensnennung hier daher getrost verzichtet werden kann - "Empress of Eternity" wirkt etwas abstrakt und hat LeserInnen, die Wert auf die menschliche Seite legen, nicht gar so viel zu bieten. Wäre man ein wenig boshaft, könnte man außerdem sagen, dass sich noch ein weiteres Muster auf allen drei Handlungsebenen wiederholt, denn jede hat so ihre Abstriche vom optimalen Leseerlebnis. In Caelaarn sind dies trockene Memoranden und Zwiegespräche über ministerielle Budgets, während in der Technokratie von Hu-Ruche jeglicher Individualismus verpönt ist und auf eine entpersonalisierte Weise kommuniziert wird, die an Programmiersprachen erinnert - durchaus mühsam zu lesen. In den Abschnitten um die Vanir schließlich kommt etwas ganz anderes zum Vorschein, nämlich Fantasy-artige Elemente und sogar eine Anmutung von Pulp. Da werden High-Tech-Waffen geschwungen, die wie Äxte aussehen, und Helme mit Hörnern getragen - und es gibt Ortsbezeichnungen namens Asgard und Midgard. Wenn eine Sprenggranate ausgerechnet mit einem Mistelzweig garniert wird, mag sich ein Asen-Fan an die Legende um den Gott Baldur erinnert fühlen, der gegen alle Materialien der Welt geschützt wurde, nur nicht gegen die unscheinbare Mistel ... und so mit einem Mistelzweig ermordet wird. Die Vanir-Gegnerin, die diese Spezialgranate aufs Haupt bekommt, heißt übrigens Baeldura ...
... später wird eine Erklärung nachgeschoben, derzufolge große Ereignisse ihre Echos auch in die Vergangenheit entsenden, so rum geht's natürlich auch. Ohnehin zeichnet sich bald ab, dass bei der Ergründung des wahren Wesens des Kanals die Zeitdimension eine zentrale Rolle spielen wird und dass sich die drei Handlungsebenen ganz ähnlich wie bei der "Gestern, Heute, Morgen"-Abschiedsfolge von "Star Trek: Next Generation" an einem gemeinsamen Punkt verknüpfen werden. Leichte Kost ist es nicht, wenn Modesitt sein gewähltes Modell der Zeit in die Handlung einbringt: "With event-point separation along continuity, energy differentials do build, and it takes more and more energy ... but the nature of the event-point penetration limits what the Bridge can do, in direct relation to the event-point separation from the event-point locale of the keeper." (Und jetzt alle den Satz fünfmal schnell hintereinander mitsprechen!) In krassem Gegensatz dazu werden die ethischen Aspekte erstaunlich simplifiziert: Ungeachtet der völlig unterschiedlichen politischen Ausgangslagen in den drei Zeitebenen werden die GegnerInnen der jeweiligen Hauptfiguren stets zu den "Kräften der Negation".
Alles in allem hinterlässt "Empress of Eternity" eine gemischte Bilanz. Es vermag an vielen Stellen zu beeindrucken oder gar zu begeistern, geht aber auch so manchen seltsamen Weg (vergleichbar etwa mit Greg Bears "Die Stadt am Ende der Zeit") und vergibt Chancen. Lesenswert, aber kein "Spin".

Preisfrage: Welche zwei Eigenschaften teilen obige Fantasyromane? 1) Sie alle brachten auf ganz unterschiedliche Weise ein Element der Originalität ins Genre ein. 2) Sie alle sind die deutschsprachigen Endpunkte von Reihen, deren weitere Teile nicht mehr übersetzt wurden.
In seiner aktuellen Besprechung von Peter S. Beagles Anthologie "The Secret History of Fantasy" geht der angesehene Phantastik-Rezensent Paul Kincaid recht streng mit einem Werk um, das der eigentlich lobenswerten Aufgabe gewidmet ist, Genre-Klischees entgegenzuwirken und aufzuzeigen, welche inhaltliche Vielfalt unter dem Schlagwort "Fantasy" möglich wäre. Mission nicht erfüllt, so lautet in etwa Kincaids Resümee. Und zeigt damit einmal mehr auf, auf welchem Niveau sich eine Diskussion über das gerne geschmähte Genre Fantasy bewegen könnte, wenn man sich erst mal von den zwei schlimmsten Stereotypen "Zwergenschwertgeschwinge und Vampirgeknutsche" gelöst hat (so hat's ein Mitarbeiter eines großen deutschen Phantastik-Verlags mir gegenüber ausgedrückt, und ich hätte keinen besseren Begriff für das finden können, was alles inhaltlich anders Geartete in den Phantastikregalen der Buchhandlungen an den Rand gedrückt hat).
Die Knutschsauger als legitime Erben von Bergdoktoren und Traumschiffstewards mal außer Acht gelassen und mit dem schröcklichen Begriff "Romantasy" ohnehin bereits quasi-offiziell abgegrenzt, wird Fantasy im deutschsprachigen Raum gerne mit High Fantasy und Heroic Fantasy gleichgesetzt. Was schade ist, weil es die inhaltliche Bandbreite extrem reduziert. Und denen in die Karten spielt, die "Fantasy" als Schimpfwort verwenden (ohne jemals auf die Idee zu kommen, dass auch "Star Wars" Fantasy ist). Schnell ist da auch das Totschlag-Argument vom Tolkien-Epigonentum zur Hand, was zahl- und fantasielose AutorInnen mit ihren "Völkerromanen" zugegebenermaßen auch selbst befeuern. Dabei wäre es gar keine so schlechte Strategie Tolkien nachzuahmen - nur läge der Schlüssel vielleicht nicht darin, seine Ideen zu übernehmen, sondern sein Konzept Ideen zu haben. Was immer noch nicht heißt, dass neue Ideen automatisch zu einem rauschenden Leseerlebnis führen müssen. Robin Hobbs "Nevare"-Reihe hatte einen sehr originellen Zugang zum altbekannten Coming-of-Age-Plot ... bloß sind mir beim Lesen vor Langeweile die Füße eingeschlafen (ich habe zwei Zehen an Robin Hobb verloren!). Aber mit dem Risiko muss schließlich jedes Buch leben, egal aus welchem Genre. Und es gibt ja auch nichts, was einen Roman vor dem doppelten Übel schützen könnte, unoriginell und langweilig zu sein.
AutorInnen machen sich allerdings auch nicht zwangsläufig beliebt, wenn sie Ideen einbringen, die noch nicht vielhundertfach abgesichert wurden. Fallbeispiel "Glühender Stahl" von Richard Morgan, ein Action-lastiges Stück Heroic Fantasy mit allem Drum und Dran inklusive altbewährten Handlungsmustern. Bloß ist die Hauptfigur schwul. Und nicht etwa nur per Mitgliedskarte, er lebt es auch aus, sprich: hat Sex. Schockschwerenot. Da gibt es dann Leute, die sich allen Ernstes öffentlich darüber empören, dass sie in Umschlag- und Klappentext nicht vorgewarnt wurden, mit so etwas konfrontiert zu werden. Naja, auf Seite 11 trägt selbiger Held ein Lederwams, auf Seite 72 isst er ein Stück Fleisch - spätestens hier schiene auch ein Warnhinweis für VeganerInnen zwingend notwendig. Vielleicht sollte man generell Bücher mit einem Aufkleber versehen: "Vorsicht! Dieses Objekt könnte neue Ideen beinhalten. Bitte bleiben Sie auf zwei Armlängen Abstand."
So ein System würde auch deshalb Sinn machen, weil bei weitem nicht jedes Buch auf diese Weise gebrandmarkt werden müsste. Nehmen wir Alexey Pehovs "Chroniken von Siala", die diesen Frühling in die dritte Runde gehen und deren erster Teil, "Schattenwanderer," in den Kaufseitenforen durch die Bank gelobt wurde - unter anderem, weil hier mit althergebrachten Vorstellungen aufgeräumt würde. Ich habe "Schattenwanderer" gelesen und kann seine Originalität bestätigen: Die Zwerge haben hier keine Bärte - so unterscheidet man sie nämlich von den Gnomen. Bescheidenheit ist eine lobenswerte Eigenschaft, aber hier hat sich eine Spirale der Anspruchssenkung in Gang gesetzt, die beiderseits - von LeserInnen wie Verlagen - angeschubst wird und allmählich das Gefühl für Verhältnismäßigkeit entschwinden lässt. Wobei den Verlagen bei genauerer Betrachtung nicht der Hauptteil der Verantwortung anzulasten ist. Das sind Wirtschaftsunternehmen, und die verkaufen eben, was sich verkaufen lässt. Obige Beispiele und wagemutige Experimente von Kleinverlagen zeigen, dass man's zumindest immer wieder mal versucht - finden sich nicht genug KäuferInnen, kann man halt nüscht machen.
Auch nicht zu vernachlässigen: der Faktor Quantität. Ich muss zugeben, dass meine Hemmschwelle vor einem neuen Buch ziemlich genau mit dessen Seitenzahl korreliert. Wenn ich ein Buch angehe, bei dem ich von vorneherein weiß, dass seine Handlung trotz "Buddenbrooks"-artigen Umfangs nicht zum Abschluss gebracht wird, braucht's schon einen gut begründeten Anreiz, das durchaus zeitaufwändige Projekt überhaupt zu starten. Als Brandon Sanderson 2005 "Elantris" veröffentlichte, konnte sich kaum ein Rezensent einen Ausdruck der Verwunderung darüber verkneifen, dass hier mal ein Fantasy-Autor einen Einzelroman geschrieben hat - in einem Genre, in dem Trilogien oder besser Nochmehrteilogien längst obligatorisch geworden sind. Schön, Verlage möchten Erfolgsformeln gerne wiederholt angewendet sehen, und LeserInnen werden eine liebgewonnene Welt - siehe das Format TV-Serie - gerne wieder und immer wieder besuchen. Aber warum muss jeder einzelne Teil davon auch noch Überlänge haben? Hängt die angestrebte "epische Wirkung" wirklich so sehr von der Quantität ab - oder braucht es womöglich eine immer größere Seitenzahl, bis eine "neue" fiktive Welt so fest in den Köpfen der LeserInnen etabliert ist, dass etwaige Erinnerungen an ältere - und teils verblüffend ähnliche - Welten endlich erfolgreich verwischt werden konnten?
Inzwischen dürfte es den einen oder anderen Fantasy-Fan schon in den Fingern jucken, aber bevor jemand seine Tastatur vandalisiert, möchte ich an dieser Stelle einbauen, dass ich gerne Fantasy lese. Auch High Fantasy und Heroic Fantasy. Ich habe nur nicht das Bedürfnis, einander ähnelnde Plots mit leidlich geänderten Namen zweimal, dreimal, viermal zu lesen. Jedenfalls nicht in kurzen Abständen hintereinander. Kurze Gegenprobe aus der Science Fiction: Hier wird auch nicht jeden Monat ein Buch vorgestellt, in dem die reptilischen Klerrgh oder insektoiden Tzzzeh oder polypenartigen Qwemmsh aus dem Weltraum eine Invasion der Erde starten - ein Plot, der durchaus vergleichbar wäre mit einem Teenager (nennen wir ihn Ged oder Harry Potter oder Luke Skywalker), der seine magische Begabung entdeckt und damit das Abendland rettet, oder einer wie auch immer gearteten (aber auf jeden Fall dunklen) Bedrohung, die aus dem tausendjährigen Urlaub zurückkehrt. Alle drei sind respektable Plots - aber wie jeder andere auch nutzen sie sich bei zu häufigem Gebrauch ab und benötigen etwas Zeit, bis man sich - oder zumindest ich mich - ihnen wieder widmen will. Hier setzt mit Sicherheit erneut der Fingerjuckreiz ein, diesmal um alle möglichen Gegenbeispiele zu posten. Natürlich gibt's die und nur zu, her damit! Lesetipps kann es nie genug geben.
Womit wir uns einem entscheidenden Punkt angenähert haben, nämlich der Frage, wie man ein potenziell lohnendes Buch identifiziert. Vor dem Hintergrund der oben genannten Seitenzahl-Hemmschwelle ist es nicht sonderlich hilfreich, wenn ich Verlagsprogramme der kommenden Saison durchblättere und dabei auf die obligatorischen Hinweise à la "Für Fans von Trudi Canavan" oder "Für Fans von Robert Jordan" stoße. Generell scheinen diese Hinweise eher darauf angelegt zu sein, Gemeinsamkeiten mit bereits bekannten Werken zu betonen, als das hervorzuheben, was der Neuerscheinung ihren individuellen Charakter verleiht. Wer solche Kataloge noch nie zu Gesicht bekommen hat, kann den Effekt durch das Lesen von Klappentexten nachvollziehen. Die sind oft noch stärker bemüht, jede Abweichung vom Formelhaften zu nivellieren, und werden dem Buch damit im schlimmsten Fall nicht einmal gerecht. Terry Pratchett hat es einmal angesichts der Flut von Fantasy-Titeln auf einer Buchmesse sehr schön auf den Punkt gebracht: "Es waren auch gute Bücher darunter, aber wie sollte man sie erkennen?" Oder in den Worten der alten Phantastik-Expertin Tina Turner: "We don't need another hero!"
Die folgenden zwei Seiten zeigen zwei Auswege aus dem Dilemma, die abseits von Glückstreffern immer gangbar sind. Weg 1 - mögen ihn manche auch für unoriginell halten - ist die (Wieder-)Vorstellung eines Werks, das seine Qualität bereits unter Beweis gestellt hat und anlässlich einer Neuausgabe noch einmal empfohlen werden kann. Damit endet dieses Intermezzo und es geht weiter mit der nächsten Buchvorstellung.
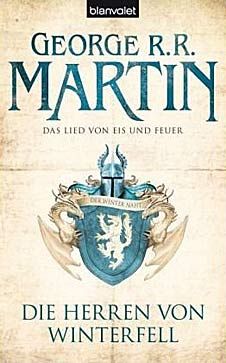
George R. R. Martin: "Die Herren von Winterfell"
Kartoniert, 571 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2010.
Es gibt eine Website, deren Adresse mir leider entfallen ist, auf der die Handlung monumentaler Epen in kürzestmöglicher Weise zusammengefasst wird - beim "Herrn der Ringe" lief das in etwa auf "großer Wirbel um verlorenes Schmuckstück" hinaus. In Ermangelung eines Talents zu derart begnadeter Verkürzung will ich mal wenigstens versuchen, das Gerüst des ersten (halben) Bandes aus George R. R. Martins ebenso gigantischer wie herausragend guter Saga "Das Lied von Eis und Feuer", das nun bei Blanvalet in eine zweite Editionsrunde geht, zu skizzieren:
Westeros ist der Name eines langgestreckten Inselkontinents, der im Lauf der Jahrtausende in mehreren Wellen vom riesigen Ostkontinent her besiedelt wurde. Auch wenn die unabhängigen Königreiche von Westeros vor einigen Jahrhunderten von der jüngsten Welle an Neuankömmlingen unter eine gemeinsame Herrschaft gepresst wurden, bleibt die Basis des scheinbar stabilen Feudalsystems also recht heterogen; ein erster Ansatzpunkt für künftige Konflikte. Die Eroberer-Dynastie wurde vor knapp zwei Jahrzehnten gestürzt und nun beruft der aktuelle König seinen Jugendfreund Eddard Stark, Herr über die nördliche Domäne Winterfell, als Berater an seinen Hof. Im ungeliebten, aber auch unablehnbaren Job als "Rechte Hand" des Königs findet sich der pragmatisch eingestellte Eddard im höfischen Intrigenspiel wieder und muss es zudem hinnehmen, dass seine Familie durch den Umzug auseinandergerissen wird. Die Starks sind es auch, die diesen ersten Band der Saga prägen, der trotz beachtlicher Länge aber nur die erste Hälfte des Originalromans "A Game of Thrones" darstellt. Auch in der Neuausgabe erscheinen die Romane auf Deutsch jeweils zweigeteilt - vier hat Martin bislang geschrieben, der fünfte ist seit Jahren in Arbeit und entwickelt sich langsam selbst zum Mythos.
Geradlinig im Stil, doch opulent in der Ausgestaltung (sichtbar in der komplexen Historie und dem umfangreichen Personal, was zu einem entsprechend langen Appendix geführt hat), zeigt sich die Größe des "Lieds von Eis und Feuer" darin, wie geschickt Martin Handlungselemente, die in Fantasy-Romanen erwartet oder gar gefordert werden, zum Teil bringt, zum Teil aber auch auslässt. So mangelt es in der Stark-Familie nicht an prototypischen jugendlichen Identifikationsfiguren wie dem jungen Bran oder Eddards unehelichem "Bastardsohn" Jon: Ein durch und durch gutherziger Charakter, der stets das Richtige tut, auch wenn ihm seine Abstammung die volle Anerkennung immer verwehren wird. Und nicht zu vergessen das Mädchen Arya, das laut seiner Amme die Hände eines Schmieds hat und sich im Gegensatz zur älteren Schwester Sansa so gar nicht für die Rolle der künftigen Hofdame eignen will - statt dessen lernt der sympathische kleine Wildfang fechten. - Doch spätestens wenn Bran zufällig ein Komplott belauscht und schon früh im Buch aus dem Fenster gestürzt wird, hat Martin ein Zeichen gesetzt, dass die Dinge hier nicht in absehbaren Bahnen verlaufen müssen. In weiterer Folge - das schon ein Vorgriff auf spätere Bände - können sich hier noch rein positiv besetzte Figuren in durchaus andere Richtungen entwickeln und zu einer Neubewertung zwingen; ebenso wie die, die jetzt noch als die klaren Schurken dastehen.
Der aus New Jersey stammende Martin hat sich im Lauf seiner mittlerweile 35 Jahre währenden Schriftstellerkarriere als ausgesprochener Freigeist erwiesen und Erzählungen in nahezu allen Teilbereichen der Phantastik veröffentlicht - in dieser Rubrik war er zum ersten Mal mit seiner grandiosen Geschichtensammlung um den interstellaren Handlungsreisenden Haviland Tuf ("Tuf Voyaging"; hier die Nachlese) vertreten. Dementsprechend hat er wenig für eingefahrene Genre-Regeln übrig. Von zentraler Bedeutung für "Das Lied von Eis und Feuer" ist der Verzicht auf ein in der Fantasy gerne verwendetes, aber keineswegs zwingend notwendiges Motiv: nämlich das des vom Schicksal Auserwählten, den eine uralte Prophezeiung vorhergesagt hat. Durch diesen Verzicht verschwindet ein großes Spannungslosigkeitselement (wie viele vom Schicksal Auserwählte haben ihre Prophezeiung eigentlich nicht erfüllt?), viel wichtiger ist aber die Auswirkung, die dies auf die Gesamtheit der ProtagonistInnen hat. Diese werden nun nämlich nicht auf ihre Funktion für die Hauptfigur reduziert, sondern haben ein eigenes Leben, eigene Wünsche, Pläne und Fehler ... und sorgen damit für Überraschungen. So scheint Eddards Frau Catelyn zunächst nur im Trauerwahn am Sterbebett ihrs Sohnes zu vergehen. Dann jedoch wird sie aktiv und startet eine Mission, die so manchen - Freund wie Feind - in die Bredouille bringt.
Anstelle des Zusteuerns auf ein vorhersehbares (und vorhergesagtes) Ziel steht also eine Familiensaga mit psychologisch genauer Charakterisierung. Von Kapitel zu Kapitel wechselt die Perspektive, und keine davon vermag das gesamte Bild zu überblicken, das sich zu einer Art Historienroman zusammensetzt, in dem nicht der Kampf von Gut gegen Böse, sondern Realpolitik Trumpf ist: Besonders deutlich zu sehen am Geschwisterpaar Daenerys und Viserys, den ins östliche Exil geflohenen letzten Nachkommen der gestürzten Dynastie. Der verhinderte Thronerbe Viserys strebt mit allen Mitteln nach Rache, zwingt seine minderjährige Schwester in die Ehe mit einem Nomadenherrscher und erklärt ihr unverblümt: "Ich würde dich von seinem ganzen Khalasar ficken lassen, wenn es sein müsste, süßes Schwesterchen, von allen vierzigtausend Mann, und von ihren Pferden auch, wenn ich dafür meine Armee bekäme." Allmählich wird aber klar, dass Viserys nur ein armes Würstchen ist, und das geschwisterliche Machtverhältnis wird sich schon bald dramatisch verschieben.
Bleiben noch zwei beliebte Fantasy-Elemente: "Völker" und Magie. Erstere sind in "Die Herren von Winterfell" nicht vorhanden, die Welt ist nur von Menschen besiedelt ... auch wenn niemand genau weiß, was hinter der Mauer liegt, die Westeros im Norden gegen die Anderen schützen soll: Ein Bollwerk in den Ausmaßen des Grenzwalls aus dem aktuellen Film "Monsters", das aber leider zunehmend vernachlässigt wird. Und auch Magie respektive das Übernatürliche spielt in diesem Roman keine Rolle, wenn man von ein paar kleineren Ausnahmen absieht. Nicht von ungefähr steht eine dieser Ausnahmen allerdings an exponierter Stelle: Im Prolog gerät eine Patrouille jenseits der Mauer an jemanden, der eindeutig nicht aus dem Diesseits stammt. Auch das hat Signalwirkung: In den weiteren Bänden (der nächste erscheint im März) wird sich das Auftauchen des Übernatürlichen sukzessive ausweiten, bis hin zum Kampf von Göttern und universalen Prinzipien. - Doch noch ist es nicht soweit. In "Die Herren von Winterfell" setzen sich die Dinge erst allmählich in Bewegung. Und selbst wer die Saga nicht kennt, erahnt schon jetzt, dass sich alle Beteiligten noch in die Zeit zurücksehnen werden, als ein paar politische Morde das schlimmste ihrer Probleme waren ... - Episch, aber nicht epigonal: Etwas Schöneres kann man über einen Fantasyroman nicht sagen!
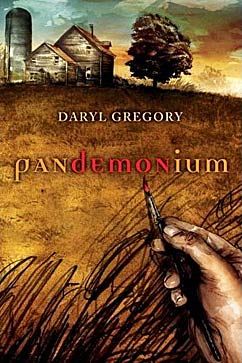
Daryl Gregory: "Pandemonium"
Broschiert, 304 Seiten, Del Rey 2008.
Der zweite Ausweg aus dem auf der vorherigen Seite genannten Dilemma ist der, der Peter S. Beagle wie auch Paul Kincaid vorgeschwebt hat: Nämlich den Begriff "Fantasy" möglichst weitgesteckt zu definieren. Vorhang auf für den US-Amerikaner Daryl Gregory, dessen Debütroman sich in keinerlei Schublade stopfen lässt: Magic Realism? Alternativweltroman? Psychologischer Thriller? Mystery? Von allem ein bisschen, nichts davon eindeutig. "Pandemonium" ist auch deshalb ein besonders gutes Beispiel, weil es mit Archetypen arbeitet - etwas, das weniger kreative AutorInnen durchaus als Entschuldigung dafür nehmen, Altbekanntes in ebenso altbekannter Form zu servieren. Gregory hingegen demonstriert in hinreißender Form, wie man aus lauter bekannten Zutaten etwas vollkommen Neues backen kann.
Seit dem Zweiten Weltkrieg sind "Dämonen" Teil des Alltags, doch handelt es sich dabei um keine Invasion höllischer Kreaturen. Sie sind popkulturelle Archetypen, und jeder Dämon hat seine ganz eigene Agenda - wie der Captain, Verkörperung des aufopferungsvollen Helden, auf den kein hurrapatriotischer Militärschinken verzichten kann. Oder The Truth, die erbarmungslose Nemesis aller, die sich durch Tricks und Lügen der Justiz entziehen wollen (in dieser Version der Erde beendet Truth den O. J. Simpson-Prozess in spektakulär bleigeladener Weise ...). Etwa 100 Dämonen soll es weltweit geben - 17 davon werden im Roman genannt - und sie alle gehen auf dieselbe Weise vor: Für eine kurze Zeit ergreifen sie vorwarnungslos Besitz vom Körper harmloser BürgerInnen, um damit wieder und immer wieder denselben Ablauf durchzuspielen - eben die Rolle auszuleben, die sie definiert, angepasst an die jeweiligen konkreten Umstände. Glück gehabt, wenn man nur vom Painter - dem Inbegriff des ausgeflippten Künstlers - besessen ist, einfach ein bisschen Rabatz macht und aus dem, was grad greifbar ist, mitten im öffentlichen Raum ein Kunstwerk bastelt. Lebensgefährlich wird es hingegen, wenn Truth oder Kamikaze ihre Nummer durchziehen ... und auch die Selbstopferungstendenzen des Captains tun dem geborgten Körper selten gut. Einschreiten lässt sich kaum dagegen: Gewaltanwendung würde nur dem Körper des unschuldig Befallenen schaden, der Dämon selbst könnte jederzeit auf einen anderen Menschen überspringen (und wäre dann vielleicht über die Störung so verärgert, dass er noch schlimmer toben würde).
Seit Jahrzehnten zerbricht sich die Menschheit die Köpfe darüber, was hinter dem Phänomen der Besessenheit wirklich steckt. "Dämonen" heißen die Störenfriede nur im alltäglichen Sprachgebrauch, nüchtern wissenschaftlich Denkende hingegen gehen von einer psychischen Störung aus, vermeiden Personifizierungen und drücken sich in Formulierungen wie the Kamikaze strain of disorder aus. Auffällig allerdings, dass eine solche "disorder" niemals mehr als einen Menschen zur selben Zeit plagt. PsychologInnen berufen sich auf Carl Jung und glauben an Manifestationen des Kollektiven Unbewussten, während christlich Geprägte die Dämonen als satanische Ausgeburten verdammen. Von da ist es nur mehr ein kleiner Schritt bis zu spinnerten Privattheorien, es könnten telepathisch begabte Neandertaler-Nachfahren oder die Slan dahinterstecken: jene fiktive Superrasse, die der Science-Fiction-Autor A. E. van Vogt 1946 in seinem gleichnamigen Romanklassiker beschrieb. Ohne dass hier des Rätsels Lösung stecken müsste, ist dieser Verweis wichtig, denn Pulp- und Comicliteratur spielen für den vor popkulturellen Verweisen strotzenden Roman eine ebenso wichtige Rolle wie Jungs Archetypen. Und auf seine ganz eigene, raffinierte Weise wird "Pandemonium" so zu einer ähnlich liebevollen Hommage an das "Golden Age of Comic Books" wie vor einigen Jahren Michael Chabons "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier und Clay".
Im Mittelpunkt des Romans steht Twentysomething Del, der als Kind von Hellion besessen war, der Quintessenz aller ungezogenen Bengel, die jemals ihrer Umgebung fiese und manchmal auch gefährliche Streiche gespielt haben. Das Einzigartige an Dels Fall: Der Dämon hat ihn niemals wieder verlassen, Del konnte ihn nur mit Medikamenten und mentalem Training im hintersten Winkel seines Unterbewusstseins einsperren. Doch seit kurzem funktioniert das nicht mehr. Del hört förmlich, wie in seinem Kopf Krallen an Gitterstäben kratzen, und muss sich nachts ans Bett fesseln, um keinen Unfug anzustellen. Hilfesuchend kehrt er zu seiner Familie zurück - auch weil im nahegelegenen Chicago eine internationale Konferenz zum Thema Besessenheit stattfindet und er sich von einem prominenten Neurologen Hilfe erhofft. Damit wird es allmählich turbulent: Die Veranstaltung wird stets von einer outlaw para-conference, dem "DemoniCon", belagert, auf dem kostümierte Dämonen-Fans feiern, bis der Arzt kommt. Die Themenpalette auf der hochwissenschaftlichen Konferenz erweist sich dann allerdings als kaum weniger skurril als der Wanderzirkus vor der Tür. Es wäre zum Lachen, würde Dels Hoffnungsträger nicht erschossen, während er als Hauptverdächtiger fliehen muss.
So findet sich Del on the road quer durch die USA wieder, chauffiert von My Very Bigger Brother Lew, der sich ruppig gibt, tatsächlich aber Del nach Leibeskräften unterstützt. Menschen mit wenigen Worten und sehr viel Witz genau zu charakterisieren, ist eine der Stärken Gregorys, und beileibe nicht die einzige. Auf ihrer Odyssee treffen die beiden unter anderem die sexy Nonne Mother Mariette, eine Exorzistin mit Vollglatze und interessanten Informationen zum Thema Dämonen, und müssen sich mit dubiosen Organisationen wie den Jungianern des Red Book oder der geekigen Human League befassen, die sich die Vernichtung aller Dämonen auf die Fahnen geschrieben hat. Ein echtes Highlight ist Dels Begegnung mit Philip K. Dick, der in dieser Welt von seinem Schlaganfall genesen und alt genug geworden ist, um Ruhm und Reichtum genießen zu können. Aber ist er's auch wirklich oder spricht längst eine andere Entität aus seinem Mund? Ansprechen lässt er sich jedenfalls nur noch mit VALIS - angesichts der Substanz, die Dick sein großes gleichnamiges Spätwerk gekostet hat, wirkt der Einfall, den Autor im Kontext Besessenheit zur Romanfigur zu machen, bemerkenswert stimmig. Und das Wesen der Dämonen wird damit um eine weitere Nuance rätselhafter.
Einen Roman als gut konstruiert zu bezeichnen, kann oft als versteckte Kritik gewertet werden; ebenso wie kluges Einbauen von Zitaten und Verweisen zu Lasten des Gefühls gehen kann. Nichts davon ist hier der Fall. Sämtliche Bezüge sind ebenso passend wie unaufdringlich platziert und die Handlung schnurrt dahin, dass es eine Freude ist. Und doch muss man einfach bewundern, wie selbst kleine Details von Bedeutung sind, weil sie das große Gesamtbild widerspiegeln - sei es Dels fortwährendes Spiel mit Palindromen oder seine Erinnerungen daran, wie er in seiner Kindheit mit Lew Brettspiele auseinandernahm, um sie nach eigenen Regeln neu zu kombinieren. Nichts davon ist zufällig, wie man am Ende eines Romans erkennt, der eine Überraschung nach der anderen aus dem Hut zaubert. Darunter auch einen Twist in "The Sixth Sense"-Dimensionen (die besten sind immer die, die so naheliegend sind, dass man sie einfach nicht sehen kann). - Kurz zusammengefasst: "Pandemonium" bietet alles, was man sich von einem Roman nur wünschen kann. Daryl Gregorys nächstes Buch erscheint im Sommer, dazwischen kam bereits "The Devil's Alphabet" heraus - nach diesem gloriosen Debüt sind das Fixstarter für künftige Rundschauen.
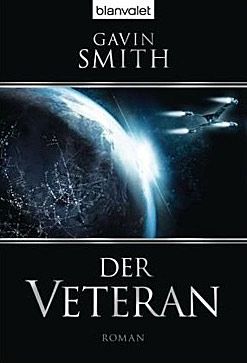
Gavin Smith: "Der Veteran"
Broschiert, 655 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2011.
SIE waren einfach im Sirius-System auf die Menschen gestoßen, hatten angefangen, uns zu töten, und nicht mehr damit aufgehört. Gemündet hat der mittlerweile seit 60 Jahren anhaltende interstellare Krieg gegen SIE (gleichsam die namenlose Quintessenz aller fremdartigen und feindlichen Aliens, die die Science Fiction je hervorgebracht hat) in einer durch und durch brutalisierten Gesellschaft. Jeder läuft hier bewaffnet herum, selbst die Wehrdienstverweigerer. Zudem besteht ein nicht unwesentlicher Anteil der Erdbevölkerung aus Veteranen ... zumindest seit ein gesetzliches "Schlupfloch" geschlossen wurde, das den Regierungen der immer noch bestehenden Nationalstaaten erlaubt hatte, die potenziell gefährlichen Frontheimkehrer kurzerhand im Weltraum zu verklappen.
Ein solcher "Vet" ist Jakob Douglas, ein Cyborg inklusive Wolverine-artiger Fingerklingen, der wie viele seiner ehemaligen KameradInnen in einem typischen Vet-Ghetto haust - im konkreten Fall sind es die Stahlskelette ehemaliger Ölplattformen, die nahe Dundee - der Geburtsstadt des Autors - aufgehäuft wurden. Seine Tage verbringt Jakob mit Wettkämpfen und der Sucht nach virtuellen Empfindungen in Cyber-Kabinen ... bis eines Tages seine Körperimplantate per Fernsteuerung wieder aktiviert werden und ihn sein ehemaliger Vorgesetzter für einen Spezialauftrag zwangsrekrutiert: Einer von IHNEN soll auf der Erde gelandet sein, search and destroy. Aber wie so oft kommt alles anders als geplant. Anstatt das Alien, das sich als Kollektiv organischer Nanobots entpuppt, zu töten, lässt Jakob sich von der jungen Prostituierten Morag überreden, es in Sicherheit zu bringen. Gejagt von den Sicherheitsbehörden, begeben sich die zwei Menschen auf eine Odyssee quer über eine düstere, unbarmherzige Erde und scharen unterwegs ein buntes Fähnlein Gleichgesinnter um sich. Soweit die Handlung.
Beim Aufbau seines Debütromans setzt Gavin Smith primär auf Action. Schon sehr früh vollzieht Jakob den eigentlich enormen Entwicklungsschritt, eines jener verhassten Wesen am Leben zu lassen, gegen die er einst (in zahlreichen Rückblenden ausführlich geschildert) erbittert gekämpft hat und die ihn nicht nur zahlreiche KameradInnen, sondern auch weite Teile seines Körpers gekostet haben. Man fragt sich unwillkürlich, was nach diesem ebenson radikalen wie raschen Umdenken wohl noch kommen mag - die Antwort: es wird gekämpft. Mit Messern und Strahlenwaffen, Bomben und Napalm; als makabrer Running Gag zieht sich dabei der Umstand durchs Geschehen, dass Jakob aus jedem Gefecht ein Stückchen versehrter hervorgeht. Wir begleiten die ProtagonistInnen von einem pittoresken Schauplatz des Elends zum nächsten: Von den "hängenden Gärten" von Hull über das überflutete Piratennest New York bis nach Crawling Town, einen gigantischen Konvoi, der sich durch die verstrahlten Ostküstenstaaten der USA wälzt. Und in jeder Station wird ein ehemaliger Weggefährte aufgelesen, als wäre Jakob unterwegs, um Vets und Alt-Hacker zum Klassentreffen abzuholen.
Smith erzählt flüssig und hat Action-Fans jede Menge zu bieten: Die anarchische Truppe, die sich hier zusammengefunden hat, ist nicht nur groß im Ballern, sondern auch dauer-high auf so ziemlich jeder Droge, die je erfunden wurde, und begleitet ihre Einsätze selbst auf der Stromgitarre. Doch Tempo ist nicht alles (sonst könnte auf der Autobahn niemanden der Sekundenschlaf ereilen) und der zeitweilige Action-Overkill vermag nicht ganz darüber hinwegzutäuschen, dass die Haupthandlung vergleichsweise langsam voranschreitet. Denn von einer Interaktion mit dem "Botschafter" genannten Alien kann lange Zeit nicht die Rede sein, genausogut könnten Jakob & Co ein Fabergé-Ei durch die Gegend karren. Überhaupt ist der Botschafter lange Zeit kein Akteur, sondern passives Objekt der unterschiedlichsten Wünsche und Begierden: Ein Pärchen, das die bruchgelandete Raumkapsel des Botschafters ursprünglich gefunden hatte, machte ihn zu Geld, ein Bordellbesitzer wollte ihn zum Sexspielzeug umfunktionieren ("Wir hätten Löcher hineinschneiden können."), einer von Jakobs Hacker-Gefährten möchte aus den Infomaschinchen des Botschafters sogar den neuen Gott des Cyberspace bauen. Erst ganz allmählich zeichnet sich ab, dass eine virtuelle Infektion Morags mit dem Code des Botschafters Folgen zeigt, und dass auch SIE etwas zu sagen haben.
"Der Veteran" (erst 2010 als "The Veteran" im Original erschienen) ist ein Debütroman von beträchtlichem Umfang, bei dem die eine oder andere Kürzung durchaus dringewesen wäre. Langeweile kann inmitten des ständigen Kampfgetümmels zwar nicht aufkommen, doch so richtig spannend wird es erst dann, wenn sich die Truppe im letzten Romandrittel erstmals damit auseinandersetzt, wie ihr künftiger Cyber-Gott die Welt zum Besseren verändern könnte. Dass dieser Abschnitt - in dem sich immerhin das Schicksal der Welt entscheidet - nicht den abschließenden Höhepunkt bildet, sondern danach auf neue Schlachtfelder weitergezogen wird, unterstreicht noch einmal, dass Smith eine klare Action-Schlagseite hat. Weitere Romane aus dem "Veteran Universe" werden folgen.
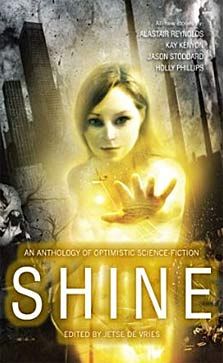
Jetse de Vries (Hrsg.): "Shine. An Anthology of Near-Future Optimistic Science Fiction"
Broschiert, 453 Seiten, Solaris 2010.
Gefährliches Ding Hoffnung: In Eric Gregorys "The Earth of Yunhe" bringt der junge Xiao den BewohnerInnen seines in einer Ascheflut versunkenen Dorfes neue Hoffnung - und muss dafür erst mal ins Gefängnis; sogar die Todesstrafe droht ihm. In mehrfacher Hinsicht ist diese erste Erzählung der "Shine"-Anthologie programmatisch für die Sammlung als Ganzes: Bevor die Dinge besser werden können, müssen sie offenbar erst einmal noch schlechter werden, bis das Risiko eines Umdenkens eingegangen wird. Denn mit Aussichtslosigkeit kann man sich arrangieren, Hoffnung schöpfen hingegen erfordert Mut. - Im Vorwort von "Shine" schildert Herausgeber Jetse de Vries, wieviel Schweiß und Tränen es ihn gekostet hat, 16 aktuelle Erzählungen zusammenzukratzen, die das doppelte Wagnis eingehen, eine positive (aber nicht notwendigerweise utopische) Sicht der Zukunft zu schildern - und zwar einer Zukunft, die am zeitlichen Horizont bereits auszumachen sein soll. Near Future + Optimistic = nahezu unmöglich, so schien es. Und doch setzte sich de Vries mit vorliegendem Ergebnis vehement dafür ein, dass die Science Fiction ihrem Anspruch, die Wirklichkeit widerzuspiegeln, auch in Bezug auf das eigentlich doch allgegenwärtige Prinzip Hoffnung gerecht werden müsse.
Ansonsten gab es keinerlei inhaltliche Vorgaben, was sich in einigen Erzählungen mit besonders originellem Ansatz zeigt. In Madeline Ashbys "Ishin" beispielsweise besuchen wir ein geschundenes Afghanistan, das vor technisch hochgerüsteten ausländischen Sicherheitsdiensten nur so wimmelt. Just an diesem unwahrscheinlichsten aller Orte wird ein neues Überwachungs-Interface zum verbindenden Element einer zarten Liebesbeziehung. Wo "Ishin" von seiner melancholischen Atmosphäre lebt, geht's in der mit Neologismen und Akronymen gespickten Erzählung "Sarging Rasmussen: A Report (by Organic)" von Gord Sellar mit Witz zur Sache: Hoffnungslose Öko-Aktivisten haben nach Jahrzehnten des Bäume-Umarmens dringenden Nachholbedarf in Sachen Aufrisstechniken und belegen ein entsprechendes Seminar. Doch bald erkennen sie, dass die Fertigkeit des "mind-hacking" nicht nur bei potenziellen Sexpartnerinnen, sondern auch im internationalen Lobbying-Karussell anwendbar ist, um die Welt zu retten: We're mammals. No matter, how much fancy, clever neocortex you slather onto our brains, we're animals. Und in den Konferenzräumen von Den Haag beginnt das große Game 2.0.
Ähnlich wie Dystopien gute Indikatoren sind, was eine Gesellschaft gerade so umtreibt, legen auch die "Shine"-Beiträge den Finger auf offene Wunden: Klimawandel, ökologische Desaster und die brisanter werdende Situation in Entwicklungsländern sind erwartbare und auch mehrfach vorkommende Themen - Jason Andrews "Scheherazade Cast in Starlight", ein kurzes Streiflicht auf bürgerliche Emanzipationsbewegungen im Nahen Osten, erhält durch die aktuellen Fernsehbilder sogar eine unerwartet prophetische Note (soviel zum Stichwort die Wirklichkeit widerspiegeln ...). In "Seeds" von Silvia Moreno-Garcia regt sich in Mexiko Widerstand gegen US-amerikanischen Gentech-Kolonialismus - andere Erzählungen kommen auch ganz ohne Feindbild aus: Wie im Tansania von Ken Edgetts "Paul Kishosha's Children", wo ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter in seine ehemalige Heimat zurückkehrt und mit einer TV-Show für Kinder eine Bildungslawine ins Rollen bringt, die ganze Generationen beeinflussen wird. Noch spektakulärer der Aufschwung, den Lavie Tidhar, Autor von "The Tel Aviv Dossier", dem kleinen Inselstaat Vanuatu in der Geschichte "The Slonet Ascendancy" wünscht. Hier ereignet sich gar eine informationstechnologische Singularität, die mit einem Scherz begann und bei Weltraumliften und Entwicklungshilfe für die einstigen "Geberländer" noch lange nicht zu Ende ist. Beide Szenarien mögen ein wenig naiv anmuten - aber vielleicht ist Hoffnung ja genau das.
Die Zugänge zum allgegenwärtigen Umwelt-Thema sind - neben den schon genannten Beispielen - vielfältig. "The Greenman Watches the Black Bar Go Up, Up, Up" von Jacques Barcia zeichnet das Bild eines Brasilien, in dem Kohlenstoffkredite die neue Währung sind. Der Nachhaltigkeitsanalyst Inácio wird auf die Spur einer neuen wikindustry gesetzt, die in Kürze ein mysteriöses Produkt auf den Markt bringen will - und begegnet im Zuge dessen seinem schmerzlich vermissten toten Lebenspartner wieder. Und auch Holly Phillips verbindet in "Summer Ice" persönliche Aspekte mit Vorgängen auf der globalen Bühne: Ihre Protagonistin Manon muss wie jeder Bürger bei der Wiederbegrünung ihres Wohnorts mithelfen, nachdem die Erde den Klimaschock mit einiger Mühe überstanden hat. In einem anderen Kontext würde die Veränderung der Welt wohl zur Metapher für Manons innere Entwicklung, als sie sich in ihre neue Gemeinschaft einzuleben beginnt - im thematischen Rahmen der Anthologie kehrt sich die Bedeutung der beiden Metamorphosen um; ein schöner, wenn auch ungeplanter Effekt. Und dann wäre da noch das Highlight "Castoff World" von Kay Kenyon, einer der wenigen bekannteren AutorInnen, die in dieser Anthologie vertreten sind. "Castoff World" ist eine berührende Sage aus dem Zeitalter nach Shops und Weltraumfahrstühlen, in dem das kleine Mädchen Child, das nie eine andere Welt gekannt hat, und sein Großvater auf einer Insel aus Plastikmüll über den Pazifik treiben. Doch sind sie nicht ganz allein, denn die Nanobots, die rings um sie den Müll recyceln, zeigen sich bereit für eine Symbiose und damit für ein neues, besseres Zeitalter.
Bemannte Raumfahrt haben nur zwei AutorInnen in der nahen Zukunft gesehen. Jason Stoddard stellt einer bedrückend unübersichtlich gewordenen Erde, auf der es nur noch um die Umverteilung von Ressourcen geht, eine versteckte kleine Mondbasis als letzten Ort gegenüber, an dem noch Pläne für die Zukunft geschmiedet werden - und die Zukunft kann bekanntlich nur im Weltraum liegen, wie Stephen Hawking sagte. - Ein ganz besonderer Fall ist "Twittering the Stars" von Mari Ness. Twitter hat für die Anthologie mehrfach eine Rolle gespielt: Zum einen nutzte Jetse de Vries sämtliche sozialen Netzwerke, um AutorInnen für sein Projekt zu finden, zum anderen sind diverse kommentierende Tweets zwischen den einzelnen Geschichten abgedruckt. Über deren Sinnhaftigkeit kann man zwar streiten - zweifellos aber führte Ness' Idee, ihren Beitrag in Form eines Twitterstreams zu erzählen, zu einem der formalen und atmosphärischen Höhepunkte von "Shine". Keine andere Erzählung wirkt so unmittelbar wie die Tweets, die eine Botanikerin von Bord eines Raumschiffs sendet, das zu einer mehrjährigen Mission in den Asteroidengürtel aufgebrochen ist. Ness lässt die LeserInnen an allen bekannten Space-Opera-Topoi von Einsamkeit und Enge über die langweilige Bordroutine ("Also mined barium and lithium and lots of other things you don't care about ending in um"), rare Glücksmomente ("We made the top of Google News? AWESOME!") bis zum Eindringen einer fremden Lebensform in einzigartiger Weise teilhaben. Allerdings ist die Geschichte, die wegen ihrer Form entweder von vorne nach hinten oder chronologisch gelesen werden kann, ironischerweise nur in einer Richtung als optimistisch zu bezeichnen.
Und noch etwas demonstriert "Shine": Große Namen müssen nicht zwangsläufig mit einer besonders guten Geschichte korrelieren, aber die Chance ist größer als beim Durchschnitt - siehe Kay Kenyon oder Star-Autor Alastair Reynolds, dessen nächster Roman "Unendliche Stadt" übrigens im März erscheint. Sein "Shine"-Beitrag "At Budokan" ist eine bitterböse und sehr, sehr witzige Abrechnung mit dem Heavy Metal als seelenloses Business. Erst hat das Unternehmen Morbid Management chipgesteuerte Leichen auf die Bühne gestellt, dann Roboter, und schon wird der nächste Schritt vollzogen: "We were already doing Robot Metallica. What was to stop us doing Giant Robot Metallica?" Und auch das ist noch nicht das Ende der Monster-Show ... Was Zynismus mit Optimismus zu tun hat? Das zeigt sich erst ganz am Ende, wenn der schlimmste Albtraum der Musik-Manager wahr wird und Reynolds die Botschaft sendet, dass der Geist des Rock'n'Roll niemals totzukriegen sein wird. Er sucht sich manchmal nur die unwahrscheinlichsten Körper aus, um von ihnen Besitz zu ergreifen.
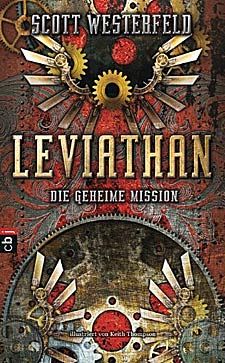
Scott Westerfeld: "Leviathan"
Gebundene Ausgabe, 472 Seiten, € 18,50, cbj 2010.
Giger goes Steampunk: So ließe sich die wunderschöne Europakarte beschreiben, die im Einband von Scott Westerfelds "Leviathan" prangt. Und es ist ein Europa am Vorabend des Ersten Weltkriegs, das in seinen politischen Konstellationen wohlvertraut wirkt, doch in deren innerer Ausgestaltung ordentlich vom Original abweicht. Die Mittelmächte Deutschland, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich gehören zum Lager der Mechanisten, bei denen der Fortschritt über den Bau von Maschinen in beeindruckenden Dimensionen läuft. Die Triple Entente hingegen, also Frankreich, Russland und das Vereinigte Königreich, bilden den Block der Darwinisten: Forscher-Übervater Charles Darwin hat hier nicht nur die Prozesse der Evolution erkannt, sondern auch - lange vor der Entdeckung der DNA in unserer Zeitlinie - die Lebensketten identifiziert und den Grundstein dafür gelegt, diese nach Belieben zu manipulieren. England, Mutterland der Industrialisierung, hat mittlerweile ganz auf Muskelkraft umdisponiert, bereitgestellt von tierischen Chimären aller Art. Und auch wenn diese Entwicklung erst einige Jahrzehnte alt ist, stehen einander nun in Europa zwei gänzlich unterschiedliche Zivilisationen gegenüber.
Vorwarnungslos werden die beiden Hauptfiguren des Romans in ihre jeweilige Hälfte des antagonistischen Mächte-Duos geworfen. Da ist zum einen Aleksandar, der fiktive Sohn des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner als nicht standesgemäß erachteten Ehefrau Sophie Chotek. Als seine Eltern in Sarajewo ermordet werden, muss der 15-jährige Alek, der dem Haus Habsburg ebenso wie dem deutschen Kaiser ein Dorn im Auge ist, in Sicherheit gebracht werden. Vertraute seines Vaters versuchen ihn ins Exil zu schaffen - an Bord eines riesigen kerosinbetriebenen Kampfläufers (in etwa mit der zweibeinigen Läufer-Variante in "Star Wars" vergleichbar) stampfen sie Richtung Schweiz, verfolgt und beschossen von ähnlich martialischen Kriegsmaschinen.
Indessen hat sich die ebenfalls 15-jährige Schottin Deryn Sharp als Bub verkleidet und unter dem Namen Dylan in London eingeschlichen, um als Fliegerkadett aufgenommen zu werden. Die Tarnung hält, die Aufnahmeprüfung in Form eines Senkrechtstarts mit einer wasserstoffgefüllten Meduse gerät allerdings zum ungeplanten Abenteuer. Deryn wird weit abgetrieben und vom titelgebenden "Leviathan" gerettet, dem zur Zeit gewaltigsten Produkt darwinistischer Forschung: Vom Grundgerüst her ein übergroßer fliegender Wal, in Wahrheit aber ein ganzes Ökosystem aus verschiedensten Spezies, die ihren Teil zur Mobilität des Giganten beitragen - sei es, dass sie unterwegs Nahrung zur Energieerzeugung sammeln, oder dass sie nach Wasserstofflecks schnüffelnd über seine Oberfläche patrouillieren. Deryn, die sich als Flieger-As entpuppt, bleibt gleich an Bord, als die "Leviathan" zu einer Geheimmission in die Türkei startet. - Klar, dass die beiden Handlungsstränge, die zunächst jeweils in Doppelkapiteln parallel verlaufen, früher oder später aufeinander treffen müssen - wenn's dann passiert, wird es mit ordentlich Begleitdonner geschehen.
Mit "Leviathan" hat der Texaner Scott Westerfeld 2009 eine Jugendroman-Trilogie begonnen, die von den SF-Settings früherer Romane abrückt; der zweite Teil ("Behemoth") ist im Herbst erschienen und wird im April bereits in übersetzter Form erhältlich sein. Dass es sich um Jugendromane handelt, zeigt sich unter anderem am klassischen Coming-of-Age-Plot. Die Handlung ist ganz auf die beiden jungen ProtagonistInnen fokussiert, die sich daran gewöhnen müssen Verantwortung zu übernehmen und sich dabei - wichtig! - allmählich Respekt erwerben. Und auch stilistisch gibt sich Westerfeld zugänglich: Die Sprache beschränkt sich darauf die Handlung zu transportieren, lässt aber immer wieder auch ein Quantum Witz durchschimmern - vor allem wenn die Figuren einen fast großmütterlich wohlerzogenen Umgangston pflegen. Was gar nicht so leicht zu übersetzen gewesen sein dürfte - doch das nach einer Bruchlandung geäußerte Understatement "Bisschen durchgeschüttelt im Oberstübchen" ist auch nicht schlecht.
Als weiteres Goodie enthält der Roman neben der schon erwähnten Karte zahlreiche Illustrationen Keith Thompsons, die der Romanwelt vergnügliches Leben einhauchen: Von einem vor riesenhaften Last- und Zugtieren wimmelnden London bis zu aberwitzigen Maschinen, die in Fans von Actionfiguren Wünsche nach Merchandising wecken werden. Auch dabei ein Porträt der geheimnisvollen Wissenschafterin Nora Barlow, die sich als Melone tragende Dame von Welt in Begleitung eines waschechten Beutelwolfs präsentiert: Das hat mehr Stil als die kurzlebige Gepardenmode der 1970er, ganz zu schweigen von jedermanns Dalmatiner!
Und unter der ganzen Abenteuerhandlung erfüllt "Leviathan" sogar noch einen subtilen Bildungsauftrag. Nicht etwa in Bezug auf Biologie, Fechtkunst-Termini oder in Sachen Thronfolgeregelung im Habsburgerreich (auch wenn Westerfeld erfreulich gut recherchiert hat ... erst recht im Vergleich zu so manchem Autor, der für ein erwachsenes Publikum schreiben will und dieses für dumm verkauft). Nein, ein ganz anderer: Als ich selbst noch zu der Altersgruppe gehörte, auf die "Leviathan" primär abzielt, wurden uns mit wenigen Ausnahmen zwei Alternativen zu-geschrieben - entweder durchs Weltall zu düsen oder zu Schwert & Zauberstab zu greifen. Aber irgendwie kann so etwas eine bipolare Sicht auf die Phantastik etablieren, die der Vielfalt des Genres nicht gerecht wird und die viele spät und manche gar nie überwinden. "Leviathan" mit seinen pneumatischen Großkampflandschiffen und schreckhaften Luftquallen liegt irgendwo zwischen den beiden Polen und hält damit den Geist frisch. Ich denke, das Buch hätte mir damals gefallen. Das tut es auch heute noch.
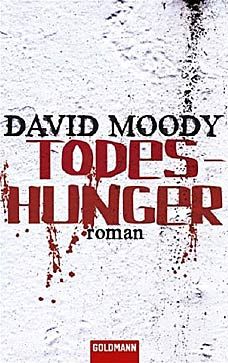
David Moody: "Todeshunger"
Broschiert, 381 Seiten, € 9,30, Goldmann 2010.
Man kann lange darüber philosophieren, ob eine Geschichte in jedem Fall fortgesetzt werden muss, oder ob es manchmal nicht doch die bessere Variante wäre, es bei einem Einzelwerk mit (halb-)offenem Schluss, der aber eine erkennbare Tendenz aufweist, zu belassen. Siehe etwa Jeff Carlsons "Nano"-Trilogie, deren Teile 2 und 3 dem ersten Band nichts Vergleichbares mehr hinzuzufügen hatten - oder um ein bekannteres Beispiel zu nennen: "Matrix". Ein Kandidat für diesen Effekt hätte auch "Todeshunger" (2010 als "Dog Blood" erschienen) sein können, mit dem Horror-Star David Moody seinen fulminanten Roman "Im Wahn" ("Hater"; hier die Nachlese) fortsetzt. Doch "Todeshunger" ist ein würdiger Nachfolger in Sachen Erbarmungslosigkeit, soll heißen: Er treibt die ebenso widerwärtige wie auf perfide Weise hochintelligente Erzählung konsequent weiter.
Die zahlreichen Kontexte, die im ersten Band anklangen - von der Angst vor Amokläufen und Terrorismus bis hin zur Rolle der Medien bei der Konstruktion dieser Angst - interessieren in "Todeshunger" fürs erste niemanden mehr. Was zählt, ist der neue Status quo: Ein Drittel der Menschheit hat sich aus nach wie vor ungeklärter Ursache in Hasser verwandelt, deren oberstes Ziel es ist, so viele Nichtbetroffene zu massakrieren wie möglich. Diabolischerweise können Hasser einander erkennen und sogar einen toten "Artgenossen" identifizieren - für die Normalgebliebenen hingegen sieht jeder Mensch gleich aus: ein Faktor, der Panik und Hilflosigkeit bis zum Äußersten steigert. Vom Militär abgesichert, lebt die Normalbevölkerung in Städten zusammengepfercht, während das Umland an die Hasser gefallen ist und die Vorräte immer knapper werden, da nichts mehr angebaut werden kann. Moody verdichtet die klaustrophobische Situation noch einmal, indem er in einigen Kapiteln den Niedergang einer Gruppe von Flüchtlingen beschreibt, die auf engstem Raum in einem Hotel hausen und von den Behörden zur Aufnahme immer weiterer MitbewohnerInnen gezwungen werden.
Der Fokus liegt aber auf der anderen Seite: Zu Beginn des Romans ereignet sich ein berserkerhafter Überfall auf einen Evakuierungskonvoi, ein Szenario, das aus Zombie-Filmen sehr vertraut wirkt. Doch aus der gesichtslosen Menge mordender Bestien löst sich eine, die gerade eine um Gnade flehende Frau geköpft hat, heraus ... und wir haben den Protagonisten von Band 1 wieder: Danny McCoyne, der am Ende von "Im Wahn" zum Hasser wurde. Der nun nach seiner ebenso verwandelten Tochter sucht, während ihm Frau und Söhne, alle drei unverändert geblieben, vollkommen egal sind. Der aus seinem Haus liebevoll Puppe und Strampelanzug für das kleine Mädchen birgt und zugleich mit Wonne in seiner neuen Daseinsform aufgeht, etwa bei einem Hasser-Angriff auf ein Spital voller Überlebender: Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, als ich Paul folge, den Hang hinablaufe und mir nichts sehnlicher wünsche, als in dem Krankenhaus zu sein, damit das Töten beginnen kann.
Das Außerordentliche an Moodys Erzählung ist, dass er nicht einfach nur Gewalt als sich verselbstständigendes System beschreibt, sondern dass er auch die LeserInnen (hoffentlich) dazu bringt, ihre Rolle beim Konsum von Gewaltdarstellungen zu überdenken. Auch wenn man in der Regel einen Protagonisten "auf der richtigen Seite" der moralischen Grenze als Identifikationsfigur hat, bekommt man die ganzen süffigen Szenen von Mord und Totschlag ja dennoch mitgeliefert; ein vermeintlich unschuldiges Vergnügen: sind ja die anderen, die Böses tun. Hier hingegen ist der potenzielle Sympathieträger - und wer könnte schon mehr Sympathien wecken als ein Vater, der verzweifelt nach seiner Tochter sucht? - ein Soziopath und vielfacher Mörder, der das Geräusch genießt, mit dem eine aus dem Fenster gestürzte Frau auf dem Boden aufschlägt. Der vor Stolz und Vaterliebe schier birst, wenn sich seine zum Monster gewordene Tochter durch Reihen von wehrlosen Opfern fräst. Und der die kleine Bestie gezielt als Waffe einsetzt. Durch die Umkehrung der in Action-Reißern üblichen Perspektive lotet Moody gnadenlos die Grenzen des Erträglichen aus. Und überschreitet sie.
Moody scheint die Unterschiede zwischen den beiden Lagern mehrfach zu verwischen: Beide Seiten führen gewaltsame Plünderungen durch, auf beiden Seiten gibt es Individuen, die sich dem gegenseitigen Töten verweigern. Gruppen von Unveränderten ziehen los, um Hasser nicht in Notwehr, sondern aus Spaß an der Freud zu töten, zudem setzen die Unveränderten wie schon in Teil 1 auf die Strategie der Massenvernichtung - waren es Gaskammern (Moody schreckt wirklich vor keinem Tabu zurück) in "Im Wahn", so sind es nun Atomwaffen. Aber unter dem Strich ist die Gleichsetzung eine scheinbare: Die Unveränderten bleiben diejenigen, die re-agieren; ihre Aktionen entspringen letztlich der Notwehr, auch wenn sie deren Grenzen mehrfach überschreiten. Und die große Mehrheit von ihnen könnte gut ohne Töten auskommen, wenn sie nur irgendwie überleben. Die Hasser hingegen sind diejenigen, für die das Töten Selbstzweck und Endziel darstellt - ein Ziel, das niemals in Frage gestellt wird. Dass sie keine hirnlosen Zombies sind, sondern ihr Sein und Handeln sehr wohl reflektieren können, unterstreicht die Bedeutung dessen noch einmal.
Und auch wenn angesichts des Dauergemetzels niemand mehr Zeit hat, sich mit den Ursachen der "Epidemie" zu beschäftigen, klingen zwischen den Zeilen von "Todeshunger" einige spannende Aspekte an. Während die Intermezzi um die Gruppe von Unveränderten im Imperfekt erzählt werden, schildert Danny seine Geschichte im Präsens. Ausdruck dafür, dass die Hasser nur in der Gegenwart leben bzw. dass sie nur die ekstatischen Momente des Tötens überhaupt als Leben empfinden, während sie alles dazwischen - Essen, Kommunizieren und sämtliche andere Arten von Aktivität - nur als Phasen des Vegetierens ansehen. Sie nutzen die vorhandenen Mittel der Zivilisation, produzieren aber keine neuen. Und sie scheinen auch die Lust auf Sex zu verlieren. Spinnt man den Gedanken weiter, würden nach einem Sieg der Hasser wohl bald die Lichter ausgehen ... was zu interessanten Spekulationen darüber veranlasst, was wohl wirklich hinter der Zweiteilung der Menschheit stecken könnte. Vielleicht wird der noch für heuer angekündigte Abschlussroman, derzeit unter dem bezeichnenden Titel "Them Or Us" in Arbeit, diese Frage klären. Ob ich dafür dann noch einmal die Magennerven habe, weiß ich allerdings noch nicht.

Michael McBride: "Legionen des Todes"
Broschiert, 443 Seiten, € 9,30, Blanvalet 2010.
Kommen wir also, wie letzten Monat angekündigt, zum Abschluss zweier Trilogien, zunächst Michael McBrides Apokalypse-Saga "God's End". Nachdem in Teil 2 ("Sturm der Seelen", hier die Nachlese) gewissermaßen die Schlacht an der Hornburg geschlagen wurde - in diesem Fall rund um eine Höhle am Großen Salzsee von Utah -, stehen nun also der Marsch auf Mordor und die Konfrontation mit dem Erzfeind auf dem Programm. Nicht nur dass unser kleines Häuflein Überlebender in Denver, wo Tod höchstselbst residiert, ein dunkler Turm und ein Feuersee erwarten, der Weg dorthin führt sie auch noch durch ein ödes Land voller Asche und Rauch. Denn Tod, der im Auftrag des christlichen Gotts der Nächstenliebe den Untergang über die Menschheit gebracht hat, fühlt sich mittlerweile von seinem einstigen Herrn verraten und will nun die Apokalypse in Eigenregie zur Vollendung bringen. Weil einige Tiere aus dem neuen, mutierten Biom den letzten Menschen geholfen haben, startet Tod einen Feldzug gegen die gesamte Biosphäre - und unsere verbliebenen acht ProtagonistInnen brettern auf ihren Motorrädern durch ein sterilisiertes Amerika.
... ganz wie es das Schicksal für sie vorgesehen zu haben scheint. Bereits im Vorgängerband entdeckten unsere HeldInnen der letzten Tage ja jahrhundertealte Höhlenmalereien, in denen ihre Porträts wie die von katholischen Heiligen mit individuellen Attributen dargestellt sind. Zum Teil offenbarten sich die darin symbolisierten besonderen Fähigkeiten der jeweiligen Person bereits in "Sturm der Seelen", zum Teil tun sie es erst jetzt. Prophezeiungen und Visionen, die mehrere der Gruppenmitglieder haben, unterstreichen zusätzlich, dass alles nach einem exakt festgelegten Drehbuch abläuft - vielleicht ist letztlich ja sogar Tods Auflehnung Teil des göttlichen Spiels.
Die religiösen Bezüge steigen sich in "Legionen des Todes" ("Trail of Blood") förmlich auf die Füße: Das verbliebene Rumpfteam teilt sich in eine "Vater-Sohn"-Konstellation und drei Hetero-Liebespaare auf; eines davon trägt die Namen Adam & Evelyn (Nachtigall, ick hör dir trappsen ...). Und während seine "Jünger" allmählich ihre individuellen Kräfte entdecken, wächst der junge Phoenix, der ohnehin nie ganz von dieser Welt zu sein schien, immer stärker in eine Christus-Rolle hinein. Selbstopferung ist ein immer wiederkehrendes Motiv im Roman und sogar eine Kreuzigungsszene wird es noch geben. Allerdings hat Phoenix, als Missbrauchsopfer einer irren Sekte aufgewachsen, inzwischen selbst eine grausame Seite entwickelt. Wenn er nun zum großen Gegenspieler des Todes wird, dann trägt er ein Fragment von dessen Bösem in sich - ebenso wie Tod, ursprünglich selbst ein Mensch, dann von Gott zum Feldherrn gemacht und wieder fallen gelassen - ein kleines bisschen Mitgefühl verdient. Ein Stück von seinem Gegenteil in sich selbst zu tragen ähnelt eher der Dualität von Yin und Yang als der reinen Gegenüberstellung von Gut und Böse und dürfte der nicht-christlichste Teil einer Saga sein, die ansonsten nichts auslässt, um die Bibel als Script für eine Blutoper ungeahnten Ausmaßes zu verwenden.
Und man muss wohl auch eine religiöse Ader haben, um so manchen widersprüchlichen Gedankengang zu schlucken. Als die ProtagonistInnen zwischen zwei Schlachten einen Sonnenaufgang bewundern, finden sie ihn fast so, als hätte Gott selbst ihn nur für sie so geschaffen. Derselbe Schöpfer, der gerade erst den globalen Holocaust über sie gebracht hat. Da drängt sich das Gedankenspiel auf, ob man derlei positive Assoziationen auch gegenüber einem (Science Fiction:) Alien-Invasoren oder einem (Fantasy:) Fürsten der Magie hegte, wenn dieser gerade die Welt abgefackelt hat und anschließend ein bisschen Oberflächenkosmetik betreibt. Und natürlich bleibt durch die erzählerische Erhebung der USA zum Quasi-Welt-Schauplatz und die Bindung an die christliche Mythologie auch die alte Frage offen, was Hindus, Animisten & Co eigentlich die Zerstörungsgelüste einer nahöstlichen Gottheit angehen. Horror-Autor Brian Keene, den McBride gerne als Vorbild nennt, hat dieses Dilemma in einer seiner Apokalypse-Erzählungen zumindest thematisiert - lösen konnte er es allerdings auch nicht.
Ungeschmälert bleibt hingegen McBrides erzählerisches Vermögen. Die Bildgewalt seiner in Blut und Pathos gleichermaßen watenden "God's End"-Trilogie macht ihm jedenfalls so schnell keiner nach.
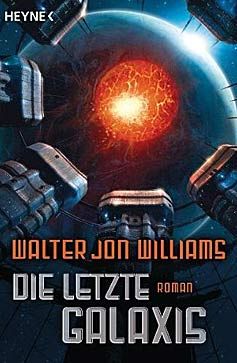
Walter Jon Williams: "Die letzte Galaxis"
Broschiert, 752 Seiten, € 16,50, Heyne 2010.
Warum Charlotte Roche wohl ihre "Feuchtgebiete" nicht als "Der letzte Planet" auf den Markt geworfen hat? Dem Inhalt wäre das exakt genauso angemessen wie den Abschluss von Walter Jon Williams' "Dread Empire's Fall"-Trilogie in einer "letzten Galaxis" anzusiedeln - wo immer die zu finden sein mag; im Buch jedenfalls nicht. Im Gegensatz zum deutschen Titel Marke Hautpsache-es-klingt-irgendwie-nach-Science-Fiction heißt der 2005 erschienene Roman im Original "Conventions of War", und das ist genau das, worum es geht. Denn die beiden Hauptfiguren der vorangegangenen Bände (hier die Nachlese) haben 1) neue Taktiken zu erlernen und 2) diese gegen die verzopfte Tradition zu verteidigen. Denn nur weil etwas funktioniert, heißt dies noch lange nicht, dass die aristokratischen Peers des zerfallenden Imperiums es auch akzeptieren würden: Starrsinniges Festhalten an ineffizienten Methoden von gestern droht die Erfolge von Gareth Martinez und Caroline Sula ein ums andere Mal zunichte zu machen.
So was kommt eben dabei heraus, wenn jahrtausendelang eine auch noch Praxis genannte Philosophie gepflegt wird, die Dogmen wie "Alles Wichtige ist bereits bekannt! Alles Vollkommene ist Bestandteil der Praxis! Jede Neuerung ist eine Abweichung vom höchsten Gesetz. Abweichungen sind nicht erlaubt!" hinausplärrt und die Untertanen des Reichs konsequent verdummt. Das erstaunlich naive Verhalten, das sowohl die Bevölkerung der Zentralwelt Zanshaa als auch die dort stationierten Besatzungstruppen an den Tag legen, lässt sich also aus der Handlung heraus begründen - man hat eben nie so recht gelernt, mit echten Schwierigkeiten umzugehen. Gleichzeitig wirken die geschilderten Kampfhandlungen seltsam ... altertümlich, als würden sie mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts ausgetragen. Eine ganze Latte von Technologie-Verboten hat dazu geführt, dass nano-, bio- und sonstige hochtechnologische Kriegswaffen, wie man sie aus anderen SF-Romanen kennt, hier gar nicht zur Verfügung stehen. Williams' Zurückschrecken vor Technologien, die in der heutigen Science Fiction als State of the Art gelten, verleiht seiner Trilogie ein eigentümlich nostalgisches Flair.
Nach wie vor unberechenbar zeigt sich der Autor im Handlungsaufbau: Anstelle eines simplen Reißverschlusssystems mit Martinez- und Sula-Episoden teilen sich die beiden ProtagonistInnen mal ein Kapitel, bekommen später dann gleich mehrere hintereinander, bis die beiden Handlungsstränge schließlich so weit auseinanderlaufen, dass "Die letzte Galaxis" allmählich in zwei Romane zu zerfallen scheint ... offenbar ging Williams so vor, wie's ihn gerade freute (was keineswegs negativ gemeint ist). Konsequent bleibt der Autor aber stets bei den Perspektiven der beiden Hauptfiguren - nie erhalten beispielsweise ihre Gegenspieler, die Putschisten aus dem Volk der Naxiden, Gelegenheit, ihren Standpunkt ungefiltert durch die Wahrnehmung des regierungsloyalen Lagers darzulegen. Was insofern interessant ist, da die Trilogie ja als großes historisches Panorama um Liebe, gesellschaftlichen Aufstieg und sich verändernde Normen angelegt ist und den Blick eher auf Strukturen als auf Action richtet.
... gut zu sehen etwa an den Kapiteln um Kommandant Gareth Martinez: Seit Monaten zieht er mit der imperialen Vergeltungsflotte von System zu System und hinterlässt zu Schutt und Asche zerblasene Planeten und Milliarden Tote. Im Vorbeigehen gleichermaßen, denn viel stärker beschäftigen die Flottenangehörigen Absurditäten der Etikette, Staub-Inspektionen und der Stress, den eine geänderte Befehlskette verursacht, nachdem sich ein Mord ereignet hat. Fragen von Ordnung und Disziplin stehen hier fast so sehr im Vordergrund wie in David Feintuchs erfolgreicher Romanserie um den Aufstieg des "Nick Seafort". Ganz ähnlich wie bei Feintuch lernen wir auch bei Williams einen bizarren Mikrokosmos kennen: Ungeachtet vereinzelter Angriffe, die routinemäßig abgespult werden, dümpelt die Flotte, die monatelang keinen Kontakt zu den Zentren der Macht hat, wie ein mobiler Restbestand des alten Imperiums, an dem sich die Zeit vorbeigedreht hat, durch das Nichts.
Währenddessen steht Sula bzw. die Frau, die sich Caroline Sula nannte, an der Spitze des letzten Partisanentrüppchens auf Zanshaa und entdeckt ihr Talent dafür, eine globale Widerstandsbewegung aus dem Boden zu stampfen. "Menschliche Wärme ist nicht gerade mein Spezialgebiet" wird zu ihrem Stehsatz - vor einem Hintergrund von Sippenhaft und Massenerschießungen von Geiseln kein Wunder. Wenn sich die Galionsfigur des Widerstands schließlich auf der Suche nach Verbündeten an Unterwelt-Kreise wendet und mit einem zwielichtigen Ganoven eine Beziehung eingeht, kehrt sie ironischerweise dahin zurück, woher sie ursprünglich stammt: Symbolträchtig nimmt sie just ihren panisch geheimgehaltenen wahren Namen als "Tarnidentität" für Kampfeinsätze an. Zumindest dieser Kreis schließt sich also - ob auch die gesamte Riesensaga hier zu einem runden Ende gebracht wird, muss jede/r für sich selbst entscheiden.
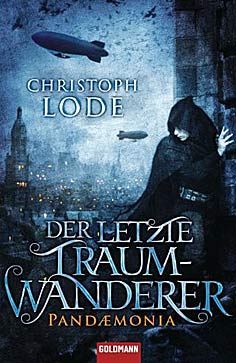
Christoph Lode: "Der letzte Traumwanderer"
Broschiert, 381 Seiten, € 12,40, Goldmann 2010.
Christoph Lode dürfte dem einen oder der anderen als Verfasser historischer Romane ("Der Gesandte des Papstes") bekannt sein. Und auch in seiner neuen Fantasy-Reihe "Pandæmonia" wollte der deutsche Autor auf geschichtliche Abläufe nicht verzichten. Das gilt zum einen auf globaler Ebene, auf der die Magie allmählich der Mechanik Platz macht, zum anderen auch in der Tagespolitik. Denn in der Stadtrepublik Bradost, die den Schauplatz von "Der letzte Traumwanderer" bildet, hat man sich erst nach und nach daran gewöhnt, dass die gestrenge Lady Sarka die Macht an sich gerissen hat. Überwachung, Geheimpolizei, Streiks und Unmutsbekundungen der Bevölkerung kommen hier ebenso vor wie märchenhafte Elemente.
Bradost lernen wir aus zwei Perspektiven kennen. Dem verstoßenen Alb Lucien, der den Auszug seines Volkes aus der Nachbarschaft der Menschheit miterlebt, präsentiert sich die Stadt von ihrer Schokoladenseite. Im größten denkbaren Kontrast zu Luciens Panoramablick über Dächer und Türme steigen wir tief in den Unterbauch der Metropole hinab, wo der jugendliche Schlammtaucher Jackon Recycelbares aus der Kanalisation fischt. Seine Slum-Nachbarn mobben ihn, weil er sich nachts angeblich in ihren Träumen herumtreibe - und so wird Lady Sarka auf ihn aufmerksam und will ihn als Traumwanderer in ihre Gefolgschaft aufnehmen, zu der schon einige Wesen mit den Eigenschaften eines Superhelden-Teams gehören. Respektive Superschurken ... das bleibt vorerst einmal offen.
Die zweite jugendliche Hauptfigur, Liam Satander, stammt als Sohn eines Blitzhändlers aus der Mittelschicht. Blitze einzufangen, um damit die Aether-betriebene Industrialisierung Bradosts mit Energie zu versorgen, ist ein bedeutender Job, doch schupft ihn Liam mittlerweile im Alleingang, weil sein Vater andere Sorgen hat. Als dieser von der Geheimpolizei ermordet wird, erfährt sein Sohn, dass er einer Widerstandsgruppe angehörte - und mit seinen letzten Worten trägt er Liam auf, ein mysteriöses Buch aus dem Haus der Lady zu beschaffen. In diesem Haus, in dem die beiden jungen Hauptfiguren aufeinander treffen, werden dann wie im Märchen jede Menge verbotene Türen geöffnet. Die stofflichen führen Liam beim nächtlichen Herumschleichen in Räume, für die man in Wien die Nationalbibliothek und das Elektropathologische Museum hintereinander besuchen müsste ... doch da sind auch metaphorische Türen, die Jackon unter Anleitung der Lady zu durchschreiten hat, um das luzide Träumen zu erlernen. Die sympathischen Protagonisten scheinen fortan unterschiedliche Wege einzuschlagen: Während Liam feststellen muss, dass er nicht einmal die Mörder seines Vaters töten kann, entdeckt Jackon, dass ihm die Macht des Traumwanderns Spaß zu machen beginnt. Hans Christian Andersens "Schneekönigin", C. S. Lewis' Hexe Jadis in "Narnia" oder Michael Endes Zauberin Xayide aus der "Unendlichen Geschichte": Die alte Verführerin hat mit Sarka einen neuen Namen angenommen.
Generell bezieht sich Lode wie andere AutorInnen vor ihm immer wieder auf Märchenmotive und nicht zuletzt auf die große europäische Meta-Saga vom Verschwinden der Magie aus der Welt. Wo bei Tolkien die Elben in den Westen gehen, ziehen sich hier die nächtlichen Alben aus der Welt der Menschen zurück - und bis auf wenige Ausnahmen, die verschiedensten europäischen Sagenkreisen entstammen, auch alle anderen Schattenwesen. "Sieh dich doch um: überall Eisen, Städte und Lärm. Die Welt gehört jetzt den Menschen und ihren Maschinen. Darin ist kein Platz mehr für Magie und Geheimnisse." - "Die Welt hat sich immer verändert." - "Aber noch nie so schnell." Vielleicht hätte der Aspekt sogar noch ein wenig stärker herausgearbeitet werden können, er gibt - direkt miterlebt wie der Abzug der Alben oder erinnert wie der letzte Flug des Phönix über der Stadt - einige der schönsten Bilder des Romans ab.
Man könnte auch von magischem Artenverlust sprechen - und eine ökologisch anmutende Seite hat auch die Beschreibung der Sphäre, in der die Alben bis vor kurzem gelebt und die Träume der Menschen verwaltet haben. Zum einen präsentiert sich dieses Kontinuum als endlose Stadt aus Seelenhäusern, zum anderen aber beinhaltet sie ein wie dem Karbon entsprungenes metaphysisches Ökosystem von schwammartigen Traumsammlern und insektenhaften Traumboten. Auch hier wird der Wandel der Welt seine Spuren hinterlassen ... da kommt schon so einiges an Deutbarkeit zusammen. - Und das alles eingebettet in ein Setting, das an der Grenze von Fantasy und Steampunk nichts auslässt, was man so gemeinhin mit dem 19. Jahrhundert verbinden will: Gaslaternen und Walfänger, Opiumsüchtige und Absinth, Dickens'sches Elend und soziale Unruhen; als Highlight auch ein Luftschiff-Angriff auf eine Gartenparty, das hat Stil! Und nicht zu vergessen das emsige Vorantreiben technischen Fortschritts, der als Gegenmodell zur veralteten Magie angesehen wird ... mit dem Kniff allerdings, dass ganz wie in Greg Keyes' "Bund der Alchemisten" Aetherproduktion, Alchymie und mechanische Wesen aller Art einer Wissenschaft entsprungen sind, die mit der unseren nichts zu tun hat. - Das ergibt in Summe einen originellen Auftakt einer Trilogie für alle Altersgruppen, und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, darf sich freuen: Noch im Februar wird mit "Die Stadt der Seelen" der zweite "Pandæmonia"-Band erscheinen.

Rob Grant: "Volle Kraft zurück"
Broschiert, 383 Seiten, € 8,30, Blanvalet 2010.
"... ein Ende der haarsträubend komischen Saga ist noch lange nicht in Sicht", heißt es im Klappentext von "Volle Kraft zurück" (im Original als "Backwards" 1996 erschienen). Nun, das mag für die britische Weltall-Sitcom "Red Dwarf" gelten, in deren Franchise die Autoren Rob Grant und Doug Naylor ihre Romane geschrieben haben, doch auf dem Buchmarkt kann man das Ende schon ganz gut ausmachen: Mehr als vier Romane gab es nie, und die stammen aus der Mitte der 90er. "Volle Kraft zurück" war auch deshalb interessant, weil das Duo hier nicht mehr zusammengearbeitet hat - statt dessen schrieb Naylor seine Fortsetzung des bisher Geschehenen (hier die Nachlese) und Grant eine andere. Seine Danksagung an den ehemaligen Kollegen klingt auch nur halb so herzlich, wie's ginge.
Auch wenn "Volle Kraft zurück" nicht einfach die Handlung mehrerer "Red Dwarf"-Folgen zusammenstöpselt, sondern einige im TV gelaufene Plots frei in etwas Neues einbaut, ist es beim System geblieben, dass sich der Roman aus vier unterschiedlichen Handlungssträngen zusammensetzt. Die Art und Weise der Verbindung jedoch ist neu: Und zwar lernen wir in einigen Kapiteln, die über die gesamte Buchlänge und die drei anderen Episoden verstreut sind, Ace Rimmer kennen, das aus einem Paralleluniversum stammende Alter Ego Arnold Rimmers, der sich längst zur heimlichen Hauptfigur gemausert hat. Ace ist alles das, was Arnold weder zu Lebzeiten war noch in seiner jetzigen Daseinsform als Hologramm ist: Charmant, souverän, selbstlos und allseits respektiert. Die Schilderungen des schwierigen Rimmerschen Heranwachsens - und insbesondere das des Versager-Kinds Arnold - sind übrigens alles andere als lustig; die unerwartete Ernsthaftigkeit tut der Geschichte als Ganzes jedoch gut.
Zwei weitere Episoden drehen sich zum einen um die Erlebnisse in einem virtuellen Wildwest-Kaff (aufbauend auf die TV-Episode "Gunmen of the Apocalypse", die auch Doug Naylor aufgegriffen hat), zum anderen um den Kampf gegen autonom gewordene Roboter, die sich blutdürstig und mit einem Instrumentarium, das den Albträumen eines Urologen entsprungen sein könnte, auf ihre einstigen Herren stürzen. Beide Episoden sind Gag-geladen, aber eher banal - eindeutiges Highlight des Romans ist die titelgebende Handlungsebene, die auf einer alternativen Erde des 20. Jahrhunderts (streng genommen also in logisch nicht nachvollziehbarer Weise weit entfernt von der Handlungszeit) spielt, auf der die Zeit rückwärts läuft.
Auf dieser Erde hat das "Red Dwarf"-Team seinen verstorbenen Kumpel Dave Lister zurückgelassen, damit er unter den hiesigen Umweltbedingungen ins Leben zurückkehren kann - als sie ihn abholen wollen, müssen sie aber erst mal mit den Auswirkungen der Zeitumkehrung fertig werden. Immerhin: Krankenhäuser sind hier Folterstätten, die gesunde Menschen als körperliche Wracks ausspucken, und der Weihnachtsmann ist ein Dreckskerl, der sich durch den Kamin schleicht, um Kindern ihr Lieblingsspielzeug zu stehlen. Grant zieht die auf den Kopf gestellte Kausalität - "Jede Wirkung unentspringt einer Ursache!" - konsequent durch und treibt sie in einer aberwitzigen und rasend komischen Verfolgungsjagd auf die Spitze. Roboter Kryten und das Hologramm Rimmer haben's noch einigermaßen leicht, indem sie einfach ihre Software anpassen. Da steht Kater, einziges organisches Mitglied des Teams, schon vor größeren Herausforderungen: Er hatte es sich gerade bequem gemacht, als etwas Unaussprechliches passierte ... armer Kater! Muss der so sehr auf Stil und Eleganz bedachte Dandy es doch hinnehmen, für den Rest seines Aufenthalts mit dem Hintern Kot aufzusaugen.
Durch die Einführung von Paralleluniversen kann Grant einerseits mit Realitäten spielen, andererseits muss er sich auch keine Gedanken um Kongruenz mit dem Werk seines ehemaligen Kollegen machen. Eine parallele Realität muss auch bemüht werden, um den Schluss zu ermöglichen - eine schwache Deus-ex-machina-Konstruktion, für die Grant jedoch wenig kann: An der Figurenkonstellation, die schließlich an die TV-Serie gebunden bleibt, konnte er nichts ändern ... oder er musste sie eben wie hier durch einen Twist wiederherstellen. Fluch und Segen des Franchise.

Paolo Bacigalupi: "Biokrieg"
Broschiert, 500 Seiten, € 10,30, Heyne 2011.
In der Pause bis zur nächsten Rundschau im März sollte auch die deutschsprachige Ausgabe von Paolo Bacigalupis "The Windup Girl" erscheinen: Mit Sicherheit einer der besten SF-Romane der letzten Jahre, ausgezeichnet sowohl mit Hugo als auch Nebula - beeindruckende Leistung für ein Romandebüt (die ausführliche Besprechung der Originalausgabe finden Sie hier). Anders als einige Kleinverlage bleibt Heyne bei seiner Politik, Romane - völlig unabhängig von der Übersetzung des eigentlichen Texts - mit einem Titel zu versehen, der ganz laut "Science!! Fiction!!!" schreit, damit's auch ja keiner mit etwas anderem verwechseln kann. Im Gegensatz zu Williams' "Letzter Galaxis" hat dieser allerdings tatsächlich etwas mit der Handlung zu tun.
... denn ein Krieg ist es in der Tat, der auf der Erde des 22. Jahrhunderts tobt, auch wenn er primär mit ökonomischen Mitteln ausgetragen wird. In einer Welt, die ihre fossilen Energieressourcen aufgebraucht hat, sind Kalorien die neue Währung: Sowohl in Sachen Energieerzeugung, die nun ganz auf biologische Mittel angewiesen ist, als auch in Sachen Ernährung der Weltbevölkerung. Beides scheint nur noch mit Gentechnik zu bewältigen zu sein - doch genau diese Form der Technik ist es auch, die die Erde in ein ökologisches Chaos gestürzt hat. Tapfer wehrt sich das Königreich Thailand - noch - gegen den Zugriff multinationaler Gentechnik-Konzerne, die auch diese letzte Insel natürlicher Produktionsweisen mit ihren zweifelhaften Produkten überschwemmen wollen. Ein solches "Produkt" ist letztlich auch das künstlich gezüchtete Mädchen Emiko, das "Windup Girl" des Originaltitels. Emiko ist eine von mehreren ProtagonistInnen, die miterleben müssen, wie sich rings um sie langsam, aber unaufhaltsam eine Spirale der Gewalt in Bewegung setzt.
Alle, die vor der englischsprachigen Ausgabe noch zurückgeschreckt sind, sollten jetzt bei der deutschen zuschlagen: Bacigalupi hat einen ebenso beeindruckenden wie schrecklichen Roman geschrieben - dessen schrecklichste Qualität es ist, wie plausibel das geschilderte Szenario wirkt. Im Herbst ist überdies eine Geschichtensammlung erschienen, mit der der Autor seine Welt der nahen Zukunft weiter ausgestaltet hat; die werden wir dann beim nächsten Mal durchnehmen. Mögliche weitere Szenarien der nächsten Rundschau-Ausgabe lauten: Superhelden vs. Zombies, Nazi-"Ubermenschen" vs. Alliierte oder israelischer Geheimdienst vs. monströse Phänomene. Mal sehen. (Josefson)