
Arthur Brehmer (Hrsg.): "Die Welt in 100 Jahren"
Gebundene Ausgabe, 319 Seiten, € 20,40, Olms Verlag 2010.
Am Ende des Jahres ist es ja Tradition Rückschau zu halten. Nachdem sich diese Rubrik der phantastischen Literatur verschrieben hat, soll aber auch das in spezieller Form erfolgen: Nämlich durch einen Blick auf die Dinge, die da hätten kommen können ... bei höchst wechselhaftem Wahrscheinlichkeitsgrad allerdings. 1909/1910 versammelte der Publizist Arthur Brehmer 23 damals prominente AutorInnen und bat sie um Prognosen für "Die Welt in 100 Jahren", also unser Jahr 2010. Der Olms Verlag hat dieses Buch nach Ablauf der Frist nachgedruckt ... und es ist kurz gesagt ein einziges riesiges Vergnügen. Zum einen ergibt sich dieses aus dem Staunen über korrekt vorhergesagte Phänomene unserer Gegenwart (Handys und Tele-Shopping wurden ebenso antizipiert wie Lichtverschmutzung und die Strategie der atomaren Abschreckung). Zum anderen natürlich aus den teilweise spektakulären Fehlschlägen - die umso komischer wirken, weil just die irrigsten Annahmen im unerschütterlichsten Brustton der Überzeugung geäußert wurden. Etwa wenn Charles Dona Edwards über den Sport in unserer Zeit mutmaßte, dass dieser nur noch in der Luft und im Wasser ausgetragen würde, während neuere gegenwärtige Sportarten, die auf der Erdoberfläche getrieben werden, ganz zweifellos als solche verschwinden werden.
AutorInnen utopischer Literatur bleiben stets Kinder ihrer Zeit und neigen zum Überbewerten aktueller Entwicklungen. Elektrizität als Alltagsanwendung war damals noch neu genug, dass man hoffen konnte, ihr Potenzial sei bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Warum also keine "elektrischen Zyklonwellen", mit denen man die Bevölkerungen ganzer Städte auf einen Schlag von sämtlichen Krankheiten heilen könnte? Oder "elektrische Wärmewellen", die den Winter vertreiben? Im Prinzip war dies aber schon damals die Science Fiction von gestern, der eigentliche Hoffnungsträger trug einen anderen Namen: Im Aufsatz "Das Jahrhundert des Radiums" schwärmt der Naturwissenschafter Everard Hustler von einer strahlenden Zukunft. Nicht nur sämtliche Energieprobleme wären mit dem neuentdeckten Wunderstoff für immer gelöst. Gebäude würden mit radioaktiven Anstrichen überzogen, um von selbst zu leuchten und elektrische Lampen überflüssig zu machen. Und so ganz nebenbei könnte das Element dabei auch noch seine "wohltätige Heilwirkung" auf die BewohnerInnen ausüben. Schließlich sei Radium - und da stimmen andere AutorInnen in ihren Beiträgen vollkommen zu - ein unfehlbares Mittel gegen Krebs, gegen Tuberkulose (eine Illustration zeigt einen Radium-Inhalationsapparat) und sogar gegen Blindheit. Ein Zeitalter völliger Krankheitslosigkeit stehe unmittelbar bevor und mit ihm die Vollendung des Menschengeschlechts: Hochgewachsen, schön, gesund, ewig jung ... und glowing in the dark like Madame Curie's lover, wie die Band Algebra Suicide einmal sang.
Eine andere Prognose zur Anwendung der Radioaktivität war da schon realistischer: Sowohl Hustler als auch Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner sahen Waffen voraus, deren Einsatz auf Knopfdruck (!) so schrecklich wäre, dass sie den Weltfrieden geradezu erzwingen würden - also das, was später als "Gleichgewicht des Schreckens" die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägen sollte. Auch wenn 1910 eher an gebündelte Radiumstrahlen als an Atombomben gedacht wurde. - Neben Radium war offenbar die beginnende Luftfahrt der neuste heiße Scheiß jener Tage, mit Auswirkungen auf alle Lebensbereiche: Ein Autor postuliert, dass die Bildhauerei im Gegensatz zur aussterbenden zweidimensionalen Malerei neue Impulse erhalte, weil sämtliche Skulpturen künftig so beschaffen sein müssten, dass sie auch aus der Perspektive von Luftpassagieren was her machten. Und natürlich würde die Luftfahrt - durchaus zutreffend - das Wesen des Krieges für immer verändern. Ein Regierungsrat Rudolf Martin mutmaßt, dass die europäischen Luftschiffe aber nur noch gegen Neger und andere Stämme in Afrika zum Einsatz kämen, denn Europa würde 2010 - Treffer! - längst eine liberale Staatengemeinschaft bilden. So ganz scheint Martin der Gedanke an eine friedliche Koexistenz aber nicht behagt zu haben - das Herz geht ihm erst auf, wenn er in "Der Krieg in 100 Jahren" schildern kann, wie die überlegenen europäischen Luftflotten das aufmüpfige China und Japan in die Unterwürfigkeit zurückbomben.
Das, was man heute eine eurozentristische Perspektive nennen würde, zieht sich durch sämtliche Beiträge. Carl Peters, eine rassistische Galionsfigur des deutschen Kolonialismus, schildert ein fiktives Gespräch deutscher Kolonialherren in Afrika mit einem beinahe hellsichtigen Moment ("Die Welt ist wesentlich englisch geworden.") inmitten eines herrenmenschlichen Wusts ("Allemal, damit gehört sie immerhin einer vornehmen Rasse an."), der nur konkurrierende Imperialmächte zur Kenntnis nimmt, nicht aber einheimische Gesellschaften. Auf harmlosem Gelände, aber doch auch bezeichnend, schwadroniert der österreichische Komponist Wilhelm Kienzl in seinem Beitrag "Die Musik in 100 Jahren" launig-akademisch über Tonsysteme und Chorgrößen - kein Gedanke an etwaige Einflüsse aus anderen Kulturen (und damit zu so etwas wie Jazz, Rock oder HipHop führend). Ganz offensichtlich konnte sich keine/r der AutorInnen auch nur vorstellen, dass die Welt der Zukunft von etwas mitgeprägt sein könnte, das nicht in einem feingeistigen europäischen Salon erdacht (und gesteuert) wurde.
Der in Sachen Treffsicherheit verblüffendste Beitrag stammt von Robert Sloss und heißt "Das drahtlose Jahrhundert". Das Telephon in der Westentasche, so Sloss, wird 2010 jeden mit jedem verbinden: Man stellt bloß die gewünschte Nummer ein, schon vibriert's beim Empfänger - außerdem kann man mit dem kleinen Ding Nachrichten abrufen, Musik hören und Filme ansehen. Man kommt zu Tele-Konferenzen zusammen und ist bei Katastrophen, die sich irgendwo auf der Welt ereignen, stets live dabei: Die ganze Erde wird nur ein einziger Ort sein, in dem wir wohnen. Und das mehr als 50 Jahre, bevor Marshall McLuhan den Begriff vom "Global Village" etablierte! Sauber daneben gelegen hat Sloss nur mit der Vermutung, dass die drahtlos vernetzte Welt den meisten Verbrechen ein Ende machen und ein Jahrhundert der Moralität einläuten werde. (Andere AutorInnen glauben ebenfalls an das Ende der Kriminalität ... nur noch wenige "Enthusiasten" ließen sich 2010 zu Schandtaten hinreißen.) Denn so gut manche Prognosen in Sachen technischer Entwicklung waren, so sehr gerieten die AutorInnen auf dünnes Eis, wenn sie gesellschaftliche Entwicklungen andachten.
Der US-Chemiker Hudson Maxim beispielsweise landet mit Voraussagen zu Telekommunikation, Atomkraft und medial begleiteten Kriegen einige Treffer - seine ebenso naive wie unbarmherzige Vision vom Strafvollzug unserer Tage wurde glücklicherweise aber nicht verwirklicht: Statt in Gefängnisse schiebt man Kriminelle in eine eigene Kolonie ab, in der sich der Abschaum der menschlichen Gesellschaft an Büchereien und Kunstgalerien erfreuen kann - doch erst, nachdem er seiner Fortpflanzungsfähigkeit beraubt wurde, damit das sich forterbende Stigma verbrecherischer Neigungen nicht weiter den Gen-Pool versaut. Wie schnell man doch von philanthropischen zu rassehygienischen Vorstellungen kommt ... Allerdings war Maxim offensichtlich nicht nur in Bezug auf den Volkskörper ein Mann der Rosskuren: So schlägt er beispielsweise vor, dass zur Ausmerzung von Krankheiten am besten der ganze menschliche Körper mit einem Desinfektionsmittel durchgespült werden sollte. Sein Beitrag heißt übrigens "Das 1000-jährige Reich der Maschinen", was damals aber noch eine rein biblische Anspielung war.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Buch im originalen Satz nachgedruckt wurde, was auch bedeutet: in Fraktur! Doch keine Sorge, man gewöhnt sich rasch an die fremd gewordenen Typen und ist nach wenigen Seiten im gewohnten Lesetempo unterwegs. Wäre auch zu schade gewesen, das Layout umzustoßen, in dem der Textkörper mit den Seitenornamenten und vor allem den zahlreichen zwischen Jugendstil und Steampunk angesiedelten Original-Illustrationen Ernst Lübberts eine wunderschön anzuschauende Einheit bildet. Die Bilder reichen von Aeroplanen und "Lufthäusern" bis zu Heimelektronik für jedermann, gewagten Prognosen in Sachen Mode (unter dem Titel "Ein Empfangstag in 100 Jahren" beispielsweise bestaunt man die typische Damenfrisur des Jahres 2010, für die man die Bienenkörbe von Kate Pierson, Amy Winehouse und Patsy Stone übereinanderstapeln müsste) sowie allegorischen Darstellungen. Besonders bezaubernd das Sujet "Die Liebe der Zukunft beruht einzig und allein auf den radioaktiven Sympathiestrahlen der Seele und des Herzens".
Durch die Bank sind die AutorInnen davon überzeugt, dass sich im Zuge des rasanten technischen Wandels die Weiter- und Höherentwicklung des Menschen wie von selbst ergeben wird. Auch physisch: Offensichtlich war damals gerade die These im Umlauf, dass die Menschen seit dem späten 19. Jahrhundert ein weiteres Farbspektrum wahrnehmen könnten als ihre Vorfahren in weniger gebildeten Zeiten - nur logisch also die Extrapolation, dass das menschliche Auge in unserer Zeit auch Röntgenstrahlen sehen würde. Vor allem aber schreite unsere ethische Entwicklung unaufhaltsam in Richtung Göttlichkeit voran. Da liest sich der satirische Beitrag "Die Frau in 100 Jahren" der schwedischen Schriftstellerin Ellen Key umso erfrischender: Mit Elan entwirft sie eine dystopische Brave New World, in der man eine Impfung gegen Originalität und Individualitätssucht erhält, und in der die Kinder in Heimen lernen, "nach neuen Methoden Zähne zu bekommen" ... um schließlich zum entscheidenden Punkt zu gelangen: Nämlich dass vor jedem Fortschrittsoptimismus erst mal definiert werden müsse, was Lebensqualität bedeutet. Für die meisten ihrer Ko-AutorInnen scheint das eine klare Sache gewesen zu sein: Es geht vorwärts, aufwärts mit der Menschheit; alles wird besser, das Leben schöner, leichter, länger. Notfalls mit Gewalt.
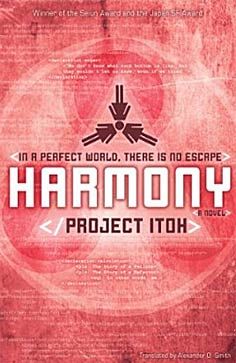
Project Itoh: "Harmony"
Broschiert, 252 Seiten, Haikasoru/VIZ Media 2010.
Eine Dystopie in Pastelltönen, und deshalb eine umso schrecklichere, hinterließ der japanische Autor Keikaku "Project" Itoh als sein letztes Vermächtnis. Itoh war zur Zeit der Fertigstellung von "Harmony" bereits schwer krank und starb 2009, im Jahr nach der japanischen Erstveröffentlichung; heuer ist auch eine englischsprachige Ausgabe des Romans erschienen. Es fällt allzu leicht anzunehmen, dass Itohs persönlicher Zustand wesentlichen Einfluss auf die Erzählung genommen hat. Doch wie sich dies äußert - in Form der Schilderung eines alle Menschlichkeit erstickenden Gesundheitsdiktates - demonstriert eindringlich, dass niemand glauben soll, die Gefühle eines hilflos an die wohlwollende Lebenserhaltungsmaschinerie ausgelieferten Menschen nachvollziehen zu können.
Jahrzehnte nach dem Maelstrom - dem Einsatz von Atomwaffen und dem Wüten globaler Epidemien durch mutierte Krankheitserreger - hat sich die Welt wieder erholt und aus der einstigen Barbarei eine radikale Lehre gezogen. Individuelle Gesundheit wird inzwischen als öffentliche Angelegenheit betrachtet und der menschliche Körper als wertvolle Ressource, die es um jeden Preis zu bewahren gilt. Deutschsprachige LeserInnen werden nun unwillkürlich an Juli Zehs 2009 erschienenen Roman "Corpus Delicti" denken, und tatsächlich weisen die beiden Bücher einige deutliche Parallelen auf. Zeh allerdings entwarf ein eher abstraktes Szenario - wohl auch, um von der Gegenwart und deren im Roman kritisierten Tendenzen nicht zu weit abrücken zu müssen. Itoh hingegen hat wirklich Science Fiction geschrieben und die Welt des Jahres 2060 in allen Details ausgearbeitet. Einige Neologismen spielen dabei eine Schlüsselrolle: Statt Regierungen regeln nun admedistrations die Gesellschaft; die von ihnen konsequent durchgesetzte Politik, die Erhaltung der menschlichen Gesundheit über alles andere zu stellen, ist der lifeism. Praktisch umsetzen lässt sich dies durch die nanotechnologischen medicules, mit denen der Körper geflutet wird und die zugleich ein WatchMe genanntes, rund um die Uhr laufendes Monitoring-Programm fahren.
Auch bei Zeh ging es um die Angst vor immer weiter reichender Fremdbestimmung der (einstmals) höchstpersönlichen Lebensführung - Itoh spricht sogar explizit vom "Outsourcing von Entscheidungen". Das Nano-Programm ist nur ein Teil davon: Man lässt sich von einem lifestyle pattern designer das optimale Verhalten zusammenstellen, trifft sich zwecks Abgleichung in Diskussionsgruppen und trägt außerdem ständig - per Augmented Reality für jeden sichtbar - sämtliche Metadaten über seinen Gesundheits- und Sozialstatus mit sich herum. Es ist ein System der alle Ebenen durchdringenden wechselseitigen Kontrolle, ausgeübt von freundlichen, rücksichtsvollen, gruppenbewussten Menschen. Oder wie es eine der Hauptfiguren ausdrückt: "It's like we're all one another's pets." Einen Schönheitsmakel hat das System aber doch: nämlich eine ständig steigende Suizidrate. Drei Teenagerinnen - Miach Mihie, Cian Reikado und die Ich-Erzählerin Tuan Kirie - schließen einen Selbstmordpakt. Ganz im Sinne von "Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann", wie es bei Zeh heißt, sehen sie den einzig möglichen Akt der Auflehnung darin, ihren Körper der Enteignung zu entziehen. So trotzig und rührend wie die hilflose Revolte selbst auch ihr Schlachtruf: "We'll whisper it at the top of our lungs!"
Doch wie der zwischen zwei Zeitebenen wechselnde Roman von Anfang an klar macht, wird der Plan fehlschlagen. Tuan und Cian überleben - letztere führt künftig ein angepasstes Leben, Tuan hingegen übernimmt insgeheim immer stärker die Positionen Miachs, die einst die charismatische Ideologin des Trios dargestellt hatte. Nach außen hin scheint die erwachsene Tuan als Agentin der WHO selbst zur Proponentin des verhassten Systems geworden zu sein. In Wahrheit nutzt sie ihre Einsätze in den letzten Krisengebieten der Welt dafür, überall dort nach Herzenslust zu rauchen und zu saufen, wo noch keine WatchMe-Server installiert werden konnten. Dabei lernen wir auch ein wenig von den Resten des wilden, echten, unkontrollierten Lebens auf Erden kennen, klettern mit einer robotischen Bergziege durch die Berge Tschetscheniens oder treffen in der zum Sonnenblumenmeer gewordenen Sahara auf Tuareg-Nomaden ... doch Itoh verweigert die Zeichnung dieser Außenwelt als Idylle: Die Tuareg führen ebenso wie die Tschetschenen einen Partisanenkrieg, die Roboter-Ziege hat ein MG auf dem Rücken montiert und die gentechnisch veränderten Sonnenblumen sollen nuklearen Fallout aus dem Boden ziehen.
Von derlei Lebensbedrohlichem scheinen die 80 Prozent der Menschheit, die in der Obhut von admedistrations leben, weit entfernt - bis eines Tages, offenbar ferngesteuert, tausende Menschen weltweit simultan Selbstmord begehen. Es folgt eine schockierende öffentliche Verlautbarung, mit der die Bevölkerung vor die grausamste vorstellbare Wahl gestellt wird - ein Motiv, das aus Literatur und Film wohlbekannt ist, doch nun, weil jeden einzelnen Menschen betreffend, zum ultimativen Schrecken wird. Zumindest was die eigentliche Handlung betrifft - noch länger werden vermutlich die philosophischen Betrachtungen nachwirken, die Itoh in die Erzählung einfließen lässt. "Harmony" ist ein beeindruckendes, aber auch ein ungemütliches Buch. Und speziell zu der Conclusio, die der Autor seine Figuren aus Erkenntnissen der Gehirn- und der Evolutionsforschung ableiten lässt, werden ihm viele LeserInnen sicher nicht folgen wollen: Nämlich dass der Mensch als Ganzes vielleicht doch nicht mehr ist als die Summe seiner Teile.

Karla Schmidt (Hrsg.): "Hinterland"
Broschiert, 383 Seiten, € 15,40, Wurdack 2010.
Die gerade in der Science Fiction aufgekommene Buchmode, in den Danksagungen anzugeben, welche Musik während des Schreibens gehört wurde, betrachte ich eher mit Skepsis. In den allermeisten Fällen führen die stolzen Verweise - je nach AutorInnengeneration - entweder zu blähsüchtigem Art-Rock aus den 70ern oder zu mäßig originellen Industrial-Crossovers aus den 90ern; vielleicht könnte man sich zu spannenderer Musik ja auch nicht mehr aufs Tippen konzentrieren. - Bei der Anthologie "Hinterland" (Untertitel: "20 Erzählungen inspiriert von der Musik David Bowies") sah das zum Glück anders aus, da sollten die Songs nicht untermalen, sondern selbst zum Anstoß für eine SF-Geschichte werden. Unter den AutorInnen, die großteils bereits durch Romane und Anthologie-Beiträge bekannt sind und für dieses "Konzeptalbum" zur Hochform auflaufen, befinden sich offensichtlich auch einige ausgemachte Fans respektive ExpertInnen. Erkennbar nicht zuletzt daran, dass so gut wie gar nicht auf die Songs mit offensichtlichem Bezug zurückgegriffen wurde ("Space Oddity", "Starman", "Ziggy Stardust" und was nicht gar), sondern auf durchaus weniger Geläufiges. Unter anderem auch aus den Jahren, als Bowie nicht mehr in jedermanns Tracklist vertreten war.
Der Titel der Anthologie ist dem 1979er Song "Red Sails" entnommen und steht für das Unterbewusstsein - wie es im Vorwort heißt: der einzige Ort, der wirklich eine Reise lohnt. Entsprechend surreal gestaltet sich der Auftakt, das mit beeindruckenden Bildern prunkende "Purgatorium" von Dirk Röse: In nicht allzu ferner Zukunft hat das Jüngste Gericht doch noch stattgefunden; doch nicht als Prüfung, sondern als Angebot. Röse schildert die modrige, freudlose Welt derer, die das Angebot abgelehnt haben - während am Himmel die Helle Welt so buchstäbliche Anziehungskraft entfaltet, dass die der Menschen auf dem Kopf steht. - Das Ding von vorgestern und keinen Cent mehr wert wäre Surrealimus hingegen in der bizarren Parallelwelt von Markolf Hoffmanns "Triptychon": In einem Großbritannien, dessen neuer Premierminister Damien Hirst heißt, untersucht die "Art Crime Agency" Verbrechen nur noch auf ihren künstlerischen Wert hin. Die Kunst- hat die Finanzwelt von den Schalthebeln der Macht verdrängt, das Resultat ist noch zynischer als der Zustand davor. - Seinen x-ten Weg, mit herkömmlicher Erzähllogik zu brechen, hat indessen der überaus produktive Dietmar Dath ("Die Abschaffung der Arten") gefunden: In "Solus ipse, leerer Drache" schildert er eine brisante Personenkonstellation aus der Warte eines nicht-existierenden Ich-Erzählers. Was sich viel rasanter liest, als es jetzt vielleicht klingt.
Ein gelungenes Autorendebüt legt der Musiker mit dem bemerkenswerten Pseudonym Pepe Metropolis mit der Titelgeschichte der Anthologie hin, "Hinterland" führt dabei auf eine durchaus auch räumliche Reise: Die Expedition, die hier im Auftrag einer wissenschaftlichen Gesellschaft in den Pazifik tuckert, startet zwar im Jahr 2064, könnte den Umgangsformen und der Verwendung Steampunk-artiger Gerätschaften nach aber auch zwei Jahrhunderte früher angesiedelt sein; nicht zuletzt auch weil Naturwissenschaft und Metaphysik hier noch sehr freien Umgang pflegen. Wenn es um die Stellung des Menschen in der Welt als zentrale Frage geht, wird man daher sowohl auf ein "Weißes Licht" als auch auf eine allumfassende Super-DNA stoßen. - Fernab jeder Esoterik und doch über die messbare Realität hinausgehend die Erlebnisse einer Gruppe von Space-Marines, die in Tobias Lagemanns "P.O.S." einen zur Terraformierung vorgesehenen Planeten militärisch sichern sollen und sich dabei einem unsichtbaren Feind zu stellen haben. Könnte neben David Bowie auch von "Alien 2" inspiriert sein - ist aber auch deswegen bemerkenswert, weil der Autor mit einer eigentlich verpönten Art von Schlusspointe gerade noch mal die Kurve kratzt.
Die Herausforderungen, denen sich die jeweiligen ProtagonistInnen der 20 Erzählungen stellen müssen, sind höchst unterschiedlicher Art: Aleksandr Voinov setzt in "Nicht Amerika" einen US-Amerikaner in einer Invasion völlig beißunwilliger europäischer Zombies ab, Ernst-Eberhard Manski schickt in "Der Saxophonist vom Rathaus Neukölln" einen interstellaren Bildungstouristen in seinen Berliner Kiez zurück, Tobias Bachmann lässt in "Die letzte Telefonzelle" einen Agenten im Zwiegespräch mit einem intelligent gewordenen Münztelefon an seinem Verstand zweifeln und "Alles bleibt anders"-Autor Siegfried Langer vergönnt in "Berlin, Nachklang" Bowie selbst ein letztes Dacapo. Die Muse der Anthologie taucht in den einzelnen Episoden übrigens in höchst unterschiedlicher Form auf: Von expliziten Songzitaten über frei assoziiertes Weiterspinnen von Ideen und Bildern aus Bowie-Songs bis hin zum Auftritt eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Ein paar AutorInnen scheinen auch mit dem Bowie-Aspekt leichter zurechtzukommen als mit dem (noch) ungewohnten Genre, tragen in ihren Geschichten, die von schwulen Ninjas bis zu Unterwasser-Ressourcenkämpfen alles mögliche potenziell Interessante abhandeln, allzu dick auf und landen - vermutlich ungewollt - im Pulp. Mit Vorsatz hat sich dagegen Jakob Schmidt auf diese Literaturform gestürzt und nimmt in "Die betrübte Strahlenkanone" unter anderem Geek-Träume von sexy SuperheldInnen aufs Korn. Im Mittelpunkt steht eine Knarre, die a) ein moralisches Empfinden hat und b) das Pech, in der Hand von Zarvora der Erbarmungslosen zu liegen ...
Nun zu drei Geschichten mit zwei Gemeinsamkeiten: Sie alle schildern in atmosphärisch dichter Weise eine Welt der unmittelbaren Zukunft, die in ihren Ressourcen und Möglichkeiten geringer geworden ist - und sie böten sich als guter Ausgangspunkt für längere Erzählungen an. In Barbara Streuns "On Idle" schlägt sich die allgemeine Niedergangsstimmung auch auf das persönliche Leben eines Ex-Studenten nieder, den nun nur noch Botengänge mit seiner ehemaligen Uni verbinden - unter anderem für eine illegale Glühbirnen-Manufaktur. Doch während Streun den Versuch einer Zeit-Korrektur als möglichen Hoffnungsschimmer aufblitzen lässt, kann in "Kamera(d), Action!" von Nadine Boos alles höchstens noch schlimmer werden. Hier wird einerseits ein Journalist mit einem waffengeilen Soldaten konfrontiert, der sich vor seiner Kamera produziert, während nicht weit davon entfernt die VertreterInnen zweier antagonistischer politischer Systeme Verhandlungen aufnehmen: Die Mediendemokratie des hungernden Europa trifft dabei auf die immer noch im Überfluss lebenden USA, die - stellvertretend für viele und insbesondere europäische SF-Szenarios der Gegenwart - zum fundamentalistischen Christenstaat verkommen sind. Anthologie-Herausgeberin Karla Schmidt schließlich kehrt mit "Erlösungsdeadline" in die Welt zurück, die sie zuvor bereits in der Kurzgeschichte "Lebenslichter" entworfen hatte, es gibt sogar ein Wiedersehen mit der subversiven "guten Fee" Véronique. Hier versucht sie einem 80-Jährigen zu helfen, der aus dem Altersheim ausgebüxt ist, um seine verschwundene Enkelin zu finden. All das vor dem Hintergrund einer neuentstehenden mysteriösen Bewegung, die den Menschen Erlösung bis zu einer fixen Deadline im Jahr 2032 verspricht. Zur Atmosphäre gesellt sich nun also auch ein Spannungselement - wird Zeit, das Ganze zu einem Roman auszuarbeiten!
In den vergangenen Jahren habe ich eine Reihe deutschsprachiger SF-Anthologien gelesen - "Hinterland" ist eine überdurchschnittlich gute geworden. Ein letztes Highlight hab ich mir noch für den Schluss aufgehoben: "Vilm"-Autor Karsten Kruschel begibt sich in der bitterbösen Satire "Vierte und Erste Sinfonie oder: Müllerbrot" stilistisch auf die Spuren von Johanna und Günter Braun ... und inhaltlich auf die der Aktivistengruppe The Yes Men. Wortgewaltig und hochkomisch wird hier schockstarren JournalistInnen vorgeführt, wie der Weltwohltäter das Problem des globalen Hungers endgültig gelöst hat. Bei manchen werden jetzt vielleicht unwillkürlich die Worte "Soylent Green" im Hinterkopf aufleuchten - doch lasst euch gesagt sein: Es geht sogar noch scheußlicher.
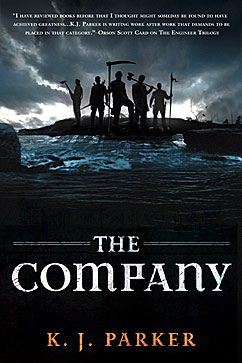
K. J. Parker: "The Company"
Broschiert, 425 Seiten, Orbit 2009.
Fünf Männer Ende 30, die eine große gemeinsame Vergangenheit hatten und dann getrennte Wege gingen, wollen's noch einmal krachen lassen, nachdem derjenige unter ihnen, der den größten Erfolg hatte, zu den anderen zurückgekehrt ist. Klingt nach der Wiedervereinigung von Take That, dreht sich aber nicht nur um Geld, sondern auch um Mord und Totschlag - und die Hoffnung, dass man doch noch irgendwie mit allem ins Reine kommen werde. Teuche Kunessin, Thouridos Alces, Aidi Proiapsen, Kudei Gaeon und Muri Achaiois sind die Namen von fünf Kriegsveteranen, die den Neustart in ihrer eigenen Kleinkolonie wagen wollen - auf der verlassenen Insel Sphoe, die einst einen Militärstützpunkt trug und nach dem letzten Krieg kurzerhand von General Kunessin "unterschlagen" wurde, ehe er in den Ruhestand trat.
Ist's automatisch Fantasy, wenn ein Roman in einer fiktiven Welt handelt, die sich auf einem technisch vormodernen Stand befindet? Gängige Plot-Strukturen sucht man bei K. J. Parkers hervorragendem Roman "The Company" jedenfalls ebenso vergeblich wie Magie oder nichtmenschliche Intelligenzwesen vulgo "Völker". Und auch die quasi-zeitliche Einordnung fällt gar nicht so leicht: Dem Stand der Waffentechnik nach befinden wir uns in einer Zeit, die jeder unserer Epochen von der Antike bis zur Renaissance entsprechen könnte. Das vertrüge sich durchaus auch mit dem hier geschilderten Bankenwesen, auch wenn dies auf den ersten Blick als ebenso modernes Element erscheint wie die weiters erwähnten Warendepots und Fälscherwerkstätten. Modern im Sinne unserer Zeitlinie wirkt jedenfalls die völlige Absenz jeglicher Religion im Leben der ProtagonistInnen - und mehr noch die Selbstverständlichkeit, Gesellschaftssysteme nicht als gott- oder sonstwie gegeben anzusehen. Bezeichnend, wenn sich Kunessin von der Frau, die er als seine Insel-Begleiterin gewählt hat, sagen lassen muss, dass es not a model society sei, was er da aufzubauen gedenke. Und natürlich ist der ganze Plot - eine trotz hohen Blutflusses vor allem auf Psychologie setzende Aussteigergeschichte von Männern in der Midlife Crisis - nicht der Stoff, aus dem "in alten mæren wunders vil geseit" ist.
Die Perspektiven auf den Krieg sind entsprechend: Es ist kein heroischer Kampf von Gut gegen Böse, der Krieg bleibt völlig abstrakt und ohne jede Bedeutung für die Bevölkerung - außer der einzig relevanten, nämlich dass immer wieder ohne Vorwarnung die völlige Verwüstung über Dörfer und ganze Regionen hereinbricht, egal auf welcher Seite. Gefochten wird einfach nur gegen "den Feind" - nicht einmal über das eigene Land und dessen Herrschaft erfahren wir irgendetwas; ja, nicht einmal dessen Namen. Die in Rückblenden geschilderten Kampfhandlungen selbst, in denen sich unsere fünf (bzw. ursprünglich sechs) als linebreakers stets an vorderster Stelle in die Schlacht schmissen, sind ein grimmiger Albtraum aus Blut, Schlamm und zwischendurch sehr viel Warten. Weder werden die Taten der A Company beschönigt, noch aber werden die Soldaten als Opfer des Systems dargestellt. Die gerechte Verteilung von Kriegsbeute und welche Form von wirtschaftlicher Körperschaft unsere Protagonisten dafür schon auf dem Feld bilden müssen, beschäftigt sie fast noch mehr als der eigentliche Kampf. Bezeichnend auch die allererste Passage, in der auf den Krieg eingegangen wird und die zugleich die Keimzelle für alle weiteren Geschehnisse bilden wird: Auf dem Feld eines Bauern stapeln sich nach einer Schlacht so viele tote Soldaten, dass die Leichen beim besten Willen nicht fortgeschafft werden können, das Feld aufgegeben werden muss und die Bauernfamilie ihren Lebensunterhalt verliert. Nüchterner kann es nicht mehr gehen.
Viele Jahre sind seitdem vergangen, unsere fünf aber tragen den Krieg immer noch in sich. As long as A Company was still alive and together, the war could never end, heißt es an einer Stelle, und so ist es auch. Jede Alltagssituation wird in Kriegsvokabular ausgedrückt, jede Bewegung und jedes Gespräch folgen einer Taktik, jede Herzlosigkeit scheint durch ihren Zweck gerechtfertigt - bis hin zum furiosen Finale des Romans. Von Anfang an scheint es mehr als fraglich, dass wir auf ein Happy End zusteuern könnten, soviele Lügen und Geheimnisse nehmen die ProtagonistInnen mit auf die Insel. Der am Cover platzierte Verweis auf "Lost" hat schon seine Berechtigung, denn die zahlreichen Rückblenden geben Einblick in die geheimen Vorgeschichten der Beteiligten: So hat eine der Figuren systematischen Betrug an den anderen begangen, eine Verrat - und eine ist voll und ganz psychopathisch. Nichts davon wird die Erfolgsaussichten des sozialen Experiments erhöhen, dessen Grundanlage Aidi schon vorab mit zweifelhaften Worten beschrieb: "I always reckon getting well away from who you really are is one of the key elements of happiness in this world."
"The Company" ist ein ausgesprochen intelligentes Buch, und das nicht nur wegen einiger gebildeter Anspielungen (z.B. trägt Muris Auserwählte den Namen Menin Aeide, was die Worte sind, mit denen Homers "Ilias" beginnt - zugleich darf man dies getrost als blutiges Omen deuten). Zynismus spielt darin ein große Rolle. Meistens äußert sich dieser in der nüchternen Darstellung zynischer Verhältnisse: So wie einst die persönlichen Kriegsgewinne kalkuliert wurden, so rechnet man nach einem überraschenden Goldfund durch, ob die auf die Insel mitgeschleppten Dienstboten als lästige Zeugen getötet werden oder doch besser beim Schürfen helfen sollen. Und in exakt derselben herzlosen Weise lief zuvor die logistische Planung der Koloniegründung ab - inklusive des Faktors Fortpflanzungsnotwendigkeit: Nur einer der fünf Männer war verheiratet, die übrigen mussten erst mal durchbesprechen, wo sie sich auf die Schnelle willige Partnerinnen organisieren könnten. Kunessins Angetraute sieht sich selbst daher lapidar als "Zuchtsau". - Das alles ist schlimm genug, nur selten legt die Autorin noch mal ein kommentierendes Extra-Schäuferl Zynismus drauf: Etwa wenn sich die fünf in einer Taverne treffen, die in krassem Gegensatz zur Darstellung des Krieges im Roman den Namen "Glory of Heroes" trägt. Oder wenn die vier Neo-Bräute im selben Wagen zur Sammelhochzeit angerollt kommen, mit dem werktags tote Kühe in die Abdeckerei gekarrt werden.
So enthält der Roman neben all den deprimierenden Einblicken in die menschliche Psyche sogar ein Quantum Witz. Aber es ist ja auch das Kennzeichen einer intelligenten Geschichte, dass darin jede/r etwas für sich entdecken kann. Ein Gräuel dürfte "The Company" nur für alle diejenigen sein, die einen Fantasy-Roman gerne von den Heldenfiguren bevölkert wissen, die sie am liebsten im Spiegel sähen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass ihnen dort jemand wie Muri Achaiois entgegenblickt.

Adam-Troy Castro: "Sturz der Marionetten"
Broschiert, 413 Seiten, € 14,40, Bastei Lübbe 2010.
Zu einem echten Lesegenuss entwickeln sich die Abenteuer der Ermittlerin Andrea ("Man sagte mir, Sie seien eine arrogante, unfreundliche Schlampe." - "So lautet der allgemeine Konsens.") Cort. Im aktuellen Roman, der auf Deutsch schon vor der englischsprachigen Ausgabe "War of the Marionettes" erschienen ist, verschlägt es Andrea auf den Planeten Vlhan - eine derart glutheiße Wüstenhölle, dass man dort glatt eine Fußball-WM veranstalten könnte. Eröffnet wird der Roman mit einer vergnüglichen Variation des "Die Frau und das Monster"-Motivs in Form einer hand- bzw. tentakelgreiflichen Kontaktaufnahme eines Planetariers mit Andrea. Wir wissen ja: Sie präsentiert sich gerne schroff, kommentiert stets sarkastisch und trägt damit - neben der bluttriefenden Action - maßgeblich dazu bei, Adam-Troy Castros aktuellste Romanserie so unterhaltsam zu machen.
Mit den riesenhaften Bewohnern des Planeten, die man sich in etwa wie eine Mischung aus den Schatten von "Babylon 5" und den Tripods aus "War of the Worlds" vorstellen könnte, hat Castro eine wahrhaft fremdartige Lebensform ersonnen. Mehr noch als für ihre Physis gilt dies für ihre Kultur: In regelmäßigen Abständen finden sich die Vlhani zum großen Ballett zusammen, einem tentakelschwingenden Massentanz, der für Menschen überaus faszinierend anzusehen ist - auch wenn er für alle Tänzer stets in einem suizidalen Blutbad endet. "Marionetten" werden die Vlhani deshalb auch genannt, und erst später wird sich zeigen, dass dieser Begriff in mehr als einer Hinsicht zutrifft. Das Ballett jedenfalls wird seit Jahrtausenden aufgeführt und arbeitet offenbar auf ein bestimmtes Ziel hin. Bislang aber haben die Menschen und ihre kosmischen Nachbarn, die ebenfalls Botschaften auf Vlhan eingerichtet haben, nur herausgefunden, dass die "Peitschenchoreografie" der Vlhani eine Informationsübertragung von unnachahmlicher Dichte darstellt. Die Vlhani mögen zwar keine eigene Technologie haben - doch möglicherweise sind sie die intelligenteste organische Lebensform der ganzen Galaxis.
Daraus ist in jüngster Vergangenheit ein Problem erwachsen, denn immer öfter nehmen menschliche Tanzpilger an dem choreografierten Massaker teil, die sich dafür sogar extremsten körperlichen Modifikationen unterziehen und teils kaum noch als Menschen erkennbar sind. Andrea Cort erhält den Auftrag, die Tochter eines Wirtschaftsmagnaten, die irgendwo in den Reihen der Ballett-AnwärterInnen verschwunden ist, ausfindig zu machen. Einmal mehr wird Andrea im Zuge dessen mit ihrem kriminalistischen Gespür persönliche Beziehungsgeflechte und verborgene Wahrheiten aufdecken - doch verblasst dies alles vor der globalen Handlung und den Geheimnissen, die dieser zugrunde liegen. Denn anders als sein Vorgängerroman (hier der Rückblick) ist "Sturz der Marionetten" SF pur. Mit "Die dritte Klaue Gottes" hatte Castro eine astreine Agatha-Christie-Hommage geschrieben; Science Fiction bildete dafür den Hintergrund, doch der war kaum sichtbarer als Europas Schlachtfelder in einer Aufführung von "Wallenstein". Die Handlung des Romans hatte sich zum allergrößten Teil in einem Weltraumfahrstuhl abgespult - genausogut hätte es ein Chalet in den Alpen sein können.
Das sieht in "Sturz der Marionetten" deutlich anders aus: Da jagen wir im festen Griff eines Vlhani auf einem wahren Höllenritt durch die Wüste, landen in einem unterirdischen Frankenstein-Labor, krallen uns an Felswände und sehen bang in den Himmel, wo sich eine Raumflotte zusammenballt, um den Holocaust vorzubereiten. Anlass des bevorstehenden Genozids war ironischerweise ein Akt des Mitleids, nicht umsonst auch "Menschlichkeit" genannt - beim Kontakt mit einer anderen Kultur muss man sich eben darauf einstellen, dass dort andere Regeln gelten können. Dieser Aspekt, mehr noch als die Parade exotischer Schauplätze, macht "Sturz der Marionetten" viel mehr zum SF-Roman als zu einem Krimi.
Castro reicherte den Roman mit einer ganzen Reihe kaputter Typen an, wobei jede "Eigenart" nicht nur um ihrer selbst willen ersonnen wurde, sondern bedeutsame Auswirkungen auf die Handlung hat. Der Botschafter der Menschheit auf Vlhan etwa ist eine hochbrisante Borderline-Persönlichkeit, verweigert das Tragen von Kleidung und würde am liebsten den ganzen Planeten sterilisieren lassen. Tara Fox, Begleiterin des Magnaten, der Andrea engagiert, hat sich sogar in grausamster Weise psychisch verstümmeln lassen: Ein chirurgischer Eingriff hat all ihre Emotionen in ihrem Inneren eingeschlossen - sie werden zwar immer noch in voller Intensität gefühlt, können aber nicht mehr geäußert oder in Handlungen umgesetzt werden. Andrea erscheint Tara als erschreckendes Beispiel dafür, was aus einer schwer traumatisierten Persönlichkeit werden kann, wie ein Blick in den Spiegel - hat sie doch selbst seit ihrer Kindheit mit durchaus realen Dämonen zu kämpfen. "Sturz der Marionetten" dreht sich daher auch wesentlich um Andreas persönliche Entwicklung und ihre Beziehung zu den Porrinyards Oscin und Skye, einem Paar, das zu einer gemeinsamen Persönlichkeit verschmolzen ist. Gelegentlicher Zwei-Partner-in-drei-Körpern-Sex mit Andrea ist ihnen nicht mehr genug. Sie wollen Andrea in ihren geistigen Verbund aufnehmen - nicht zuletzt, um Andrea vor der drohenden Selbstzerstörung zu retten.
Das SF-Programm von Bastei ist maßgeblich von Serien und Zyklen geprägt, da scheint der Vergleich mit einem anderen Produkt des Hauses nur legitim. Tatsächlich weisen Castros Andrea Cort-Romane von der Grundkonstellation her einige verblüffende Parallelen zu den Pip & Flinx-Romanen Alan Dean Fosters auf: Hier wie dort ist ein Mensch als interstellarer Nomade von Planet zu Planet unterwegs, wird vor Ort in brenzlige Situationen verwickelt und klärt sie durch eigenes Vermögen sowie mit der Unterstützung von FreundInnen mit noch erstaunlicheren Kräften, steht dabei im Spannungsfeld kosmischer Mächte und weiß vom Heraufziehen einer Gefahr für die gesamte menschliche Zivilisation. Doch während Fosters vergleichsweise harmlose Abenteuergeschichten langsam doch altbacken und leider auch ein wenig verbraucht wirken, geht's bei Castro in die Vollen. Seine Romane sind frisch und fies und für Erwachsene.
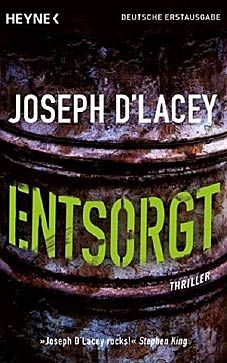
Joseph D'Lacey: "Entsorgt"
Broschiert, 411 Seiten, € 9,30, Heyne 2010.
Joseph D'Lacey ist seinem Konzept des infrastrukturbezogenen Horrors treu geblieben: Im appetitzügelnden Roman "Meat" ging es um die Nahrungsversorgung einer postapokalyptischen Stadt, in "Entsorgt" widmet sich der Brite gewissermaßen der Kehrseite der Medaille. Schauplatz ist eine weitere fiktive, diesmal aber in unserer Gegenwart angesiedelte Stadt: Shreve, irgendwo in England, auf jeden Fall unmittelbar neben einer gigantischen Mülldeponie, in der langsam etwas Neues zum Leben erwacht. Falls D'Lacey dazu auf Umwegen von der Allwissenden Müllhalde der "Fraggles" inspiriert wurde, dann hat diese einige Mutationen durchlaufen, denn sein Geschöpf kennt nur eine Antwort auf alle Fragen: Tod den Menschen! Aber ich will nicht vorgreifen.
Wo denn bei solchem Denken die Menschenliebe bleibe, wundert sich eine Nebenfigur früh im Roman - die Frage dürfte sich nicht nur beim Lesen von "Meat" mitunter aufgedrängt haben, sie stellt sich auch bei der Einführung der Figuren von "Entsorgt". Denn allesamt lernen wir sie in für sie unvorteilhaften Situationen kennen: Die gallebittere Tamsin Doherty kommt gerade von einer Abtreibung und ergeht sich in zynischen Gedanken über ihren Ehemann. In ganz ähnlicher Weise hegt Aggie Smithfield aus tiefstem Teenager-Herzen kommende Verachtung für ihre Familie, während ihr Vater Richard wegen seiner Kinderporno-Sammlung eine plötzliche Panikattacke erleidet. Onlinegame-Junkie und Bummelstudent Ray Wade tut derweil nichts als gegen virtuelle Zombies zu kämpfen (und man kann sich an den Fingern einer Hand abzählen, dass seiner Fertigkeit mit dem virtuellen Schwert noch höchst reale Bedeutung zukommen wird ...). Am sympathischsten - wenn auch reichlich durchgeknallt - wirkt vorerst noch Mason Brand, ein ehemaliger Szene-Fotograf, der vor Jahren ausgestiegen ist und nun eine starke Verbindung zu Mutter Erde fühlt; am liebsten als feuchten Dreck zwischen den Zehen. Verbunden mit dem mehrdeutigen Originaltitel "Garbage Man" könnten angesichts dieser Ansammlung wenig einnehmender Persönlichkeiten Befürchtungen aufkommen, dass der Autor auf fehlgeleitetes Moralisieren aus ist. Das tut er aber zumindest nicht, was die Wertung der einzelnen Charaktere betrifft: Vermeintliche Haupt- werden zu Nebenfiguren und umgekehrt; und auch in der Frage, wer in der anstehenden Invasion der Müllkreaturen als erster stirbt und wer letztlich zu den Überlebenden zählt, lässt sich zumindest für mich kein Auswahlverfahren nach Strafe und Belohnung erkennen.
Richtig, die Müllwesen: Die Verschmelzung von tierischen Knochen und Fleisch mit dem Gerümpel der Müllkippe. Filigrane Adern verbanden sich mit Elektrokabeln und verschwanden dann unter räudigem Fell, struppigen Borsten oder fleckiger, ledriger Haut. Es stank nach Krankheit und Exkrementen, nach Bleiche und Ammoniak, nach Schwefel und getrocknetem Blut. D'Lacey lässt eine Ekel-Parade mit ständig neuen Variationen auf ProtagonistInnen und LeserInnen los - unter anderem einen Tausendfüßler, der auf menschlichen Fingern läuft, schmackofatz. Der größte Horror des Romans liegt dennoch in Tamsins wiederkehrendem Albtraum von der Verstümmelung eines Babys, da braucht's schon Magennerven beim Lesen. Nüchtern betrachtet erfüllen diese etwas platt psychologisierenden Passagen auch ganz einfach die Schocker-Quote im ersten Teil des Romans, der noch mehr von inneren Schrecken lebt, ehe sich in Teil 2 die äußeren in Bewegung setzen und die Handlung an Rasanz gewinnt.
Trotz des alltagsweltlichen Settings wird auf pseudowissenschaftliche Erklärungen verzichtet - schließlich können nur in einer magischen Sichtweise Brillen und Glasmurmeln zu funktionierenden Augen werden, oder wie die angepisste Natur halt die Behelfsbiologie ihrer neuen Kampfeinheiten zusammensetzt. Dass "Entsorgt" kein auf Realismus bedachter Öko-Thriller ist, macht ja schon der Prolog klar, der den äußeren Umständen nach ein Rendezvous im Mondlicht sein könnte, tatsächlich aber in ein menstruationsblutiges esoterisches Ritual mündet. Und auch das unvermeidliche Wort Gaia wird natürlich noch fallen. "Entsorgt" geht damit den umgekehrten Weg zu vielen Romanen der letzten Zeit, in denen altgediente Motive der Schauerliteratur wie z.B. Werwölfe oder Zombies plötzlich "verwissenschaftlicht" werden, was ohnehin nie wirklich befriedigend aufgeht.
Dafür stellt sich D'Lacey in die ebenso alte Tradition der Untergangsromane - inklusive der durchaus selbsthasserischen Botschaft, dass der Mensch nun die Strafe bekommt, die ihm zusteht (kein moralisierender Zeigefinger also hinsichtlich der Einzelpersonen, sehr wohl aber in Bezug auf die ganze Spezies). Dass sich D'Lacey dieser Tradition bewusst ist, zeigt nicht zuletzt ein Detail der Konstruktion - nämlich den Roman da enden zu lassen, wo vergleichbare Apokalypsen gerne begonnen haben. Doch wo frühere Ökohorror-Geschichten Strahlung und Umweltgifte nur als Auslöser verwendeten, um mutierte Lebewesen auf die Menschheit zu hetzen, spart sich D'Lacey den Umweg und macht den Unrat selbst zum Akteur. Obendrein mit der ironischen Komponente gewürzt, dass bei ihm der Müll die Menschen recycelt, um so seine eigene Evolution voranzutreiben. - Plakativ, aber ein Pageturner.

Kai Meyer: "Lanze und Licht"
Broschiert, 384 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
Die schlechte Nachricht zuerst: Daniel Fox' "Moshui"-Reihe, deren erster Teil "Geschmiedet in Feuer und Magie" bei Blanvalet erschien, wird vorerst zumindest auf Deutsch nicht fortgesetzt - vielleicht hat sich da wieder mal das Fehlen von Elfen, Zwergen und bequemen moralischen Eindeutigkeiten bemerkbar gemacht. Die gute Nachricht: Damit sind noch nicht alle Wege ins mythische alte China versperrt. Es bleibt ja noch Kai Meyers "Wolkenvolk"-Trilogie, und die hatte ihre Bewährungsprobe schon vor einigen Jahren in der gebundenen Ausgabe.
Aus Teil 1 ("Seide und Schwert", hier der Rückblick) sind die beiden Hauptfiguren jeweils mit der Hypothek eines Fluchs beladen hervorgegangen. Das Mädchen Nugua trägt einen magischen Handabdruck auf der Brust, der sich langsam um ihr Herz zur Faust ballt und sie irgendwann töten wird. Und Niccolo, Gesandter des von Leonardo da Vinci auf die Reise geschickten Wolkenvolks, hat sich rettungslos in ein anderes Mädchen verliebt, Mondkind. Was größere Probleme als Eifersucht bedeutet - schließlich ist Mondkind in der Mission unterwegs, die unsterblichen Xian zu töten, um so die Verbindung zwischen Himmel und Erde zu unterbrechen und damit ihrem überirdischen Herrn, dem Aether, die Allmacht zu sichern. Niccolo, der Aether bislang nur als Treibstoff kannte und eigentlich "nur" eine neue Ladung für seine in China gestrandete Wolkeninsel besorgen soll, ist von der Entwicklung der Naturkraft zum selbstständig (und ausgesprochen perfide) denkenden Wesen entsetzt. Er muss mitansehen, wie Mondkind bereits den vorletzten Xian zur Strecke bringt und ist hin- und hergerissen zwischen seinem Beschützerinstinkt gegenüber Mondkind und dem Wissen, was die Vollendung ihrer Mission für die Welt bedeuten würde.
Vom Aufbau her ist "Lanze und Licht" ein typischer zweiter Teil einer Trilogie, die Hauptpersonen wurden etabliert und sind nun auf getrennten Wegen zu einem sich langsam abzeichnenden gemeinsamen Ziel unterwegs. Die Handlung gliedert sich dabei in vier Stränge: Zunächst jeweils um Niccolo, Nugua (die nicht allzuviel zu tun bekommt, sie ist aber auch verletzungsbedingt entschuldigt) und ein Traumduo anderer Art kreisend: Die resolute Schwertkämpferin Wisperwind und ihr Comical Sidekick Feiqing - nicht umsonst will das Auge den Namen des Anti-Helden immer als "Feigling" lesen. Nun erfahren wir auch mehr über seine Herkunft und begegnen seinem eulenäugigen Volk, das ähnlich dem von Niccolo in der Luft zuhause ist. Nach einem Drittel der Romanlänge entrollt sich dann auch der vierte Handlungsstrang rund um die Fürstentochter Alessia de Medici, die eine Invasion ihrer immer mehr Richtung Erdboden sinkenden Wolkenheimat miterleben muss. Und dabei verstörendes Hintergrundwissen über Ursprung und Motive des Aethers erlangt.
Meyers Stil ist stets klar - keine Sekunde lang kann Zweifel aufkommen, was gerade geschieht - und setzt auf Bildhaftigkeit. "Deskriptiv" wäre aber das völlig falsche Wort, dafür geht alles viel zu schnell. "Andere schreiben in schwarz-weiß, Kai Meyer schreibt in Farbe", heißt es in einer Bewertung am Buchrücken. Und genau das macht seine Romane aus: Am laufenden Meter werden mit nur wenigen Worten effektive Bilder generiert, meistens sind es Totalen. Da reitet Mondkind auf einem Riesenkranich durch die Luft und sieht in ihren wogenden Gewändern wie eine schwebende Seeanemone aus, da werden Seidenschärpen und ein Fächer zu tödlichen Waffen inmitten tänzerischer Martial Arts, da hüpft Wisperwind im "Federflug" von Baumspitze zu Baumspitze und zieht mit ihrem hochgereckten Schwert Blitze an, die auf ihre Gegner herniederfahren. Meyer beschränkt sich aber nicht auf einen fernöstlichen Bilder-Kanon - es kommen nicht minder knallige Eigen-Imaginationen hinzu, die sich aber gut einfügen: Seien es die papierenen Wabenkonstruktionen, aus denen Feiqings Volk seine Luftschiffe baut, ein gigantischer Tausendfüßler oder die wirklich riesigen Riesen, die hier in einer Erdspalte hausen und deren andersgeartete Dimensionen Meyer tatsächlich anschaulich machen kann.
Die "Wolkenvolk"-Reihe trägt stark märchenhafte Züge, genauer gesagt die eines Märchens im Stil von Anime-Meister Hayao Miyazaki. Der richtige Mix macht's: Aus Eigenschöpfungen und traditionellen Motiven, aus ewig gültigen Plots (Liebe, Tod und der Kampf zwischen Gut und Böse) und dem Durchbrechen von Klischees, gerade was die Charakterzeichnung betrifft: Mondkind etwa ist keineswegs mit der ihr aufgezwungenen Mission einverstanden und verstümmelt sich sogar vor Verzweiflung selbst. Alessia, die anfangs als schnöseliges Luxusgör erschien, erweist sich mehr und mehr als patentes Frollein - dummerweise hingegen der letzte Xian, auf dessen Schultern die Hoffnung der ganzen Welt lastet, als ausgemachter Unsympath. Sogar der Riesentausendfüßler, Manifestation eines überirdischen Wesens, ist zwar eine Gewalt, der nichts und niemand entrinnen kann ... zugleich aber auch eine jammervolle Gestalt voller Selbstmitleid. Und auf einer Ebene weit über all dem rumort es auch in esoterischen Dimensionen: das Chi der Erde selbst ist im Aufruhr. - Rasant, poppig und trotzdem nicht eindimensional, so sehen die schönsten Märchen aus.
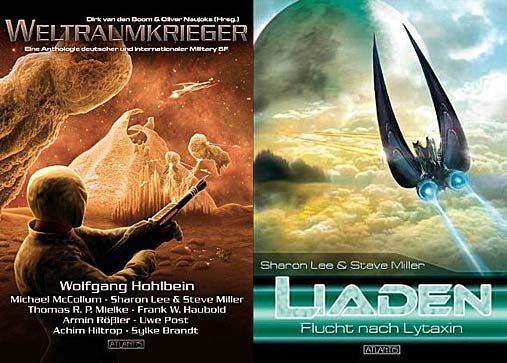
Dirk van den Boom & Oliver Naujoks (Hrsg.): "Weltraumkrieger" und Sharon Lee & Steve Miller: "Flucht nach Lytaxin"
Broschiert, 200 bzw. 250 Seiten, jeweils € 13,30 Atlantis 2010.
"Military SF" dürfte im Genre zu den Begriffen zählen, zu denen jede/r bei Nennung augenblicklich eine Meinung abzuspulen hat. Umso mehr sei empfohlen, erst mal das Nachwort der Anthologie "Weltraumkrieger" zu lesen, das von Dirk van den Boom stammt. Der hat mit seiner "Tentakelkrieg"-Trilogie und der neuen Zeitreise-Reihe "Kaiserkrieger" ja schon einschlägige Erfahrung von der schreibenden Seite her und weist auf die inhaltliche Vielfalt eines eher als (erfolgreicher) Marketing-Begriff denn als abgrenzbare Einheit existierenden Subgenres hin - von Reflexion bis zu simplem gun porn ist da alles drin. Man muss van den Boom nicht in jedem Punkt zustimmen - auf jeden Fall aber seiner Conclusio, dass prinzipiell Romane bzw. Erzählungen bewertet werden sollten, nicht Genres. Was nebenbei bemerkt ja auch darauf hinausliefe, pauschalisierende Vorurteile von LeserInnen der Mainstream-Literatur gegenüber der Phantastik eine Ebene weiter zu schleppen. - "Weltraumkrieger" enthält neun Geschichten in Uniform, wie es im Vorwort heißt: Genau eine zuviel, um noch ein "Trupp" zu sein - die korrekte militärische Einheit wäre eine "Gruppe". Was doch schön zivil klingt und dazu passt, dass die Anthologie in ihrer Zusammensetzung LeserInnen von Allgemein-SF vielleicht sogar mehr anspricht als die Military-Fans. Und mein persönlicher Haupteinwand gegen Military SF kann hier so ganz nebenbei auch nicht zum Tragen kommen: Nämlich die quälende Langeweile, die mich befällt, wenn Autoren wie David Weber oder John Ringo über Seiten und Seiten und Seiten hinweg militärische Strukturen und Abläufe protokollieren. Für so etwas sind diese Geschichten ganz einfach viel zu kurz.
Der Soldat als Individuum steht in Armin Rößlers "Entscheidung schwarz" im Mittelpunkt; ein Alien und ein menschlicher Sklave hatten ihre ganz persönlichen Motive zu Söldnern zu werden und müssen erleben, wie Rache und Ehre in Konflikt geraten können. Frank W. Haubold hat mit "Die Gänse des Kapitols" nicht nur ein antikes Motiv aufgegriffen (das Federvieh warnte seinerzeit die Römer vor einer keltischen Invasion), sondern setzt generell auf Old School - so ist hier ein Sternenzirkus noch mit Panthern und Elefanten unterwegs, was man schon in unserer Zeit kaum noch findet. Zugleich ist die Geschichte aber mit originellen Ideen gespickt und lässt die Atmosphäre des gespannten Wartens auf einen alten Feind fühlbar werden. Hans Dampf in allen Gassen Wolfgang Hohlbein macht in "Erstkontakt" den Weltraum-Kampf zur Hintergrundmusik für einen internen Konflikt: Der Kommandant und der Bord-Kaplan eines Kriegsschiffs projizieren ihre jeweiligen Weltbilder auf ein Alien-Schiff - mit fatalen Folgen. Ein recht typisches Produkt aus dem Hause Hohlbein: Gute Ausgangsidee plus schreiberische Routine minus Präzision im Detail; aber mit einem guten Schluss versehen. Und dann wäre da noch der einzige historische Beitrag der Anthologie: "Pflicht, Ehre, Mutter Erde", eine der allerersten Kurzgeschichten von Genre-Veteran Michael McCollum aus dem Jahr 1979. Mexikanische Angriffe auf US-amerikanische Naturdenkmäler werden hier zur Herausforderung für das rigide UN-Sicherheitssystem. Etwas getrübt wird die originelle Idee durch altbackene Nationalklischees ... McCollum hat eben schon 1979 so geschrieben, als wäre noch 1959, und das sah 2009 auch nicht anders aus.
Dass Military SF im deutschsprachigen Raum viel lieber gelesen als geschrieben wird, zeigen diejenigen AutorInnen, deren Beiträge sich nur sehr bedingt unter das Genre subsumieren lassen. Sylke Brandts "Grünes Feuer" distanziert sich von Genre-"Erfordernissen" weniger durch das Steampunk-Setting als dadurch, dass die Geschichte eher aus der Perspektive einer zu evakuierenden Kaisertochter erzählt wird als aus der der Soldaten, die rings um sie kämpfen und sterben. Thomas R. P. Mielke wiederum, der sich im Zuge seiner langen schreiberischen Karriere sicher alles andere als den Ruf eines Military-Autors erworben hat, nutzt die äußere Form eines Kriegszugs, um die infernalische Mission eines "Kampfpiloten" zu schildern, der in einem Schwarm von Millionen Artgenossen an einer biologischen Invasion der besonderen Art teilnimmt. "Der längste Weg der Welt" heißt die inhaltlich wie auch stilistisch mitreißende Erzählung. - Von Spötter Uwe Post schließlich würde wohl niemand eine ernstgemeinte Blutoper erwarten, und der Autor bleibt seinem Ruf auch hier treu. In "Ashkar Vier, Schlamm" scheucht er uns durch fast alle gängigen Topoi "Starship Troopers"-artiger Geschichten, um sie nach Strich und Faden zu verarschen. Inklusive der Propaganda-Durchsage zur Hebung der Kampfmoral, die aus einem Behelfsgerät durchs Feldlager scheppert: "Liebet eurööö Wuaffen, tötööet eure Feinde. Für Ruhm, Ehre und maximalen Return-of-invöööest!" Da und dort knatterte ein Maschinengewehr. Raketenwerfer und Busch-Orgeln feuerten. Irgendwo klapperte Essgeschirr.
Die Kurzgeschichte "Reelle Chance" von Sharon Lee & Steve Miller bildet zugleich die Überleitung zum zweiten hier vorgestellten Buch. Es ist eine Episode aus der "Liaden"-Reihe des US-amerikanischen AutorInnen- und Ehepaars und dreht sich darum, wie sich die jugendliche Terranerin Miri Robertson - später Söldnerin und eine der Hauptfiguren der Reihe - aus ihrer familiären Hölle befreien konnte. Die seit über 20 Jahren laufende und zahlreiche Romane und kürzere Erzählungen umfassende "Liaden"-Reihe ist ein kleines Juwel, auch weil sie - im positiven Sinne - ein wenig anachronistisch wirkt. Zwar wird hier reichlich gekämpft, genauso wichtig ist aber auch der Fokus auf die kulturellen Unterschiede und abweichenden Denkweisen zwischen nahe verwandten Menschen-Spezies. Darin ähnelt die Serie Werken aus den 70er Jahren, etwa M. A. Fosters "Ler"-Zyklus oder auch Gordon Dicksons "Dorsai"-Romanen. Anstelle der Technophilie vieler Space Operas unserer Tage scheuen Lee & Miller auch nicht vor einem Schuss Metaphysik zurück, was sich unter anderem in einer Reihe besonderer mentaler Kräfte äußert, über die die Angehörigen des Liaden-Volks verfügen.
"Flucht nach Lytaxin" (im Original 1999 als "Plan B" erschienen) kehrt die interkulturellen Aspekte deutlich hervor: Miri, die erfahren hat, dass sie selbst Liaden-Gene in sich trägt, sucht mit ihrem liadischen Lebensgefährten Val Con yos'Phelium die abgelegene Heimatwelt ihrer Verwandtschaft auf und lernt deren Lebensweise kennen. Dem Buch ein Glossar beizufügen hätte sich nicht übel gemacht, denn die Verwandtschaftsstrukturen der Liaden sind kaum weniger kompliziert als die von Fosters Ler. Das ganze Volk ist in Clans organisiert, und da Val Con einem angehört, der von der übergreifenden Abteilung für Innere Angelegenheiten misstrauisch beäugt wird, hat der Verwandtschaftsbesuch zugleich Fluchtcharakter. Der Zeitpunkt allerdings war schlecht gewählt, denn gerade jetzt wird der Planet zum Zielobjekt einer Invasion durch die dritte große Menschen-Spezies, die Yxtrang. Das Motiv der Anpassung an eine fremde Kultur wiederholt sich, als Miri einen in Ungnade gefallenen Yxtrang gleichsam adoptiert ... ehe es dann in den gemeinsamen Partisanenkampf abgeht. - Wie gesagt: Die "Liaden"-Romane sind lesenswert, auch wenn Heyne seinerzeit die Reihe nach Band 3 eingestellt hat. Schön, dass sie bei Atlantis nun eine zweite Chance erhält.

Jonathan L. Howard: "Totenbeschwörer. Ein Fall für Johannes Cabal"
Broschiert, 400 Seiten, € 12,40, Goldmann 2010.
"Ich betrachte mein Leben als entscheidenden Faden im anhaltenden Fortschritt der Menschheit vom Protoplasma zu .. ich weiß nicht, wohin, ehrlich gesagt. Jedenfalls wäre etwas, was lediglich etwas besser ist als Protoplasma, schon ein erster Schritt." - Misanthropisch, soziopathisch und verklemmt, so kennt man und so mag man Johannes Cabal, seit Jonathan L. Howard dem Nekromanten 2009 zum Roman-Debüt verhalf ("Johannes Cabal, Seelenfänger"; hier der Rückblick). Von England hat es Cabal inzwischen ins fiktive Mirkvanien verschlagen, einen osteuropäischen Operetten-Staat, der mit seinem Steampunk-Setting und seinen unfreiwillig komischen machtpolitischen Anwandlungen irgendwie an Vulgaria aus "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" erinnert: "Was der Rest für Paranoia hält, ist in diesem schmuddeligen Dampfkochtopf von Zwergenstaaten mit völlig überspannten Träumen gang und gäbe."
Eigentlich droht Cabal hier die Hinrichtung, weil er ein nekromantisches Buch aus einer mirkvanischen Bibliothek gestohlen hat, doch wird er vom intriganten Comte Marechal begnadigt, um einen Spezialauftrag auszuführen: Er soll den frisch verstorbenen mirkvanischen Kaiser noch einmal für gerade so lange ins Leben zurückholen, dass dieser eine nationalistische Brandrede halten und die Bevölkerung auf einen Krieg gegen die heftig beneideten Nachbarn des Landes einstimmen kann. Natürlich läuft dies nicht so ab wie vom Comte erhofft: Cabal lässt einen bissigen Zombie auf die Umwelt los, der zu nichts zu gebrauchen ist. Schwer zu sagen, ob dies ein absichtlicher Sabotageakt wegen politischer Bedenken war oder Cabals völliger Wurschtigkeit entsprang. Offenbar ist Cabals moralische Ambivalenz, die vor allem ihm zugetane Menschen schwer beschäftigt, die Kernfrage, die Howard über möglichst viele Romane hinweg offen lassen will. Obwohl sie doch im Grunde schon im ersten Band beantwortet wurde, als Cabal vom Teufel seine Seele zurückforderte und der sie ihm angewidert hinschmiss, weil er "mit so einem Kitsch" ohnehin nichts anfangen könne ...
Fürs erste jedenfalls ist Cabal auf der Flucht, und zwar an Bord eines luxuriösen mirkvanischen Luftschiffs. Dort trifft er überraschenderweise auf die junge Leonie Barrow aus Band 1, inzwischen eine angehende Kriminologin, sowie auf ein geradezu klassisches Ensemble von Personen: Da hätten wir die adelige Zicke, die ihre Gesellschafterin herablassend behandelt. Den moralisch entrüsteten jungen Revolutionär. Den tumben Geschäftsmann und seine ehrgeizige Ehefrau. Und den Dandy, der alle mit seiner exaltierten Art nervt. Diese Konstellation entspricht derart den Konventionen alter britischer Gesellschaftskrimis, dass man schon lange, bevor's soweit ist, weiß: Hier wird ein Mord geschehen! Im Original heißt der Roman auch passend "Johannes Cabal the Detective", während die deutsche Fassung diesmal leicht irreführend unter der Direktübersetzung des Titels des ersten Romans daherkommt. Im Gegensatz zum Vorgänger spielt Übernatürliches hier - abgesehen vom kaiserlichen Experiment zu Beginn und einer kurzen "Pushing Daisies"-Einlage etwas später - keinerlei Rolle. "Totenbeschwörer" ist ein Steampunk-Krimi.
In Sachen Humor hat Band 2 gegenüber Band 1 deutlich abgebaut, von gag-geladen auf amüsant. Vor allem am Wortwitz, der in "Seelenfänger" nur so sprühte, mangelt es diesmal etwas. Es gibt immer noch einige gute Pointen ("Der Erzbischof segnete den Fluss auf Teufel komm raus."), aber auch viele, in denen sich Howard im Bemühen besonders witzig zu sein verhaspelt und durch Überbeanspruchung den Effekt sabotiert. Ein Beispiel: Miss Barrow biss in seine Hand. Cabal zog sie mit einem unterdrückten Fluch zurück, den man seit der Ausrottung einer vormenschlichen Spezies nicht mehr gehört hatte, die sich auf wüsteste Beschimpfungen verstand und die menschliche Fähigkeit zur Bildung von Kraftausdrücken bei weitem übertrumpft hatte. Soweit okay - aber warum jetzt noch der Nachsatz: Doch selbst dieser lange verschwundenen Rasse wäre das, was Cabal sagte, ziemlich ungehörig erschienen. Totgeritten. Möglicherweise hat Howard sein sprachliches Pulver schon zu sehr in Band 1 verschossen - der hatte mit seinem Höllenrevue-Setting allerdings auch das dankbarere Thema. Besser kommt der Humor in Form von Situationskomik zum Tragen - etwa wenn sich die Luftschiffpassagiere mit der unbekömmlichen "Macho-Cuisine" Mirkvaniens abmühen oder wenn ein Trio aus Verfolger, verfolgtem Verfolger und folgendem Verfolger seine Kreise zieht wie ein Ringelspiel.
Auch in Sachen Struktur bringt der neue Roman einen Wechsel: Während "Seelenfänger" eher als Abfolge lose verbundener Episoden daherkam, ist "Totenbeschwörer" ganz klar aus einem Guss. Das wird auch nicht dadurch abgeschwächt, dass der Roman wieder einige Gimmicks enthält. So ist am Ende eine wohl an Poe angelehnte Episode über Cabals weiteren Weg, doch aus anderer Perspektive, angefügt; dazu kommen einige Schnittzeichnungen des Luftschiffs "Prinzessin Hortense" und eines Libellenflugzeugs bzw. Entomopters, komplett mit "Werbetexten" eines fiktiven Modellbau-Unternehmens. - Alles in allem ist "Totenbeschwörer" wohl nicht der Roman, den LeserInnen nach Band 1 erwartet haben dürften. Die vielleicht größte Überraschung aber ist, dass kaum auf den Cliffhanger am Ende von Band 1 eingegangen wird, der auf Cabals eigentliches Motiv, zum Nekromanten zu werden, hindeutete. Aber es dürfte ja auch noch so mancher weitere Roman folgen.
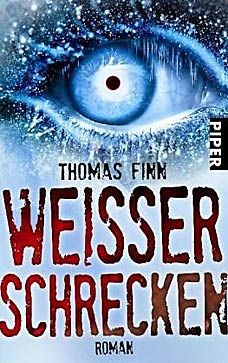
Thomas Finn: "Weißer Schrecken"
Broschiert, 492 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
Jetzt ist die letzte Rundschau des Jahres schon fast am Ende, und es war noch keine einzige Weihnachtsgeschichte dabei. Dabei ist das famose Hochfest mit Phantastik überaus kompatibel, nicht zuletzt mit deren abseitigeren Varianten. "The Nightmare Before Christmas" wird in Thomas Finns "Weißer Schrecken" einmal erwähnt, was natürlich bei weitem nicht die makaberste Variation zum Thema ist - man denke nur an die Slasher-Serie "Silent Night, Deadly Night" oder - noch verstörender - Santa Claus als jovialen Waffenhändler in "Narnia". Dass speziell der Filmbereich alle Jahre wieder Blut leckt, kann kaum ein Zufall sein - der Prolog zu "Weißer Schrecken" zeigt auch warum: Da verfolgt ein bedrohlich grinsendes Santa-Lookalike mit einer Lähmungsspritze in der Hand einen "Engel" durchs Schneegestöber - ein Text kann nur erahnen lassen, was für eine tolle Bildwirkung das abgäbe. (Wenn ich nichts überlesen habe, passt der Prolog übrigens nicht ganz zum späteren Geschehen, aber das nur nebenbei bemerkt.)
Von "Weihnachtsgeschichte" kann freilich nur bedingt gesprochen werden, eigentlich geht es ja um den Nikolo und dessen weniger kinderfreundlichen Begleiter. Aber so einfach sind die Festtage auch wieder nicht voneinander abzugrenzen: Neben Morden, Verschwörungsszenarien und übernatürlichen Phänomenen dreht sich Finns Roman auch um die Querverbindungen zwischen und Bedeutungsveränderungen von historischen und mythologischen Figuren: Vom katholischen Heiligen Nikolaus von Myra, der im Umweg über den niederländischen Sinterklaas schließlich zum amerikanischen Santa Claus wurde, den Krampus und Knecht Ruprecht ... und schließlich Odin, Frigg und sogar Frau Holle. Denn die vermeintlich auf eindeutige Wurzeln zurückgehende Nikolo-Tradition erweist sich in Wahrheit als wildes Gebräu aus keltischer und germanischer Mythologie, kirchlichem Brauchtum und Schwarzer Pädagogik. Finn erzählt im Nachwort von seinen Recherchen zum unerwartet komplizierten Thema - die hat er zum Glück in besseren Nachschlagewerken betrieben als denen, in denen er den Nibelungen "Hagen von Troje" und eine Fußbekleidung der Marke "Dog Martens" gefunden hat. Gibt jedenfalls ein interessantes Thema ab!
Schauplatz ist das fiktive Kaff Perchtal im tiefsten (bzw. höchsten) Oberbayern; hier leben der 15-jährige Andreas und seine Freunde Robert, Niklas und die Zwillinge Elke & Miriam. Andreas lebt de facto alleine - seine Mutter hat Selbstmord begangen, sein Vater ist nie zuhause und scheint Andreas absichtlich aus dem Weg zu gehen. Roberts Mutter säuft bis zur Besinnungslosigkeit; Vater hat er keinen. Die Eltern der Zwillinge lassen ihre Töchter unter ihrem religiösen Wahn leiden, und Niklas wird von seiner Mutter geradezu gemästet ... eine solche Ballung kaputter Familienverhältnisse kann kein Zufall sein. Bald erfahren wir auch - angewidert, aber nicht überrascht - , dass Niklas von seiner Mutter einst beinahe erstickt woren wäre. Das seltsame Verhalten nicht nur der Eltern, sondern aller Erwachsenen im Ort etabliert von Anfang an eine Atmosphäre latenter Bedrohung, die sich rasch verdichtet, als Perchtal von der Umwelt abgeschnitten wird und rund um die fünf ProtagonistInnen unbelebte Gegenstände damit beginnen, warnende Botschaften von sich zu geben. Etwas scheint auf sie zuzukommen - und nur dem Datum nach wird es der Nikolaus sein.
Es ist schon mal beklagt worden, dass europäische Schulkinder aufgrund einseitiger medialer Versorgung über Löwen und Elefanten besser Bescheid wüssten als über die Fauna der eigenen Länder - das ließe sich glatt auf den Grusel-Bereich übertragen, wo Londons nächtliche Straßen und der finstere Unterbauch von Maine zu so vertrauten Schauplätzen wurden, dass das Berchtesgadener Land mal eine richtiggehend exotische Abwechslung abgibt. Nur sprachlich - gemessen an der Ausdrucksweise der jugendlichen Hauptfiguren - hat man keine Sekunde lang das Gefühl im Alpenraum zu sein. Das wird auch nicht durch den Auftritt einiger älterer Knallchargen wettgemacht, die ein Hybrid-Kauderwelsch von sich geben à la: "Die Sach' hat uns Dirndl freilich gehörig verschrecken tun." - Aber der in den USA geborene und in Hamburg lebende Autor bezeichnet sich ja auch selbst als Nordlicht, da lässt sich schwerlich Dialekt-Sicherheit verlangen.
Mögen die Charaktere statt Bannerman & Pangborn auch Eichelhuber & Bierbichler heißen - "Weißer Schrecken" kommt als eine Art Young-Adult-Variante von Stephen King daher; ein Satz wie "An jenem sechsten Dezember im Jahre 1994 war ihre Kindheit unwiderruflich zu Ende gewesen." könnte glatt eine Direktübernahme sein. Die Konstruktion des Romans ähnelt jedenfalls stark Kings "Es": Zu Beginn, im Dezember 2010, erhält der erwachsene Andreas einen Anruf, dass "es wieder soweit sei", woraufhin ins Jahr 1994 umgeblendet wird. In weiterer Folge nähern sich die ProtagonistInnen parallel auf beiden Zeitebenen der Höhle des Löwen an (in der natürlich etwas ganz anderes lauert), um den LeserInnen keine Vorab-Info zu geben. Überdies zeigt die Erschließung der örtlichen Historie ganz wie bei King auch hier, dass die mysteriösen Vorgänge, mit denen sich die ProtagonistInnen herumschlagen müssen, in regelmäßigen Abständen stattgefunden haben - und das soweit die Chroniken zurückreichen. Wichtigster Unterschied neben der Geografie: Anders als King gewichtet Finn die beiden Zeitebenen nicht gleich, sondern belässt die Ereignisse von 2010 bei kurzen Einschüben zwischen den Hauptkapiteln.
Die schrittweise Aufklärung des Geheimnisses zieht einem dann nicht wirklich die Dogs aus, aber die eine oder andere gelungene Überraschung hat sich der Autor dennoch vorbehalten. Wenn King seine Romane schon mal mit einem Burger verglich, dann ist "Weißer Schrecken" - um ein regionales Pendant zu wählen, das nebenbei nach mehr Gore klingt, als der Roman beinhaltet - ein Fleischpflanzerl.
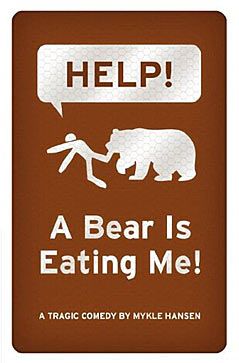
Mykle Hansen: "Help! A Bear Is Eating Me!"
Broschiert, 129 Seiten, Eraserhead Press 2008.
Zum guten Abschluss noch das lustigste Buch, das ich in den vergangenen Monaten gelesen habe - doch, Achtung, eine Vorwarnung: Lachen kann über "Help! A Bear Is Eating Me!" nur, wer der Schadenfreude mächtig ist. Dafür hat sich Bizarro-Autor Mykle Hansen, der - wo sonst? - in Portland, Oregon, lebt, extra eines der beliebtesten Feindbilder unserer Gegenwart herausgepickt, den skrupellosen Manager. Marv Pushkin heißt er und ist ein wirklich sensationelles Arschloch - dementsprechend politically incorrect geht es auch zu, wenn Marv erst mal losledert. Dumm nur, dass Marv während des Teambuilding-Seminars, für das er seine vermeintlich unfähigen MitarbeiterInnen zur Bärenjagd in die Wildnis geschleppt hat, seinen protzigen SUV zuschanden gefahren hat und jetzt völlig hilflos unter dem Wrack eingeklemmt herumliegt. Was ihm im Verlauf der folgenden Tage und Nächte widerfährt, zeigt der Titel ... und der bezieht sich nicht etwa auf den blutigen Höhepunkt der Novelle, sondern auf deren gesamten Inhalt. Als die Handlung beginnt, ist der erste Fuß schon abgenagt - weitere Körperteile werden folgen.
"You think you have problems? I'm being eaten by a bear! Oh, but I'm sorry, forgive me, let's hear about your problems. Mmm-hmm? So, your boss is mean to you? Is your car not running well? Perhaps you're concerned about the environment. Boo, hoo! Your environment just ate my foot!" - Mit diesen Worten beginnend schleudert uns Marv über 129 Seiten hinweg seinen Hass auf Gott und die Welt ins Gesicht, und so langsam schält sich aus der verbalen Kanonade heraus, wie mies der Borderliner wirklich ist. Hat er doch nicht nur seine Büro-Geliebte mit zur Bärenjagd genommen, sondern auch seine trampelige Ehefrau Edna. Der hat er zuvor extra einen Pelzmantel und eine Bärenfellmütze gekauft, aber ach, die dumme Kuh wollt's einfach nicht anziehen. Es geht eben alles vollkommen schief: Erst Marvs perfider Mordplan, dann die "Was-tun-bei-einer-Begegnung-mit-einem-Bären"-Vorschläge aus dem Handbuch, dann das verzweifelte Grabschen nach einem Snack-Riegel, der neben Marv im Wrack liegt. (Man merkt schon: Marvs Ziele werden im Verlauf der Erzählung immer kleiner ... durchaus parallel zu seinem Körper.) Marv zweifelt aber keine Sekunde daran, dass er noch gerettet wird und spitzenmäßige Ersatzfüße transplantiert bekommt - doch damit treibt ihn angesichts der Inkompetenz der gesamten Welt schon die nächste Sorge um: I just have to somehow make sure they don't graft negro feet onto me. I wish I had a Sharpie, I could write WHITE FEET ONLY PLEASE on my arm or some place on my body where neurosurgeons would see it.
Doch sieht es immer mehr danach aus, als bliebe die einzig verlässliche Größe in Marvs derzeitigem Leben der Bär, der in regelmäßigen Abständen vorbeischaut, um wieder ein bisschen an ihm herumzufressen. Kein Wunder, dass Marv im fortschreitenden Schmerzmittel-Wahn irgendwann anfängt, den Bären als seinen einzigen Freund zu betrachten. Marvs Halluzinationen sind im Grunde das einzige, was sich bei großzügiger Auslegung als Phantastik-Element bezeichnen ließe - aber beim Output der Bizarro-Verlage will ich da mal nicht so streng sein; erst recht nicht bei einem derart unterhaltsamen Buch. "Help! A Bear Is Eating Me!" ist die geifersprühende Schimpftirade eines Mannes, der zusehends den Verstand verliert. "A Tragic Comedy" lautet der Zusatz am Cover - doch die Tragik liegt ganz auf Marvs Seite ...
In der nächsten Rundschau ist die schon vor längerer Zeit angekündigte Sammlung optimistischer Science Fiction dran, außerdem wird's Zeit, die eine oder andere angebrochene Trilogie abzuschließen. Und beizeiten sollten endlich auch Wiederveröffentlichungen der Werke zweier meiner absoluten LieblingsautorInnen auf den Markt kommen: James Tiptree, Jr. und Cordwainer Smith. Einen guten Rutsch derweil! (Josefson)