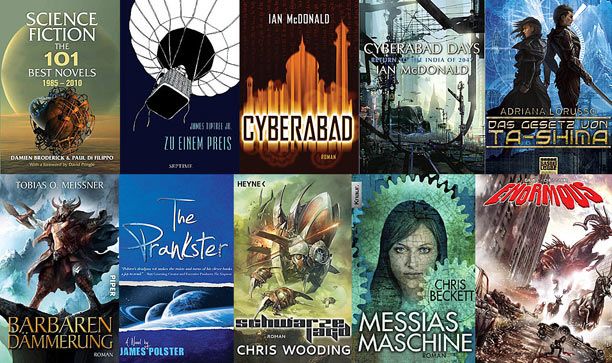
Aus aktuellem Anlass (nämlich dem Buch auf der nächsten Seite) beginnen wir heute mit einer kleinen Anleitung, wie man aus einer Rezension den maximalen Nutzen rausziehen kann. Vornehmlich geeignet für Werke der Phantastik; lässt sich übrigens problemlos auch von Büchern auf Filme übertragen. Here we go:
1) Die Rezension prinzipiell nur als das betrachten, was sie ist: Die Mitteilung, dass ein bestimmtes Buch erschienen ist. Alles Weitere sind Gimmicks.
2) Auf Informationen über Genre, Setting und Plot achten, um zu sehen, ob das Buch den eigenen Leseinteressen entspricht.
3) Jetzt all die Informationen herausfiltern, die darauf hinweisen, wie der Autor mit obigen Elementen umgegangen ist (also Infos über Stil, Struktur, Betonung von Action oder seelischem Innenleben der Figuren, Einhaltung wissenschaftlicher Plausibilität, metafiktionale Elemente usw. usf.). Aaaber - Achtung!!! - nicht deren Wertung durch den Rezensenten beachten, sondern sie neutralisiert vermerken. Zur Illustration ein Beispiel aus dem Filmgenre: Wenn mir ein Kritiker glühenden Herzens von den langen poetischen Einstellungen eines Films vorschwärmt und wie toll die nicht gemacht seien, reduzieren sich die betreffenden Passagen für mich augenblicklich zu einem einzigen Wort: Fadgas-Alarm! Und mein Kinositz bleibt leer.
4) Generell auf die Meinung des Rezensenten pfeifen. Ich habe mir schon justament Bücher gekauft, die in Grund und Boden verdammt wurden - ein Großteil davon war ehrlich gesagt wirklich mies, aber es fanden sich auch hervorragende darunter. Wie mich umgekehrt in den Himmel gelobte Werke schon bis ins Mark angeödet haben.
5) Eine vermeintliche Ausnahme zur Regel 4) kann sich aus der Situation ergeben, dass man die Vorlieben eines Rezensenten seit Jahren kennt und sie sich mit den eigenen decken. Das ist aber erstens kompletter Zufall und funktioniert zweitens auch nur so lange, bis ein Buch auftaucht, zu dem die Meinungen eben doch auseinander gehen. Fühlt sich dann ein bisschen wie ein Vertrauensverlust an ... liegt aber nur daran, dass man die Regeln 3) und 4) nicht beachtet hat.
6) Weitere Rezensionen zu demselben Buch lesen (dafür gibt's auf unserer Seite sogar eine Liste mit weiterführenden Links zu Genre-Medien) und bei diesen die Punkte 2) bis 4) wiederholen, um die Informationsmenge zu maximieren.
7) Es gibt keine Vorab-Garantie, dass einem ein Buch gefallen wird. Nie. Deshalb sind die Dinger auch billiger als Swimming-Pools.
8) Sich nicht zum Gefangenen von Regel 2) machen lassen. Man kann auch mal ganz was anderes lesen, als man es normalerweise tut. Gute Rezensionen scheinen das Risiko zu mindern, wenn man ein solches Wagnis eingeht. Aber wie gesagt: Das scheint nur so. Also einfach ein bisschen Traute beim Buchkauf. No risk, no fun.
9) Nur um ganz sicherzugehen, noch einmal: Auf die Meinung des Rezensenten pfeifen.
Solchermaßen gestählt können wir jetzt in die eigentliche Monatsrundschau gehen, und die beginnt mit ... einem Band voller SF-Rezensionen.
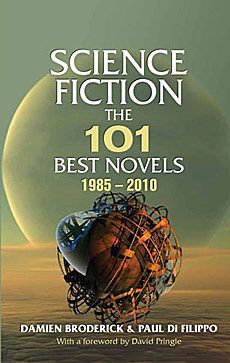
Damien Broderick & Paul di Filippo: "Science Fiction. The 101 Best Novels: 1985 - 2010"
Broschiert, 288 Seiten, Nonstop Press 2012
Hier also wie letzten Monat angekündigt das gefährlichste Buch des Jahres 2012. (Was denn? Hat etwa jemand das Necronomicon erwartet? Oder etwas Bissiges aus der Unsichtbaren Bibliothek?) Büchersammelnde erkennen den Grund sofort: Eine Auflistung der 101 "besten Romane" enthält naturgemäß jede Menge Kauf-Tipps, da raucht die Kreditkarte nicht mehr, sie zerfällt zu Asche. Die Liste, die US-Autor Paul di Filippo gemeinsam mit seinem australischen Kollegen Damien Broderick zusammengestellt hat, ist übrigens eine erklärte Fortsetzung zu David Pringles 1985 erschienenem "Science Fiction: The 100 Best Novels", das den Jahren 1949 bis 1984 gewidmet war. Und damit der langen Hochblüte der Science Fiction vom Golden Age bis zum Cyberpunk. Das neue Buch ist fast noch interessanter, weil es jenen Zeitraum abdeckt, in dem sich ein entscheidender Wandel vollzog: Kostengünstige SF-Taschenbücher waren nicht mehr wie selbstverständlich in jeder Trafik erhältlich, während in den Buchhandlungen die Fantasy ihr Schwestergenre zu überwuchern begann ... bis sich der um 1980 herum noch unaufhaltsam scheinende SF-Boom schließlich in der Rolle einer Randerscheinung wiederfand. Aber nicht traurig sein, sondern Regel 1) anwenden: Umso größer ist natürlich die Chance, in diesem Buch auf Lese-Tipps zu stoßen.
Wie wäre es zum Beispiel mit Paul Parks "Soldiers of Paradise" aus dem Jahr 1987? Das war der Beginn einer Trilogie, die ein exotisches gesellschaftliches Panorama auf einer Welt mit generationenlangen Jahreszeiten entwirft ("Helliconia" lässt grüßen), Broderick/di Filippo vergleichen es mit Gene Wolfes legendärem "Buch der Neuen Sonne". Wenn das nicht Appetit macht. Und Parks Werk wurde ebensowenig ins Deutsche übersetzt wie John C. Wrights "Golden Age"-Trilogie (2002 - 2003) um ein posthumanes Utopia mit wachsenden Komplexitätsstufen, Joan Slonczewskis kürzlich in der Rundschau vorgestellter interplanetarer Culture Clash "A Door Into Ocean" (1986) ... oder Wil McCarthys "Bloom" (1998), in dem gleich das ganze innere Sonnensystem von Nanomaschinen in Grey Goo verwandelt worden ist.
Etwa zwei Dutzend der hier vorgestellten Romane wurden bislang nicht ins Deutsche übersetzt, die meisten davon drängeln sich im Zeitraum von Mitte der 90er Jahre bis heute. Das klingt auf den ersten Blick logisch - Übersetzungen haben eben eine Zeitverzögerung. Allerdings selten eine so gewaltige wie Richard Calders "Dead Girls", das 1992 veröffentlicht wurde und erst heuer auf Deutsch erschien. Ich fürchte, da steckt eher die Kontraktion des SF-Marktes dahinter. Die großen deutschsprachigen Genre-Verlage sind zögerlicher geworden. Bei Lauren Beukes, die in den vergangenen Jahren mit ihren Thrillern "Moxyland" und "Zoo City" aus dem Südafrika der nahen Zukunft für Furore sorgte, besteht rein rechnerisch noch Hoffnung. Aber ob sich wohl irgendwann noch jemand der großen Carol Emshwiller erbarmen wird, die seit Jahrzehnten fantastische Erzählungen veröffentlicht und mit 91 immer noch ebenso aktiv wie unübersetzt ist?
Ein Reibungspunkt in Sachen Rezensionen entfällt natürlich, wenn Romane explizit als "die besten" vorgestellt werden - man kann sich nicht darüber aufregen, dass etwas verrissen wird, von dem man selbst begeistert ist. Der umgekehrte Fall mobilisiert nicht ganz so stark: Cherie Priests Steampunk-Roman "Boneshaker" als meticulously conceived and executed ride ... nun ja, für mich produziert die Frau Abenteuer-Handwerk und kein Fitzelchen mehr, aber bitte. Umso wichtiger ist wie bei allen Best-of-Listen natürlich der Faktor Auswahl. Da fällt bei "Science Fiction. The 101 Best Novels: 1985 - 2010" zunächst auf, dass das in den 80ern übermächtig erscheinende Subgenre Cyberpunk - im Gegensatz zu den späteren Wellen New Space Opera oder Singularitätsromane - relativ schwach vertreten ist, zudem mit weniger prominenten Namen wie Pat Cadigan oder Raphael Carter. Und das, obwohl Paul di Filippo selbst im Cyberpunk angefangen hat.
Der Hauptgrund dafür dürfte sein, dass jedeR AutorIn nur einmal vertreten ist - und Bruce Sterling eben mit "Heiliges Feuer" statt "Schismatrix" und William Gibson mit dem Nicht-SF-Roman "Systemneustart" statt mit den populären "Neuromancer"-Fortsetzungen "Biochips" und "Mona Lisa Overdrive". Dass es sich bei der Auflistung eher um die "101 Best SF Authors" handelt, war auch der Grund, dass Gibsons & Sterlings gewaltige Koproduktion "Die Differenzmaschine" in der Liste fehlt. Da ließe sich drüber diskutieren - andererseits verhindert dieses Auswahlsystem, dass Viel- und Gut-Schreiber wie Charles Stross, Alastair Reynolds, China Miéville, Robert Charles Wilson oder Stephen Baxter die 101er-Liste im Alleingang befüllen.
So wasserdicht nicht die Titel-, aber zumindest die Namensliste auch scheint, ein paar notable absences gibt es doch: Dan Simmons etwa oder John Scalzi. Oder - für mich schwerwiegender als diese beiden zusammen - Robert J. Sawyer. Beim ebenfalls schmerzlich vermissten Daryl Gregory könnte man argumentieren, dass sich seine Werke (z. B. das einzigartige "Pandemonium") nicht eindeutig der SF zuordnen lassen. Andererseits erweisen sich di Filippo und Broderick, die auf thematische Vielfalt bedacht sind, auch nicht grade als Puristen, wenn sie Audrey Niffeneggers Slipstream-Romanze "Die Frau des Zeitreisenden" oder Ian R. MacLeods "Aether" berücksichtigen, in dem immerhin eine Substanz mit magischen Eigenschaften die Hauptrolle spielt. Und Naomi Noviks "Temeraire"-Romane um Drachenreiter in den Napoleonischen Kriegen kann man mir nun wirklich nicht als SF verkaufen, auch wenn es hier versucht wird. Und wenn Platz für Jugendromane wie Steven Goulds "Jumper" oder Suzanne Collins' "Tribute von Panem" ist (nichts gegen Collins), dann muss schon die Frage erlaubt sein, warum Tad Williams' "Otherland"-Saga nicht berücksichtigt wurde, alleine schon wegen ihres Impact-Faktors. Das andere Ende der Verkaufszahlen-Skala wird übrigens nicht gestreift, Geheimtipps aus dem Underground sollte man sich also nicht erwarten - auch wenn Carlton Mellick III und seine Bizarro-KollegInnen so einiges an SF produziert haben, das nicht nur individuell (ein wichtiges Kriterium für di Filippo & Broderick), sondern auch wirklich gut ist.
Offenbar unvermeidlich, aber doch immer wieder aufs Neue ärgerlich ist das vollkommene Fehlen nicht-englischsprachiger AutorInnen in englischsprachiger Sekundärliteratur. Von hier enthaltenen Namen wie Hannu Rajaniemi ("Quantum"), Kazuo Ishiguro ("Alles, was wir geben mussten") oder Ekaterina Sedia sollte man sich nicht täuschen lassen, sowohl der Finne als auch der Japaner und die Russin veröffentlichen im Original auf Englisch. Anders als Haruki Murakami oder Koushun Takami ("Battle Royale"), die somit fehlen, obwohl ihre Werke ebenso ins Englische übersetzt wurden wie Frank Schätzings "Der Schwarm" (der durchaus einige Auswahlkriterien von Broderick/di Filippo erfüllen würde). Die meisten russischen AutorInnen konnten diese Hürde erst gar nicht nehmen - als deutschsprachiger Leser staunt man über all die Werke von Sergej Lukianenko oder Wladimir Sorokin, die nicht ins Englische übersetzt worden sind. Weshalb die Buchliste auch weniger bedeutende Alterswerke von großen Autoren wie Philip K. Dick ("Radio Free Albemuth", ein posthum veröffentlichter Prototyp von "VALIS"), Michael Moorcock oder Jack Vance enthält, während Boris Strugatzki diese Ehre verwehrt blieb. Da ist der Verlust mal ausnahmsweise auf Seiten der englischsprachigen Welt.
In chronologischer Reihenfolge wird jeder Roman im Schnitt auf drei Seiten vorgestellt, dabei erweisen sich di Filippo und Broderick als beeindruckend belesen (auch über die Grenzen des Genres hinaus) und präsentieren AutorInnen und Werke in deren jeweiligem Kontext. Der eine oder andere Handlungsspoiler rutscht ihnen dabei leider durch; offenbar betrachten sie die Bücher bereits als Teil des allgemeinen Geschichtsbewusstseins. Die formale Gestaltung des Buchs hingegen ist bedauerlicherweise ziemlich mangelhaft. Es fehlt ein Namensregister am Ende, und das Inhaltsverzeichnis listet lediglich die Romantitel, nicht aber die dazugehörigen AutorInnen auf. Deutschsprachige LeserInnen, die die Bücher in der Regel unter anderem Titel kennen, stehen damit ohne jede Navigationshilfe da. Viel Spaß beim Suchen!
... so, das war jetzt jede Menge Herumgemecker, und zwar berechtigtes. Sollte man "Science Fiction. The 101 Best Novels: 1985 - 2010" also besser ignorieren? Aber keineswegs, das Buch ist eine Goldgrube! Regel 1), wenn ich noch einmal daran erinnern darf. Ich habe mir ein gutes Dutzend Titel notiert, die ich un-be-dingt bestellen muss, und so wird es wohl jedem gehen, der sich hier durchgefräst hat. Kreditkarten, wollt ihr ewig leben?
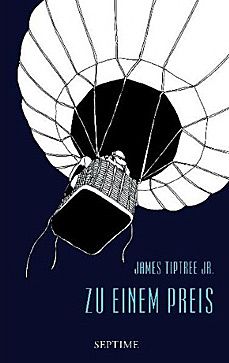
James Tiptree Jr.: "Zu einem Preis"
Gebundene Ausgabe, 416 Seiten, € 24,00, Septime 2012
*kicher* "Die Screwfly Solution" ist es also nun geworden. Auf Deutsch ist James Tiptree Jr.s berühmte, Nebula-gekrönte Kurzgeschichte aus dem Jahr 1977 schon als "Die Goldfliegen-Lösung", "Schmeißfliegen" und "Operation Goldfingerfliege" herausgekommen ... in Sachen biologische Distanzen ist das alles dasselbe, als hätte sich Sherlock Holmes mit dem Kojoten von Baskerville abgeben müssen. Nachdem sich bei den deutschsprachigen Genre-Verlagen - außer Heyne - in den letzten Jahren ja ein gewisser Trend zur Originaltreue abzeichnet, stand man da bei Septime vor einem Problem: "Die Neuwelt-Schraubenwurmfliegenlösung" wäre zwar die korrekte Übersetzung, klingt aber ... nun ja, doch irgendwie lächerlich.
... und damit gänzlich unpassend für eine der grausigsten und zugleich besten Erzählungen der 1987 verstorbenen US-Autorin Alice Bradley Sheldon, die in der Science Fiction als "Racoona Sheldon", vor allem aber als "James Tiptree Jr." zur Berühmtheit wurde. Alan, ein Experte für Schädlingsbekämpfung, hält sich gerade in Südamerika auf, als ihn die Briefe seiner Frau aus den USA alarmieren: Von wachsender Gewalt gegen Frauen ist die Rede, religiös motivierte Femizide häufen sich. Anhand persönlicher Aufzeichnungen und Nachrichtenschnipsel erleben wir binnen weniger Seiten eine unfassbare Eskalation: Eben noch beobachtet Alan, wie sich Frauen in der Öffentlichkeit seltsam nervös verhalten - kurz darauf verkündet eine Agenturmeldung nüchtern, dass Schleppnetze voller Frauenleichen zu einer zunehmenden Gefahr für die Küstenschifffahrt würden. Die atemberaubende Geschichte mündet in einen Schlusssatz, der es zwar nicht an Poesie, aber an Schrecklichkeit mit Arthur C. Clarkes berühmtem "Overhead, without any fuss, the stars were going out" (aus "The Nine Billion Names of God") aufnehmen kann.
Ähnlich entsetzlich ist "Von Fleisch und Moral" ("Morality Meat"), angesiedelt in einer nahen Zukunft der gesunkenen Lebensstandards. Scheinbar voneinander getrennt entspinnen sich hier die Geschichten eines verunglückten Truckfahrers und einer jungen Mutter, die ihr Baby zur Adoption freigibt. Zwar lassen sich schon früh Hinweise erahnen, wie die Autorin die beiden Fäden zusammenführen wird, doch bittet man bis zum Ende darum, dass es nicht so kommen wird ... das gänzlich unrealistische Licht der Hoffnung in den Augen, wie es in der Geschichte passenderweise heißt. Es könnte fast dieselbe Welt sein, in der auch "Der Teilzeit-Engel" ("Time-Sharing Angel") handelt, allerdings löst hier jemand das dringlichste Problem der Menschheit. Als die junge Joylene eine Vision von der Malthusianischen Katastrophe überkommt, betet sie um Hilfe ... und wird erhört. Die nicht-irdische Lösung könnte glatt Philip José Farmer zu seiner ein Jahrzehnt später entstandenen "Dayworld"-Reihe inspiriert haben; der Mann hat bekanntlich geklaut wie ein Rabe.
Die Sammlung "Zu einem Preis" beinhaltet Erzählungen aus der zweiten Hälfte von Tiptrees Schaffen, inhaltlich sind sie weit gestreut. Zu großen Werken wie der "Screwfly Solution" gesellen sich Gedankenspiele wie eben "Teilzeit-Engel", stilistische Fingerübungen ("Hölle, wo ist dein Sieg?"/"All This and Heaven Too", geschrieben in Form eines Märchens) oder "Wer den Traum stiehlt" ("We Who Stole the Dream"). Letzteres eine Abfolge mehrerer kleiner Tragödien, mit denen eine Sklavenrasse der raumfahrenden Menschheit ihre Freiheit erkauft. Näher an Tiptree-typische Themen - allen voran: der Tod - kommen wir in "Ein Quell unschuldiger Freude" ("A Source of Innocent Merriment"), in dem ein Raumfahrer von einer an Lems "Solaris" erinnernden Begegnung berichtet. Das Wissen um die eigene Vergänglichkeit und Glückseligkeit schließen einander hier nicht aus, im Gegenteil. Im Nachhinein betrachtet ist dies eine der vielen, vielen Geschichten, in denen Tiptrees späterer Selbstmord bereits antizipiert scheint.
Noch deutlicher wird dies im hervorragenden "Coda" ("Slow Music"): Jakko und Peachthief sind die letzten Menschen auf einer Erde, deren BewohnerInnen nach und nach in einem STROM genannten Transzendenz-Phänomen aufgegangen sind. Umgeben von nicht mehr genutzter Supertechnik und einer "verbesserten" Natur sehen die beiden ProtagonistInnen mit staunenden Augen auf längst verlernte Dinge - seien es Handwerk, Sexualität oder Pflanzen und Tiere; ein menschliches Skelett nimmt Jakko als "weiße Stäbe" wahr. Tiptree ruft ein vergleichbar dichtes Gefühl der Entfremdung hervor wie Cordwainer Smith einst in seiner Fernzukunftsgeschichte "Alpha Ralpha Boulevard". Doch wo es bei ihm um die Wiederentdeckung des Menschlichen ging, stehen bei Tiptree die Zeichen auf Abschied. Todessehnsucht hüllt sich hier in ein transhumanes Gewand.
Probleme hatte Tiptree am ehesten mit langen Formaten; in der Novelle "Mit zarten irren Händen" ("With Delicate Mad Hands") beispielsweise hat sie sich ein wenig verzettelt. Im Mittelpunkt steht die Raumfahrerin Carol Page, aufgrund eines Geburtsfehlers Schweinegesicht genannt. Gemobbt, erniedrigt und sogar an Bord ihres Raumschiffs als "menschliche Mülltonne" missbraucht, wird sie zunächst als klare Sympathieträgerin aufgebaut, um sich später als mordende Irre zu erweisen ... und noch später muss man dann als Leser bereit sein, wieder Carols Sehnsüchte zu teilen. Das verlangt einem doch einiges ab - ebenso wie der Verlauf der Geschichte selbst, der über Carols unvermeidlich scheinende Erlösung im Weltraumtod hinausgeht und noch einige Volten schlägt. Auch hier glänzt Tiptree aber mit ihrer Gabe, in wenigen Worten die Unmenschlichkeit eines ganzen Systems zu veranschaulichen: Mit fünfzehn wurde ihre Mutter einem Manager zugewiesen, der auf Jungfrauen stand. Aufgrund eines unerwarteten Zeitfensters in seinem Terminkalender wurde sie schwanger.
Immer wieder saß Tiptree ein kleines Teufelchen auf der Schulter und ließ sie selbst erschreckende Dinge mit erkennbarem Amüsement schreiben. Etwa in "Aus dem Überall" ("Out of the Everywhere"), wo ein Bewohner des interstellaren Raums auf der Erde notlandet und seinen Geist auf drei Menschen aufteilt. Einer davon ist die neugeborene Paula, die in der Folge zu einem hochbegabten Kind heranwächst und in ihrer Mischung aus Unschuld und grausamer Konsequenz ein weiteres Beispiel für Tiptrees moralisch nicht eindeutig bewertbare Figuren ist. So verführt Paula ihren eigenen Vater, und als zwei Feinde der Familie bei einem von Paula inszenierten Unfall das Augenlicht verlieren, lässt sie ihnen Blumen ins Krankenhaus schicken: "Am besten welche, die man auch riechen kann, nicht?"
Als besonderes Zuckerl enthält "Zu einem Preis" mit der Titelgeschichte die meines Wissens erste deutschsprachige Version der Novellette "Excursion Fare" aus dem Jahr 1980. Darin wird das Ballonfahrer-Paar Philippa und Dag nach einem Absturz auf hoher See von einem Hospizschiff aufgefischt, das seinen todkranken Passagieren fernab von Staaten und Gesetzen zur Einschränkung des Medikamentengebrauchs eine letzte Heimstätte bietet. Die Erzählung berührt mit einer Reihe furchtbar trauriger, aber auch tröstlicher Momente - und einer subtilen Ironie: Denn während man an Bord der "Charon" die Philosophie vertritt, Menschen lieber glücklicher als länger leben zu lassen, läuft mit der Zivilisation als ganzer gerade der umgekehrte Prozess ab.
Im Anhang befinden sich noch Auszüge aus Briefen Alice Sheldons - gleichzeitig ein erster Vorgeschmack auf die große Tiptree-Biografie "Das Doppelleben der Alice B. Sheldon", die noch heuer bei Septime erscheinen soll. Dafür schon mal einen Ehrenplatz im Regal freihalten!
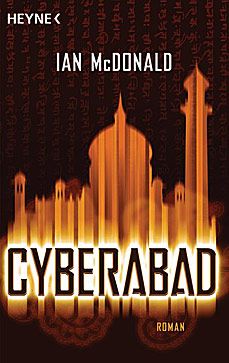
Ian McDonald: "Cyberabad"
Broschiert, 799 Seiten, € 11,30, Heyne 2012 (Original: "River of Gods", 2004)
Über zehn Jahre ist es her, dass zuletzt ein Roman des britischen Autors Ian McDonald auf Deutsch erschienen ist, nachdem er in den 90ern in den heimischen Buchläden gut vertreten war. Jetzt endlich kommen wir auch hier in den Genuss dessen, was mittlerweile als sein Hauptwerk gelten darf: Eine Reihe voneinander unabhängiger Nahzukunftsromane aus der vermeintlichen Peripherie. Die in Afrika angesiedelte "Chaga"-Saga hatte McDonalds Ausrichtung auf postkoloniale SF bereits in den 90ern vorbereitet, mit "River of Gods" ("Cyberabad") und Indien als Schauplatz lieferte er 2004 sein Meisterstück ab. Es folgten 2007 Brasilien ("Brasyl") und 2010 die Türkei ("The Dervish House") – hoffentlich werden die jetzt auch noch übersetzt. Ironischerweise ist McDonald inzwischen von seinem großen Themenschwerpunkt der Nuller Jahre vorerst abgekehrt: Letztes Jahr veröffentlichte er mit "Planesrunner" einen Young-Adult-Roman um einen Jungen, der durch parallele Welten slidet.
Zuvörderst: Nicht aufgeben! "Cyberabad" verlangt einem gleich zu Beginn so einiges ab, wenn wir in eine Welt hineingeworfen werden, die an Detailfülle kaum zu überbieten sein dürfte. McDonald selbst hat Indien als "Angriff auf die Sinne" bezeichnet, und diese Erfahrung reicht er gnadenlos an uns weiter. In den Eröffnungspassagen werfen wir anhand des Wegs einer Leiche, die den Ganges hinuntertreibt, einen ersten eingeschüchterten Blick auf ein monumentales Panorama, das von seinen Kontrasten lebt. Wo Lagerfeuer vor den Gaswolken transnationaler Aufbereitungsanlagen lodern und uralte Bauten den Glaspalästen von New Varanasi gegenüberstehen. Straßen beginnen im einen Jahrtausend und enden in einem anderen – einer der Hauptreize, die die Atmosphäre des Romans ausmachen.
"Cyberabad" hat die Terminus-Dichte eines Cyberpunk-Romans ... nur dass hier zu all den Begriffen für fiktive Zukunftstechnologien und Modemarken noch eine Lawine an Hindi-Wörtern kommt. Das geht bis zur totalen Reizüberflutung und wird vor allem dann zur Herausforderung, wenn mit Thal erstmals ein sogenanntes Neut die Bühne betritt: Ein chirurgisch zur Geschlechtslosigkeit umgestalteter Mensch, der als Personalpronomen ys und als Possessivpronomen sys verwendet – das erste Kapitel, in dem all diese Faktoren zusammentreffen, wird man am besten langsam und behutsam lesen. Für die zahllosen Begriffe aus dem indischen Alltag und der Hindu-Mythologie gibt es am Romanende übrigens ein umfangreiches (und dennoch unvollständiges) Glossar. Von hektischem Hin- und Herblättern würde ich aber eher abraten, weil es den Lesefluss zu sehr unterbricht. Apsaras von Yakshas unterscheiden zu können, ist nicht so wichtig und vieles ergibt sich ohnehin aus dem Zusammenhang. Am besten ist es, sich ganz und gar dem Flow zu ergeben.
Zum Setting: Mit 2047 hat McDonald ein symbolisches Datum gewählt. Es ist das 100. Jubiläum von Indiens Unabhängigkeit, doch ist der Riesenstaat mittlerweile in mehrere – immer noch große – Nationen zerfallen. Eine davon ist Bharat am Unterlauf des Ganges, eine dynastische Demokratie unter der Regentschaft einer Familie, die starke Parallelen zu den Gandhis aufweist. Der Monsun ist seit langem ausgeblieben und mit den Nachbarn zeichnet sich ein Krieg ums Wasser ab, doch das ist nur eines der Handlungselemente. Wir treffen auf neue Brahmanen, durch Gentechnik auf Langlebigkeit gezüchtete "goldene Kinder" mit gruseliger Anmutung. In den Sundarbans genannten Daten-Oasen werden Künstliche Intelligenzen von immer höherer Selbstständigkeit ausgebrütet – im Rest der Welt sind diese Kaihs streng verboten und selbst in Bharat macht man auf die allerintelligentesten unter ihnen kompromisslos Jagd. Im Erdorbit wird ein Milliarden Jahre altes Artefakt entdeckt und schlussendlich wäre da noch ein Unternehmen, das eine neue Methode der Energiegewinnung entdeckt, indem es Universen mit unterschiedlichen Grundzuständen anzapft. Kurz: Hier rauscht's im Karton.
Trotz all dieser Ideen sind es aber die Menschen, die McDonald in den Vordergrund stellt. Jede(r) aus dem knappen Dutzend an ProtagonistInnen wird als glaubwürdiger Charakter geschildert. Jeder hat seine eigene Sprache und jeder hat auf seine Weise mit seiner Rolle bzw. Identität zu kämpfen. Wie Vishram Ray, Spross einer reichen Unternehmerfamilie, der es sich in Europa als Stand-up-Comedian und Womanizer gut gehen lässt. Bis er von der Familie zurückgerufen wird und neue Qualitäten an sich entdeckt. Der berühmte Ernst des Lebens wird auch das Neut Thal, ein naiver, vergnügungssüchtiger Schmetterling vor dem Herrn, verändern – Mr. Nandha hingegen kennt ihn schon, und zwar mehr als gut für ihn ist. Als Krishna-Cop macht er Jagd auf illegale Kaihs; ihn lernen wir bei der "Exkommunikation" einer "besessenen" Fabrik kennen – ein Motiv, das an viele klassische SF-Plots erinnert. Nandha hat – ohne deswegen als unsympathische Figur rüberzukommen – sein Berufsleben wie auch sein privates pedantisch durchorganisiert, was nicht zuletzt seine Ehefrau Parvati in die Vereinsamung treibt. Derweil glaubt der brutale Straßengangster Shiv zu Höherem berufen zu sein und der Regierungsberater Shaheen Badoor Khan fürchtet den tiefen Fall, weil er eine gesellschaftlich inakzeptable sexuelle Vorliebe für Neuts hat.
Zwei der Hauptfiguren kommen aus dem "Westen", beide sind WissenschafterInnen. Evolutionsbiologin Lisa Durnau wird von der NASA zu einem Asteroiden gebracht, in dem man einen nicht von Menschen gebauten zellulären Automaten entdeckt hat. Und der, obwohl älter als das Sonnensystem, zeigt Lisas Gesicht. Plus das ihres ehemaligen Kollegen Thomas Lull, der seit Jahren von der Bildfläche verschwunden ist. Gegenwärtig lässt Lull sich durch Indien treiben, wo er auf die seltsame junge Frau Kij trifft, die offenbar mit Maschinen kommunizieren kann. Lisa, Thomas und Kij wird zwar nicht mehr Erzählraum als den anderen Figuren gewährt, doch sind sie am unmittelbarsten mit den Handlungsteilen verbunden, die die eigentlichen SF-Elemente von "Cyberabad" enthalten. Für die McDonald Informationstechnologie und indische Mythologie in wirklich überzeugender – und rein wissenschaftlicher – Manier verschmilzt: Der für unsere Denkweise ausgesprochen fremdartige Götterhimmel des Hinduismus, in dem all die schwindelerregende Vielfalt an Hierarchien und Manifestationen letztlich nur Ausdruck eines Einzigen ist, erweist sich als taugliche Versinnbildlichung einer anderen Art des Seins und Denkens ... wie die Kaihs sie darstellen. Einmal mehr erinnern wir uns an den sprachlichen Ursprung des Worts Avatar.
Wenn die Journalistin Najia Askarzadah einmal darüber sinniert, wie sich auf einer Landkarte die großen Beschriftungen (wie sie z.B. für Länder stehen) hinter der Fülle an punktuellen Details zu verstecken scheinen, dann entspricht dies der Anlage des Romans: Zwischen all den unzähligen Einzelpunkten der Handlung liegt – und bewegt sich – etwas, das zu groß und zu subtil ist, um gleich gesehen zu werden. Manchmal kreuzen sich die Wege der ProtagonistInnen im gewaltigen Mosaik von "Cyberabad", manchmal bleiben die Bezüge nur indirekt. Keiner von ihnen hat einen Gesamtüberblick, und es kann vorkommen, dass sich Geschehnisse in einem Kapitel erst im nächsten durch eine veränderte Perspektive erklären. SF-Autor Christopher Priest, der "Cyberabad" als "John Brunners 'Stand on Zanzibar' für die digitale Generation" bezeichnet hat, brachte es auf den Punkt: It is not a page-turner book; it is a turn-page-back book. Aber ein grandios lesenswertes.
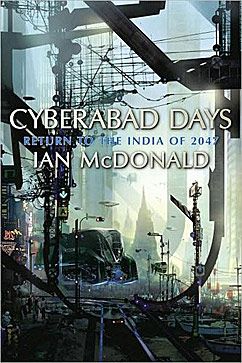
Ian McDonald: "Cyberabad Days"
Broschiert, 279 Seiten, Pyr 2009
An dieser Stelle bietet sich natürlich an, die Erzählungen zu lesen, mit denen Ian McDonald seinen Roman "River of Gods" ergänzt hat. Darauf, dass diese Sammlung von Kurzgeschichten aus den Jahren 2005 bis 2009 ebenfalls ins Deutsche übersetzt werden wird, würde ich mich eher nicht verlassen, Kurzformate gelten ja als Kassengift. Wer jetzt aber befürchtet: Ogötterogötter, da ist McDonald sprachlich aus den genannten Gründen eh schon eine Herausforderung ... und jetzt das Ganze auch noch auf Englisch?? Keine Sorge: Die sieben Erzählungen lesen sich ausgesprochen leicht - vermutlich dem ganz banalen Umstand geschuldet, dass sie ursprünglich in Magazinen wie "Asimov's Science Fiction" veröffentlicht wurden und McDonald sie so gestalten musste, dass auch LeserInnen an Bord bleiben, die nicht hunderte Seiten Zeit haben, seine Welt zu ergründen.
Setting und Atmosphäre sind dennoch dieselben wie in "River of Gods", und die Novelle "Vishnu at the Cat Circus", der einzige Original-Beitrag zu dieser Sammlung, enthält sogar eine Art Fortsetzung des Romans; kurze Gastauftritte bekannter ProtagonistInnen inklusive. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Vishnu: Ein Brahmane der neuen Art, also ein genetisch aufgewertetes Kind - der Traum aller ehrgeizigen Mittelstandseltern. Doch wie so oft gerät der Traum der Elterngeneration zum Albtraum der Kinder und Vishnu klinkt sich bewusst aus seinem vorgesehenen Schicksal aus. Anhand von Vishnus äußerst abwechslungsreichem Lebensweg - wir lernen ihn als vermeintlichen Spinner kennen, der mit dressierten Katzen über die Dörfer zieht - schreibt McDonald eine Chronik, die vor den Ereignissen von "River of Gods" beginnt und schließlich Jahrzehnte darüber hinausgeht. Vishnu übernimmt die Rolle eines außenstehenden Beobachters und vermag mit seinen Brahmanensinnen das Gesamtbild der Entwicklung zu sehen, welche unaufhaltsam auf eine informationstechnologische Singularität zusteuert.
Apropos Katzen: Kyle was the first to see the exploding cat ist ein ziemlich gelungener Eröffnungssatz. Die wandelnden robotischen Bomben, die sich still und heimlich auf ihr Ziel zuschleichen, hatten bereits im Kriegsszenario von "River of Gods" ihren Auftritt und werden in der Erzählung "Kyle meets the River" noch einmal gestreift. Titelfigur ist der jugendliche Sohn eines US-amerikanischen "Nation Builders", der eingeflogen wurde, um der noch jungen Nation Bharat auf die Beine zu helfen. So sieht Kyles Vater zumindest selbst seine Rolle. Außerhalb seiner Gated Community schert man sich allerdings relativ wenig um die ausländischen ferengi, sie bleiben Fremdkörper im Strom des Lebens, der das ewige Indien durchfließt. Das Gefühl der Kontinuität, das bereits "River of Gods" vermittelte, kommt in dieser Kurzgeschichte ebenso zum Tragen wie in "Sanjeev and Robotwallah". Hier schließt sich ein Dorfjunge einer Gruppe von Jugendlichen an, die Kampfroboter fernsteuern. Klingt nach "Neon Genesis Evangelion", ist aber weder so glamourös noch so spektakulär. Das antiklimaktische Ende der Geschichte unterstreicht die Grundphilosophie, wonach es immer irgendwie weitergeht, man sich lediglich neuen Umständen anpassen muss.
Während "River of Gods" hauptsächlich in Bharat handelte, lernen wir nun auch andere Nachfolgestaaten des zerfallenen Indien kennen. "The Little Goddess", das übrigens vor ein paar Jahren in der mittlerweile leider wieder eingestellten Zeitschrift "Pandora" schon einmal auf Deutsch erschienen war (in einer anderen Übersetzung), führt uns noch ein Stückchen darüber hinaus: In Nepal wird die Ich-Erzählerin, zunächst noch ein kleines Mädchen, als Inkarnation einer Göttin verehrt. Später, heimatlos geworden, schmuggelt sie per Gehirnimplantat illegale Künstliche Intelligenzen über die Grenze - nun trägt sie wirklich "Dämonen" in sich. Ungewöhnliche Biografien haben auch die Tänzerin Esha im Hugo-prämierten "The Djinn's Wife" und das Mädchen Padmini in "The Dust Assassin". Esha geht eine Liebesbeziehung mit einer Künstlichen Intelligenz ein und gerät schließlich in ein Drama um Liebe und Verrat, das ganz den TV-Soapis entspricht, die bereits in "River of Gods" eine wichtige Rolle spielten. Und Padmini bekam einst vom Vater gesagt, dass sie "eine Waffe" sei. Im Zuge der blutigen Vendetta zweier mächtiger Unternehmerdynastien erkennt sie schließlich die Wahrheit dieser Aussage.
"The Little Goddess" und "The Dust Assassin" mit seinen unverkennbar märchenhaften Zügen gehören zu den besten Geschichten dieser Sammlung. Das gilt auch für "An Eligible Boy", in dem dem Titel zum Trotz die Hauptfigur ausnahmsweise mal ein Erwachsener ist. McDonald nützte seine Kurzgeschichten, die allesamt nach "River of Gods" veröffentlicht wurden, um Aspekte stärker herauszuarbeiten, die im Roman zu kurz gekommen waren. Wie etwa die Brahmanen in "Vishnu and the Cat Circus", auch wenn mich just dieses Element am wenigsten überzeugt: Doppelt so langes Leben durch halb so schnelles Altern, gut und schön. Aber kann im Körper eines Neunjährigen wirklich ein "18-jähriger" Sexualtrieb (samt der Unfähigkeit, diesen in die Praxis umzusetzen) stecken oder ist der Geist nicht - mindestens - auch eine Funktion des Körpers?
... wie auch immer, "An Eligible Boy" widmet sich einem anderen Thema, nämlich dem Geschlechtermissverhältnis, das seit dem Aufkommen pränataler Eingriffe in den indischen Staaten eingekehrt ist: Auf jede Frau kommen nun vier ehemalige Wunschsöhne. Und die haben nun alle Hände voll zu tun, um eine Ehefrau zu finden. Wie der junge Jasbir, der sich mit wachsender Verzweiflung herausputzt, bei Dating-Agenturen antanzt und sich sogar von einem Kaih-Berater zum Gentleman umgestalten lässt ... "My Fair Lady" auf Indisch, sozusagen. Aber ein Hauch James Bond ist auch mit im Spiel, genauer gesagt die Titelmusik von "Octopussy" (spielt ja passenderweise in Indien): "Funny how it always goes with love, when you don't look, you find". Und so stehen kleinere und sehr viel größere Überraschungen am Ende der tragikomischen Liebesgeschichte. Für mich der liebenswerte Höhepunkt einer Story-Sammlung, die zwar keine notwendige, aber doch eine empfehlenswerte Ergänzung zu "River of Gods"/"Cyberabad" ist.
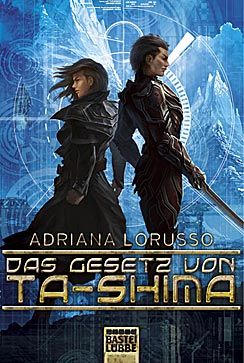
Adriana Lorusso: "Das Gesetz von Ta-Shima"
Broschiert, 702 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Ta-Shima", 2007)
Meiner Rechnung nach ist dies erst das zweite Buch von einem/r italienischen AutorIn in vier Jahren Rundschau. Und selbst das gilt nur bedingt, denn veröffentlicht wurde der Romanerstling der mehrsprachigen Adriana Lorusso im Original auf Französisch. 2007 war das, da hatte Lorusso bereits die 60 überschritten. Und auch wenn dieses späte Debüt noch ein paar Kinderkrankheiten aufweist, ist Lorusso doch eine willkommene Bereicherung für die Science Fiction - widmet sie sich doch einem Subgenre, das noch darauf wartet, wieder zu solcher Blüte zu gelangen wie einst in den 70er Jahren: Social SF.
Lorusso lässt zwei menschliche Kulturen aufeinander treffen: Die der in einer Föderation zusammengefassten raumfahrenden Menschheit und die des kürzlich erst wiederentdeckten Kolonialplaneten Ta-Shima. In sieben Jahrhunderten Isolation hat sich dort eine eigentümliche Gesellschaft herausgebildet, die sich ihrerseits in zwei verschiedene Rassen von höchst unterschiedlicher Art aufteilt, die Shiro und die Asix. Die - wenn sich dieses Wort hier überhaupt anwenden lässt - dominanten Shiro sind grazile, langlebige Geschöpfe, die sich einem strengen Ehrenkodex, dem Sh'ro-enlei, unterwerfen und ihre Gefühle unterdrücken. Mit Ausnahme ihres leicht entflammbaren Jähzorns, den sie in unzähligen Fechtduellen austragen (was Lorusso reichlich Gelegenheit bietet, ihre eigenen Kampfsport-Erfahrungen einfließen zu lassen). Ganz anders die friedlichen und lebenslustigen Asix: Äußerlich von gedrungener Gestalt, muskulös und stark behaart, sind die naiv wirkenden Asix für die körperlichen Arbeiten zuständig, während die Shiro den Laden führen.
Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Was nach dem üblichen Verhältnis von Herrschern und Dienenden klingt, ist in Wahrheit sehr viel komplexer - Lorussos größte Stärke liegt darin, ein System aus zwei (Sub-)Kulturen zu entwerfen, die völlig unterschiedlich sind und dennoch nahtlos ineinander greifen. Zwar stehen unter den Shiro Gewalt und körperliche Züchtigung auf der Tagesordnung - doch niemals würden sie die Hand gegen einen Asix erheben. "Wir sind für die Asix verantwortlich", wiederholen die Shiro fast mantra-artig - mit der Folge, dass in der Gesellschaft von Ta-Shima zwei völlig unterschiedliche Regelsysteme parallel zur Anwendung kommen. Die Clans, in die sich diese Gesellschaft aufteilt, umfassen dennoch jeweils Shiro und Asix gleichermaßen, und es kann mitunter auch vorkommen, dass ein Asix eine Karriere macht, die ihn zum Vorgesetzten eines Shiro werden lässt. Und es wird noch ungewöhnlicher: Denn während die Reproduktion streng geregelt ist, darf in Sachen Sex als zwangloses Freizeitvergnügen alles ausgekostet werden, was die Heterosexualität zu bieten hat. Inzest ist ebenso gang und gäbe wie flotte Dreier und Sex zwischen Shiro und Asix. In aller Regel werden befruchtete Shiro-Eier sogar Asix-Leihmüttern implantiert - Phänomene wie Ehen oder Familien sind den Shiro gänzlich unbekannt.
Kein Wunder, dass BesucherInnen von außerhalb die größten Schwierigkeiten haben, zu verstehen, wie die Kultur von Ta-Shima funktioniert. Die Einheimischen machen es ihnen aber auch nicht leicht, sie sind durchaus borniert, halten aufgrund ihrer spartanischen Lebensweise sämtliche kulturellen Errungenschaften für "unnützes Zeug" und sprechen Außenweltlern überhaupt das Menschsein ab. Nicht zuletzt das seltsam unversöhnliche Ende des Romans zeigt die tiefe Kluft zwischen den Kulturen. Lorusso tritt mit ihrem Roman in die Fußstapfen von AutorInnen wie Ursula K. LeGuin, Joan Slonczewski oder Pamela Sargent ("Planetary Adventure" ist wirklich eine weibliche Domäne, erst recht unter Social SF-Vorzeichen). Dass sie - noch zumindest - nicht in deren Liga mitspielt, liegt daran, dass der Roman einige strukturelle Schwächen aufweist. Kurz: Es hapert mitunter am Handwerklichen, vermutlich dem Umstand geschuldet, dass Lorusso noch keine Erfahrungen als Romanautorin hatte.
Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Suvaïdar, die Ta-Shima vor Jahren verlassen hat und auf einem anderen Planeten als Ärztin arbeitet. Als ihre biologische Mutter und zwei ihrer Brüder bei einem Unfall - vielleicht auch einem Attentat - ums Leben kommen, bittet man sie zurückzukehren. Wieder daheim, beobachtet sie das immer brisantere Verhältnis zwischen Außenweltlern und planetarer Bevölkerung und kommt schließlich auch dem Ursprung ihrer zweigeteilten Zivilisation auf die Spur. Klingt nach einem klaren Handlungsbogen, doch dieser Eindruck täuscht. Der Tod der Mutter gerät zwischendurch für lange Zeit zu weniger als einer Nebensache und die Aufklärung am Ende wird auch reichlich flott abgehandelt - das kann ebenso wenig einen großen Rahmen abgeben wie der Konflikt Ta-Shimas mit der Föderation, der eher vor- und zurückkreucht, statt Eskalationsstufen zu zeigen.
Neben Suvaïdar noch weitere Namen zu nennen lohnt nicht - zu oft verschwinden Nebenfiguren, die vielversprechend aufgebaut wurden, wieder aus der Handlung oder sterben gar schnöde im Off. Und warum beginnt der Roman mit einem ausführlichen Kapitel aus Suvaïdars Jugend? Das erweckt den Eindruck, dass der Roman abwechselnd auf zwei Zeitebenen voranschreiten wird, zumal Lorusso in Kapitel 3 noch einmal auf die Vergangenheitsebene zurückkehrt. Dann aber lässt sie sie fallen - und das noch vor dem entscheidenden Zeitpunkt von Suvaïdars Gang ins Exil. Wie der abgelaufen ist, wird später in einem Gespräch nur kurz erwähnt. Und wieder ist damit etwas erzähltechnisch Wichtiges im Off geblieben. Eine Autorin mit mehr Bedacht auf den Aufbau hätte die Vergangenheitsebene entweder stärker ausgebaut oder sie ganz weggelassen.
Im Klappentext steht, dass Lorusso selbst die Übersetzung ihres Romans ins Französische überwacht habe. Das hätte sie vielleicht auch mit der deutschsprachigen Ausgabe tun sollen, denn da sammelt sich auf 700 Seiten doch so einiges an sinnentstellenden Fehlern an. Es verwirrt beim Lesen, wenn falsche Namen oder Personalpronomina verwendet werden, auf einer knapp vierhundert Quadratmeter langen Halbinsel bringen höchstens Ameisen drei Städte unter und es ist auch keineswegs dasselbe, ob man einen kompatiblen Planeten mit menschlichem Leben entdeckt oder einen, der mit menschlichem Leben kompatibel ist. Noch einmal drüberlektorieren würde dem Text nicht schaden.
Nichtsdestotrotz hinterlässt "Ta-Shima" wegen seiner originellen Ideen einen positiven Eindruck. Auf Französisch ist 2008 mit "L'exilé de Ta-Shima" ein weiterer Band erschienen. Wenn der ebenfalls auf Deutsch herauskommt, werde ich ihn garantiert lesen.
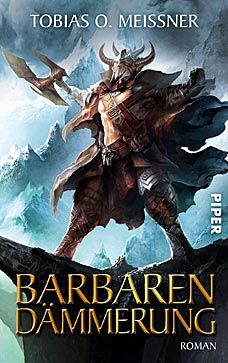
Tobias O. Meißner: "Barbarendämmerung"
Broschiert, 383 Seiten, € 16,50, Piper 2012
Tobias O. Meißner ist so eine Art Wundertüte der Fantasy: Der deutsche Autor ("Die Soldaten", "Die Dämonen") experimentiert gerne, bringt modernistische Elemente sowohl in den Stil als auch die Handlung seiner Romane ein - und hat damit bemerkenswerten Erfolg. Nicht jedes Experiment glückt, aber spannend mitzuverfolgen ist es immer. Und das hat noch nie so sehr gegolten wie für seinen aktuellen Roman "Barbarendämmerung", der im Prinzip ein einziges Testgelände darstellt.
Wobei es nur bedingt ein Roman ist, eher schon eine Abfolge lose verbundener Episoden, in deren Zentrum jeweils die namenlose Hauptfigur steht: Der Barbar, der durch eine quasi-mittelalterliche Welt zieht und dabei eine rekordverdächtige Blutspur hinterlässt. Er kämpft gegen Geister und Riesenvögel. Er säuft sich besinnungslos und wird Rausschmeißer in einem Freudenhaus. Er wird zur Verteidigung einer Burg, für einen Einbruch und den Kampf gegen "Götter" engagiert. Er platzt in eine Orgie und richtet ein Blutbad an. Er wird gehetzt und schlachtet seine Verfolger ab (ehrlich, man möchte kein Ordnungshüter in einer Stadt sein, die vom Barbaren besucht wird). Zweimal steht er vor der Hinrichtung. Und wieder gibt es ein Massaker. Der Gore-Faktor der streckenweise ultrabrutalen Handlung ist enorm, hier wird so ziemlich jedes menschliche Organ aus seinem Kontext gelöst.
"Seht die absolut reine Gewissenlosgkeit des Menschenvernichters! Des Menschenüberwinders. Sogar in sich selbst überwindet er den Menschen", schwadroniert ein Gelehrter im Hörsaal, während sich neben ihm der Barbar den Studiosi präsentiert. Seine Gleichgültigkeit und sein Schweigen (nur einmal im ganzen Roman sagt er ein Wort, und das geht im allgemeinen Lärm unter) machen den Barbaren für seine Umwelt zur rätselhaften Leerstelle, auf die sie ihre Vorstellungen projizieren. Er ist der "edle Wilde", der Held und Erlöser, das Sexobjekt, die Bestie, der anthropologische Modellfall. Und in Wirklichkeit nichts davon. Allerdings schlüpfen Meißner auch manche Gedankengänge des Barbaren durch, die nicht zu diesem Konzept von einem Individuum ohne jeden Bezug und ohne jede Beziehung passen. Mit verächtlichen Überlegungen zum "modernen" städtischen Leben ist der Barbar nämlich recht schnell bei der Hand - irgendeine Kulturisierung muss ihn wohl doch geformt und zu diesem Denken gebracht haben. So manche giftige Bemerkung könnte auch von einer grantigen Oma vom Land stammen.
Der Barbar mag eine Hommage an Robert E. Howards Conan sein (als er noch der stoische Schwertschwinger am Anfang seiner Karriere war), Django bietet sich als Vergleich aber auch an: Eine schweigende Ur-Gewalt, die aus dem Nichts kommt und nur sich selbst verantwortlich ist. Wie in den zynischeren Italo-Western werden in "Barbarendämmerung" auch nicht unbedingt die Guten verschont und die Widerwärtigen immer bestraft. Zudem lässt sich der Barbar auch nicht als zwar brutale, aber im Grunde doch positive Figur bewerten: In einem Kapitel verfolgt er eine Frau, dringt in ihr Haus ein und - auch wenn dieser Teil ausgespart bleibt - vergewaltigt sie. Gewaltausbrüche kommen oft unerwartet - in ihrer Beiläufigkeit haben sich mich am ehesten an das SF-Comic "RanXerox" von Liberatore/Tamburini erinnert - und treffen durchaus auch Unschuldige.
Dass Meißner oft in Ellipsen statt in ganzen Sätzen schreibt, passt gut zum Denken der Hauptfigur, welches in schnellen Eindrücken und schnellen Reaktionen abläuft, ist aber nur ein Stilmittel von vielen. Meißner baut Verse ein, spielt mit dem Klang von Worten oder sogar dem Seiten-Layout. Dabei wirft das Sprachlabor Gelungenes ebenso aus wie Missglücktes - eine umständliche Partizipialkonstruktion hier, eine gar zu pathetisch geratene Formulierung da (Durstig schnitt es sich durch Schicksale; gemeint ist ein Beil). Und gelegentlich treffen wir auch wieder auf jene altertümelnden Formulierungen, mit denen Fantasy-AutorInnen gerne mal ihre Texte anreichern und über die sich Terry Pratchett so gerne lustig macht: Jemand bietet etwas feil, einen anderen dünkt etwas - in dem Punkt gebe ich Pratchett recht, in modernen Texten wirkt so etwas genau nie authentisch. Und ist im hier vorliegenden Fall eigentlich auch gar nicht notwendig.
Am besten betrachtet man "Barbarendämmerung" eher als Sammlung von Kurzgeschichten denn als Roman, auf diese Weise fallen Unstimmigkeiten nicht mehr ins Gewicht. Etwa die, dass der Barbar mal als rein triebgesteuertes, fast schon animalisches Wesen erscheint - später aber erstaunliches intellektuelles Vermögen offenbart, wenn er zur Rekonstruktion eines Tathergangs alternative Szenarien in seinem Kopf durchspielt, fast so analytisch wie Sherlock Holmes. Liest man "Barbarendämmerung" bluttröpfchenweise als eine Reihe individueller Kurzgeschichten, vermisst man auch keinen stilistischen roten Faden mehr - jede Episode, ob nun surreal oder super-straight - hat dann ihr eigenes Profil und ihre eigenen Stärken. Wie anfangs gesagt: Meißner experimentiert gerne, mal besser, mal schlechter. Aber immer wieder interessant.
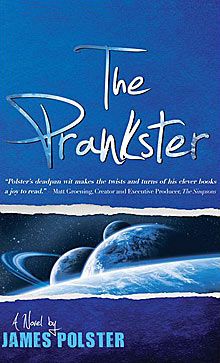
James Polster: "The Prankster"
Broschiert, 112 Seiten, 47North 2012
Was, wenn die großen Mysterien der Welt allesamt nur ein Hoax wären? Also die ägyptischen Pyramiden, der kommerzielle Erfolg des Heavy Metal, Tiger Woods' Unfall nach Ehebruch oder die Existenz Kanadas? Und wenn dahinter der Moderator einer außerirdischen Reality-Show steckte, der zum Gaudium seines Alien-Publikums die irdische Zeitlinie manipuliert? So lautet die attraktive Grundidee für James Polsters jüngste Novelle ... und zugleich ist es das, worum es in "The Prankster" skurrilerweise überhaupt nicht geht.
Zwar stimmt es, dass der superslicke Pom Trager vom Planeten Archano durch die Show "The Prankster" führt. Wir erleben ihn, wie er sich ins Bigfoot-Kostüm wirft, Jesus übers Wasser wandeln lässt und Timothy Leary mit LSD bekannt macht - aber nur in ultrakurzen Schnipseln, Best-of-Ausschnitten aus seiner Erfolgsshow. In der Folge werden gelegentlich augenzwinkernde Andeutungen gemacht, meist ohne auch nur zu erwähnen, wie genau (und ob überhaupt) Trager an den betreffenden Stellen in den Geschichtsverlauf eingegriffen hat. Viel mehr interessiert den Autor, was passiert, als Trager eines Tages nicht an den gewünschten Zielort teleportiert wird, sondern aus ein paar Metern Höhe in den Rio Grande klatscht. Jetzt hängt er nämlich auf der Erde fest, und es bleibt ihm nur ein sehr kleines Zeitfenster, um zum einzig möglichen Abreisepunkt nach San Francisco zu gelangen.
Bezeichnenderweise ist auf Archano keiner aus dem Produktionsteam willens, dem eitlen Gecken zu helfen. Ausgerechnet Frapp, der gerade erst gefeuerte Regisseur der Show, opfert sich und reist Trager nach. Seine Unterstützung vor Ort hält sich mangels Erd-Erfahrung zwar in Grenzen, aber irgendwie setzen sich die beiden dann doch in Bewegung. Chauffiert von der jungen Mutter Kit, die angesichts der Merkwürdigkeit ihrer beiden Fahrgäste wiederholt vor einem Scherbenhaufen steht. Sie nimmt's aber zunehmend gelassen, nachdem sie erst einmal zur Überzeugung gekommen ist, dass die beiden zwar seltsam, aber nicht gefährlich sind. Verfolgt von einem eifersüchtigen Sheriff und geplagt von hartnäckigen Autodieben, steuern die drei in der Folge durch eine Art Roadmovie, garniert mit ein paar Raum-Zeit-Diskontinuitäten samt Auswirkungen, die an Douglas Adams denken lassen.
Genauer gesagt handelt es sich bei "The Prankster" um das Drehbuch eines Roadmovies - ein Kapitelanfang wie "The San Francisco skyline at night. Postcard view." ist ein typisches Beispiel für Polsters knappen Stil der schnellen Eindrücke. Und diese Sparsamkeit tut der Novelle ausgesprochen gut. Hier gibt es kaum Bruhaha-Gags, so sehr sich der Plot dafür auch eignen würde. Polster streicht die Absurdität der Handlung durch Understatement heraus - siehe auch die herrlich banalen Eindrücke, die wir von der Produktion der Show bzw. der Alien-Welt, von der sie ausgestrahlt wird, bekommen.
Ein kleines Rätsel gibt mir der knapp 65-jährige Autor selbst auf, der sich hier auf einem Foto aus jüngeren Tagen mit 70er-Jahre-Bart präsentiert und laut Eigenbeschreibung preisgekrönter Schriftsteller, Journalist, Filmemacher und Abenteurer (er hat sich im Dschungel unter Kannibalen aufgehalten!) ist. Ich kannte Polster bislang nicht und habe ihm daher hinterhergegoogelt - es fanden sich bei erstaunlich dünner Quellenlage ein paar verstreute Artikel aus den 70ern, drei Romane und Coproduction-Credits für einige "Hart aber herzlich"-Folgen. Und vor allem wieder und immer wieder dieselben Formulierungen, wenn es um Polsters Biografie ging. Entweder schreiben einfach alle bedenkenlos voneinander ab, oder wir haben es hier mit einem Mastermind zu tun, das sein öffentliches Leben in gekonnter Form selbst redigiert. Kurzfristig ist mir sogar der Gedanke gekommen, Polster könnte selbst ein Prankster sein. Da sieht man mal wieder, wie Bücher das Denken manipulieren ...
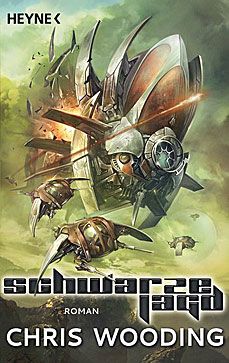
Chris Wooding: "Schwarze Jagd"
Broschiert, 699 Seiten, € 10,30, Heyne 2012 (Original: "Black Lung Captain", 2010)
Ein schönes Beispiel dafür, dass keine Regel ohne Ausnahme bleibt. Denn so einiges, was ich an den Phantastik-Romanen unserer Tage gerne bekrittele, zieht auch der britische Autor Chris Wooding in seiner "Ketty Jay"-Reihe durch, bis der Arzt kommt. Stichwort Action um der Action willen. Was einmal mehr zeigt, dass man alles machen kann, solange man's nur gut macht. Gut = sehr unterhaltsam, in diesem Fall. "Schwarze Jagd" ("Black Lung Captain") ist der Nachfolger zu "Piratenmond" und entführt uns einmal mehr in eine Dieselpunk-Welt voller monströser Flugmaschinen, die lärmend und qualmend sämtlichen Gesetzen der Aerodynamik spotten. Einer Welt übrigens, die offensichtlich Atalon heißt und sich früher einmal auf einem höheren technologischen Stand befunden haben könnte. Sieht aus, als würde Wooding seine Welt Stück um Stück aus vollem Lauf heraus entwerfen. Langsam wird's Zeit für eine Karte!
Im Mittelpunkt steht die nicht eben erfolgsverwöhnte Crew des Luftschiffs "Ketty Jay", ein bunter Haufen gesellschaftlicher Misfits, der sich rund um den Kapitän Darian Frey angesammelt hat. Trotz ihrer Heldentaten im vorangegangenen Band hängen sie nun wieder in ihrem üblichen Leben aus Schmuggelfahrten und leichter Piraterie fest und wurschteln sich mehr schlecht als recht durch. Am Beginn von "Schwarze Jagd" erleben wir sie auf ihrem bisherigen Tiefpunkt: Bei einem Raubüberfall auf ein Waisenhaus, und nicht einmal der glückt. Unerwartete Abhilfe verspricht ein Wissenschafter, der die "Ketty Jay" für eine Expedition nach Kurg engagiert, eine pulpige Insel voller Monster und Tiermenschen. Die Energiekugel, die sie dort aus dem Wrack eines Luftschiffs bergen, setzt dann die eigentliche Handlung in Gang.
Wooding mag seine Hauptfiguren, und das überträgt sich. Nicht dass Darian & Co philosophische Tiefe erlangen würden - aber sie haben Farbe. Auch auf die Nebenfiguren wird diesmal ein bisschen mehr eingegangen, insbesondere auf die Piloten der beiden Begleitflugzeuge der "Ketty Jay": Den schlicht gestrickten Pinn, der glaubt, dass seine Ex-Freundin daheim nach Jahren immer noch auf seine heldische Rückkehr wartet, und den schwer neurotischen Harkins. Letzterer liefert sich ein Dauerduell mit dem Schiffskater Schlacke. Im Prinzip ein humoristisches Element zur Auflockerung zwischendurch ... allerdings handelt es sich bei Schlacke auch wirklich um ein furchterregendes Höllenbiest.
Harkins zeigt auf einem Nebenschauplatz, was Wooding am liebsten macht, nämlich seine ProtagonistInnen mit ihren inneren Dämonen zu konfrontieren. Was zum Teil durchaus wörtlich zu verstehen ist - und Achtung: hier verläuft eine Spoiler-Grenze für diejenigen, die erst "Piratenmond" lesen wollen. Von Schiffsnavigatorin Jez haben wir im ersten Roman erfahren, dass sie den Manen, einer Art dämonischer Entsprechung des Borg-Kollektivs, begegnet und ansatzweise zu einer von ihnen umgewandelt worden ist. Biologisch ist sie genau genommen tot. Von den anderen fühlt sie sich aber vor allem deshalb verachtet, weil sie selbst ihren Manen-Anteil nicht akzeptiert.
Wie auch der Dämonist Grayther Crake immer noch nicht akzeptieren kann, dass er schuld am Unfalltod seiner kleinen Nichte Bess ist, deren Seelenüberreste nun in einem mechanischen Golem weiterexistieren. Als Jez und Crake glauben, eigene Wege gehen zu müssen, sieht Darian seine Crew am Zerbröckeln. Als hätte der Kapitän, der sich selbst sehr viel mehr in Frage stellt, als er nach außen durchdringen lässt, nicht schon genug mit eigenen Problemen zu kämpfen. Nummer 1 auf der Liste bleibt dabei seine persönliche Nemesis Trinica Drakken: Seine ehemalige Geliebte, die er einst mit tragischen Folgen sitzen gelassen hat. Äußerlich zum schreckeinflößenden Gothic Chick umgewandelt, hat sich Trinica zu einer Piratin entwickelt, die Darian an Skrupellosigkeit weit in den Schatten stellt. Spoiler-Ende.
Zurück zum eingangs Gesagten: "Schwarze Jagd" ist wie schon sein Vorgängerband ein Action-Overkill voller Luftduelle und Schießereien (Nebenbei bemerkt: Es sind ganz, ganz schlechte Zeiten für Redshirts!) und reichlich Verfolgungsjagden. Die geben sich gewissermaßen die Klinke in die Hand, weil ein begehrtes Objekt von einer falschen Hand in die andere wandert oder zwischendurch jemand als Geisel entführt wird - und schon heißt's wieder: Alle hinterher! Eine recht durchsichtige Konstruktion, aber langweilig wird's dennoch nicht. Was zum einen an Woodings durchweg sympathischen Hauptfiguren liegt. Und zum anderen daran, dass Sätze wie "Sie machen schon den ganzen Abend ein Gesicht wie ein Darmtumor" halt einfach witziger sind als alles, was z.B. ein David Macinnis Gill im vergangenen Monat vorgestellten "Mars-Labyrinth" aufzubieten hatte.
Wie viele andere AutorInnen setzt Wooding also auf eine simple Mischung aus gewaltsamer Action und flapsigem Humor; er macht's aber gut. Gäbe es im Popcorn-Segment keine Unterschiede, dann wäre "Thor" gleich "Green Lantern" und "Buffy" nicht besser als die schrecklichen Schnepfen von "Charmed". Und wenn wir schon bei TV-Serien und Joss Whedon sind: Die "Ketty Jay"-Reihe könnte Fans von "Firefly" recht gut gefallen. Ein dritter Band, "The Iron Jackal", ist vergangenen Herbst erschienen und müsste es aller Wahrscheinlichkeit nach auch ins Deutsche schaffen.
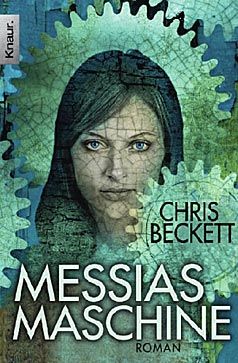
Chris Beckett: "Messias-Maschine"
Broschiert, 331 Seiten, € 10,30, Droemer Knaur 2012 (Original: "The Holy Machine", 2004)
Schimmernd wie ein gernsbacksches Technik-Utopia erheben sich die Glastürme von Illyria an der Westküste des Balkan: Ein von laizistischen Flüchtlingen gegründeter und von Feinden umgebener Stadtstaat in der nahen Zukunft, letzter Hort von Wissenschaft und Humanismus in einer Welt, die ganz und gar in religiösen Wahnsinn - die Reaktion genannt - zurückgefallen ist. So lautet die - durchaus märchenhafte - Prämisse für den ersten Roman des britischen Autors Chris Beckett, der mehrheitlich offenbar sehr gut aufgenommen wurde, mir allerdings doch einige Bauchschmerzen bereitet hat.
Hauptfigur und Ich-Erzähler ist der junge George Simling, ein Bürger Illyrias, der anfangs noch selbstgefällig auf die barbarischen Verhältnisse jenseits der Grenzen hinunterschaut, aber im Verlauf des Romans einige Wandlungen durchmachen wird. George lebt zusammen mit seiner Mutter Ruth, die den Großteil des Tages im virtuellen Raum des SenSpace verbringt, und ist gerade erst dabei, erwachsen zu werden - politisch ebenso wie sexuell. In beiderlei Hinsicht wird die HESVE (Hochentwickelte Sinnliche Vergnügungseinheit) Lucy, eine Sex-Androidin, zur Schlüsselfigur. Weil die auf selbstständiges Lernen programmierten Androiden Illyrias mit zunehmender Intelligenz zu abweichendem Verhalten neigen, wird schließlich eine regelmäßige Löschung ihrer Persönlichkeiten beschlossen. Also stiehlt sich George mit Lucy in die Außenwelt davon.
"Messias-Maschine" hat einige wirklich gelungene Aspekte - etwa die tragikomischen Verwicklungen, die sich ergeben, wenn die äußerlich als Mensch durchgehende Lucy im roboterfeindlichen Nachbarland unpassende Konversationsroutinen aus ihrer Bordell-Grundprogrammierung abruft. Oder das erschütternde Bild von autonom gewordenen Androiden, die Illyria auf endlosen Fußmärschen durchs Gebirge verlassen, um letztlich von abergläubischen DorfbewohnerInnen bestialisch gelyncht zu werden. Oder Ruths Lebensgeschichte: Eine einzige Flucht, die im evangelikalen Gottesstaat der USA begann und in der SenSpace-Sucht nur ihre Fortsetzung nimmt ... und nicht einmal in der Virtualität wird Ruth endgültige Sicherheit finden.
Auf der anderen Seite steht ein reichlich grob skizziertes Grundszenario - wo in Ian McDonalds "River of Gods" eine Welt zu prallem Leben erwachte, wird hier die Inhaltsangabe einer anderen gegeben. Ohnehin ist schwer nachzuvollziehen, wie unter Vernachlässigung aller regionalen und kulturellen Spezifika sämtliche Religionen der Welt gleichzeitig zum großen Schlag gegen die Aufklärung ausgeholt haben sollen. Hier hat das angloamerikanische Christentum die Macht ergriffen, da der japanische Shintoismus und dort die - bezeichnenderweise nicht genannte - chinesische Staatsreligion. Fast scheint es, als hätte sich ein universaler Switch ereignet, wie ihn Matt Hughes gerade in seinen "Prequels" zu Jack Vances "Dying Earth"-Romanen zwischen Wissenschaft und Magie stattfinden lässt ...
In Illyria, zunehmend bedrängt von der Außenwelt, wird der Ton indessen härter. Das Szenario eines von Flüchtlingen aus aller Welt besiedelten und von den religiösen Nachbarn gehassten Staats erinnert ohnehin an Israel - kein Wunder also, wenn sich im rauer werdenden Klima ein Zionismus der Wissenschaft herausschält. Die humanistischen Ideale bröckeln, Einschränkungen der Meinungsfreiheit sind nur der erste Schritt auf dem Weg in den Totalitarismus. "Christen! Juden! Muslime! Schmeißt all die verräterischen kleinen Hetzer raus!" Ihre Augen traten ihr vor Hass und Angst aus dem Schädel. "Oder vergast sie am besten gleich", keuchte der gebückte, zitternde Mann neben ihr. Wenn sich mit derart plakativen Worten in Illyria der Mob in Bewegung setzt - geht es dann noch um die Verrohung einer Gesellschaft, die angesichts einer äußeren Bedrohung ihre Ideale opfert? Oder sind wir schon bei der altbekannten Relativierungstaktik derer, die behaupten, dass Wissenschaft "auch eine Religion" sei? Ich kann diesbezüglich keine Conclusio des Autors erkennen.
"Messias-Maschine" scheint sich im Kern um die klassische SF-Frage zu drehen, was als eigenständiges und als solches zu respektierendes Intelligenzwesen zu betrachten ist. Siehe etwa einige in "Maschinensprache" geschriebene Kurzkapitel, die Lucys Innenleben zeigen und in denen am entscheidenden Punkt aus dieses Exemplar schließlich ich wird. Doch kommt der Autor auch hier zu keinem Ergebnis und Lucy bleibt eine Nebenfigur. Und eine Projektionsfläche für männliche Fantasien.
... das allerdings zieht sich durch das ganze Buch, das Frauen nur in drei Rollen kennt: Als Mutter, Heilige und Hure ... die älteste Kiste von allen. Beckett beschreibt in seinem teilweise recht brutal angelegten Roman, wie sich religiös verklemmte Männer in Illyrias Umland mit einer Mischung aus Begehren und Verachtung an entlaufenen Roboterfrauen abreagieren. Aber ist die Hauptfigur so grundsätzlich anders? Weil George bei echten Frauen nicht landen kann, bucht er eine künstliche Prostituierte - und als die mal gerade andere Kunden bedient, vögelt er sich trotzig durchs übrige Bordellpersonal. Das und der weitere Verlauf seiner Geschichte mit Lucy machen es zumindest zum Teil nachvollziehbar, warum ein Leser des Buchs in seiner Bewertung schrieb, er habe nach einiger Zeit gehofft, dass endlich irgendjemand den Erzähler erledigt. So weit würde ich zwar nicht gehen, allerdings hatte ich auch noch nie groß Sympathien für Geschichten, in denen ein Weg zur Läuterung mit Leichen gepflastert ist.
Alles in allem hätte ich lieber Ruths Roman gelesen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob Beckett den hätte schreiben können.

Tim Daniel & Mehdi Cheggour: "Enormous"
Graphic Novel, 64 Seiten, Image Comics 2012
From the house that brought to you "The Walking Dead", heeere iiiiiis ... "ENORMOUS"! Wobei sich der US-Verlag Image Comics für diese Einzelpublikation im Grunde genommen gar nicht so weit von seinem aktuellen Aushängeschild entfernt hat: Auch "Enormous" erzählt eine klassische Survival Story in Zeiten äußerer Bedrohung. Nur dass die hier nicht in Form von Zombies auf die ProtagonistInnen zuschlurft, sondern als spektakuläre Megafauna über sie hinwegtrampelt. Und zwar wirklich mega.
Fremdartige Invasoren sind in der Science Fiction ja nun wirklich nichts Neues. Eigenartigerweise treten sie in der Regel aber – egal, ob intelligent oder nicht – als Einzelspezies auf. Vergleichsweise selten wird gleich ein ganzes Ökosystem über der Menschheit ausgekippt. In der bildlosen Literatur startete z. B. David Gerrold mit seiner "Chtorr"-Reihe in den 80ern eine biologische Invasion aus dem All, in den 90ern entwarf Ian McDonald mit der "Chaga"-Saga eine andere (und etwas fremdartigere). Nicht zu vergessen auch Stephen Kings Novelle "The Mist", die 2007 sogar verfilmt wurde.
... womit wir schon beim Thema Bilder sind, und die kommen im klotzigen 33x25 Zentimeter-Format von "Enormous" besonders gut. Ein Fest für Kaijū-Freunde! Der Schauplatz ist Arizona rings um das verwüstete Phoenix, ein Jahr nach Ausbruch der Katastrophe. Einer menschengemachten übrigens, denn die übergroßen Äquivalente von Insekten, Vögeln, Reptilien oder Antilopen entspringen einem außer Kontrolle geratenen Experiment zur Wiederbegrünung der Wüste. Hauptfigur Ellen, die in einem Rückblick zu Beginn der Geschichte ihre Mutter an ein garagentorgroßes Maul verlor, führt von einem Bunker in der Wüste aus Rettungseinsätze für Kinder durch, die sich noch irgendwo in den Ruinen der Stadt verbergen mögen. Und wie fast immer in postapokalyptischen Szenarien dieser Art kommen zur äußeren Bedrohung als weitere – und größere – Gefahr noch schwerbewaffnete Menschen, die andere Pläne schmieden als die HeldInnen ...
Tim Daniels Geschichte macht einen fast schon fragmentarischen Eindruck – nicht nur weil das "The End" im letzten Panel mit einem Fragezeichen versehen ist. Im gerafften Ablauf von "Enormous" wird vieles nur angerissen und schreit geradezu danach, weiter ausgearbeitet zu werden. Da die Erzählung zudem diverse räumliche und zeitliche Sprünge vollzieht, glaubt man manchmal, man würde nur die jeweils zweite Seite des eigentlichen Comics lesen. "Enormous" lebt vor allem von den beeindruckenden Illustrationen Mehdi Cheggours, die sich an die Optik von Fotos, die gegen die Sonne geschossen wurden, anlehnen. Mehr muss ich zum Zeichenstil gar nicht sagen – hier gibt es eine Reihe von (vergrößerbaren) Beispielen zu bestaunen. Wer Schwierigkeiten hat, noch ein Exemplar der ersten Auflage zu ergattern, bekommt im Dezember eine zweite Chance: Für dann ist nämlich eine Deluxe-Ausgabe des Bands angekündigt.
Und wir bleiben beim Thema Fremdheit: Die nächste Rundschau dreht sich schwerpunktmäßig um die Schwierigkeiten, die sich aus der Kommunikation mit Aliens ergeben. Dabei wird auch eine originelle Frage erörtert werden: Wird es nicht Zeit, dass all die Außerirdischen, die seit Jahrzehnten den Sendungen von Radio SETI lauschen, langsam mal Gebühren zahlen? (Josefson, derStandard.at, 25.8.2012)