
China Miéville: "Stadt der Fremden"
Broschiert, 430 Seiten, € 10,30, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Embassytown", 2011)
Preisfrage an geekologisch Versierte: Was haben China Miéville, der Meister der barocken Weirdness, und "Star Trek TNG" gemeinsam? Die Antwort liegt in Folge 2 der fünften Staffel ("Darmok"), in der die "Enterprise"-Crew mit einer Spezies zu kommunizieren versucht, die nur in unverständlichen Metaphern spricht. Bei den Ariekei von Miévilles "Stadt der Fremden" ("Embassytown") geht dies sogar noch weiter: Denken und Sprechen sind für sie eins. Die Ariekei sind also nicht nur unfähig die Unwahrheit zu sagen - unbeholfene Annäherungen an Lügen versuchen sie sich in sportähnlichen Wettbewerben abzuringen -, sie können auch nichts formulieren, für das es keine reale Entsprechung gibt. Wie Picard einst in "Darmok" zum Gegenstand einer neuen Metapher werden musste, um den Dialog zu ermöglichen, so wird die Hauptfigur in Miévilles Roman zum Simile: Als Mädchen wurde Avice Benner Cho einst einer absurden und etwas unangenehmen Situation ausgesetzt. Seitdem ist sie Teil des ariekenischen Sprachgebrauchs und ermöglicht durch ihre bloße Existenz, Gedankengänge auszuformulieren, welche sich auf Dinge beziehen, die "wie das Mädchen, das ..." sind.
Zumeist werden Sprachbarrieren in der SF ja ganz wie die Lichtgeschwindigkeitsgrenze eher als Lästigkeit denn als thematische Chance betrachtet. Eine Hürde, über die man sich halt irgendwie drüberschummelt ... sei es mit Universaltranslatoren, Übersetzermikroben oder Babelfischen. Wenn nicht ohnehin alle eine galaktische Einheitssprache sprechen oder gleich telepathisch kommunizieren. Wenn man nach AutorInnen sucht, die sich ernsthafter mit dem Themenkomplex Sprache und Denken auseinandergesetzt haben, landet man gleich bei literarischen Schwergewichten der Phantastik wie Samuel Delany oder Ted Chiang. Es sollte nicht überraschen, dass jetzt auch China Miéville, einer der interessantesten Genre-Autoren der letzten Jahre, da mitmischen will - schon in seinem zwei Jahre zuvor erschienenen Roman "Die Stadt & die Stadt" spielte die Semiotik eine entscheidende Rolle. Es kann übrigens nicht schaden, neben "Stadt der Fremden" ein sprachwissenschaftliches Einführungsbuch liegen zu haben (oder zumindest am Computer ein Wikipedia-Fenster zu öffnen), denn Miéville knallt einem alles, was er bei Paul Ricœur & Co gelesen hat, mit gewohnter Selbstverständlichkeit um die Ohren, dass es nur so raucht. Und wann hat man an einem Kapitelende schon jemals einen Cliffhanger à la "Ich will eine Metapher sein" gelesen?
Zurück zum Planeten Arieka und seinen riesenhaften Bewohnern, für die Miéville ein faszinierend fremdartiges Ambiente aus lebendigen (und zumeist verblüffend mobilen) Häusern, Farmen und Fabriken entworfen hat. Mitten in der exotischen Stadt der Gastgeber, geschützt von einer künstlichen Atmosphärenglocke, liegt die Botschaftsstadt der Menschen bzw. Terre, wie sie hier heißen. Sie gehören dem Staat Bremen an, der Gebiete auf verschiedenen Planeten umfasst - nicht die De-facto-Distanzen sind hier von Bedeutung, sondern wie nahe Welten im Immer beieinander liegen, jener Superstruktur, in die unser Universum - das Manchmal - eingebettet ist. Miéville vergleicht das Immer mit der langue als grundlegendem System, aus dem das Manchmal wie die parole entspringt ... also an der Linguistik hat er wirklich einen Narren gefressen. Hauptsächliche Daseinsberechtigung der am äußersten Rand des bekannten Immer gelegenen Botschaftsstadt ist natürlich der Kontakt mit den Ariekei. Und weil die zu allem Überfluss auch noch aus ihren jeweils zwei Mündern gleichzeitig sprechen, waren Anpassungsleistungen gefragt. Daher ist jeder Botschafter der Menschen trotz Singular-Bezeichnung kein Einzelwesen, sondern ein eigens gezüchtetes Paar von Klonen, die ein Leben lang auf Einklang getrimmt werden. Hinter jeder Äußerung haben zwei Münder und ein Geist zu stecken - alles andere würde von den Gastgebern nicht als Sprache erkannt.
Ich-Erzählerin Avice ist in der Botschaftsstadt geboren. Zwar wird sie nach ihrer Simile-"Karriere" nicht selbst zur Botschafterhälfte, lernt dafür aber die galaktische Außenwelt kennen, da sie als Immer-Eintaucherin zu der Minderheit von Menschen gehört, die Sternenflüge bei vollem Bewusstsein überstehen können, ohne Schaden zu nehmen. Nach einigen Jahren draußen in der Galaxis kehrt sie nach Arieka zurück, kurz bevor sich alles ändern wird. Es beginnt damit, dass Bremen einen Botschafter von eigenen Gnaden auf den Planeten schickt - kein Klon-Paar, sondern zwei Individuen, die noch dazu äußerst unterschiedlich wirken. Zum größten Erstaunen der alteingesessenen BotschafterInnen meistern die beiden dennoch die Gastgebersprache ... zu ihrem noch größeren Entsetzen allerdings nicht ganz. Sie erzeugen eine winzige Dissonanz, und die übt auf den Verstand der Ariekei eine verheerende, suchtauslösende Wirkung aus. Wie eine Epidemie breitet sich die Sucht unter den Gastgebern und ihrem lebenden Environment aus, es folgen Chaos und Zusammenbruch. Wie Laurie Anderson einst sang: "Language is a virus, hooo! / From outer space" (Gut, das Originalzitat stammt von William S. Burroughs, aber das "Hooo" hat Anderson beigesteuert). Nebenbei ist das Ganze ein schöne Umkehrung des alten SF-Topos vom dramatischen Einschnitt, der sich beim Kontakt mit einer fremden Kultur ergibt. Hier sind eben wir die Aliens.
Wie so oft beschreibt Miéville soziale Gärungsprozesse, die apokalyptischen Veränderungen vorausgehen ... es ist wieder einmal Zeit für das Ende der Welt. Obwohl der Handlungsablauf per se ein vertrauter Phantastik-Plot ist, bleibt das Ganze letztlich doch ein wenig abstrakt. Liegt zum einen natürlich am Sprachthema, zum anderen aber auch daran, dass die übrigen Romanfiguren recht austauschbar neben Avice auf- und wieder abtauchen. Was ganz einfach darauf zurückzuführen sein kann, dass wir alles aus ihrer Warte wahrnehmen, und Avice ist eben kein Mensch, der gerne Bindungen eingeht. Doch der Faktor Human Drama entfällt natürlich, wenn die Menge der plastisch geschilderten Figuren < 2 ist.
Den menschlichen Aspekt hat China Miéville in seinen durchaus ähnlichen Bas-Lag-Romanen schon besser hinbekommen. Ungebremst ist hingegen sein Sprachdonnerwetter: Es regnet Neologismen, und zumeist sind sie von surrealerer Anmutung als in der Science Fiction üblich ... ganz wie viele Situationen im Verlauf des Romans selbst. Man brachte das Ding rasch zur Strecke. Sie hämmerten es mit Gelegentlich-Gewehren nieder, die gewaltsam das Manchmal durchsetzen: dieses Zeug, unser Alltägliches, gegen das Stets des Immer, heißt es, als sich ein "blinder Passagier", eine Quasi-Wesenheit aus dem Immer, auf Arieka manifestiert. Schon in früheren Romanen - zuletzt in "Der Krake" - kam es vor, dass abstrakte Konzepte in unsere feststoffliche Welt eindrangen und deren Substanz an sich rissen, um Gestalt anzunehmen. Das ist die typische Handschrift des Autors, und letztlich scheint es so, dass Miévilles Hang dazu, mit Lust und Verve das Unbeschreibbare zu beschreiben, fast zwangsläufig zu einer Handlungsprämisse wie der von "Stadt der Fremden" führen musste.
"Stadt der Fremden" ist insgesamt hochinteressant. Was noch nicht unbedingt dasselbe bedeuten muss wie: ein Vergnügen. Obwohl Miéville mit seinem Roman wieder einmal diverse Preise abgeräumt hat und die Kritiken weitgehend begeistert ausfielen, blieb das Echo aus der Fangemeinde des Autors gemischt. Gelesen sollte man den Roman auf jeden Fall haben - alleine schon, weil hier endlich mal wieder wirklich fremdartige Aliens vorkommen. Zur allgemeinen Erleichterung serviert Miéville - kein Jahr ohne neues Buch - danach aber wieder leichtere Kost: "Railsea", heuer im Original erschienen und hoffentlich spätestens 2013 auch auf Deutsch erhältlich, ist zur Abwechslung mal ein Jugend-Abenteuerroman. Natürlich wieder vor bizarrem Hintergrund.
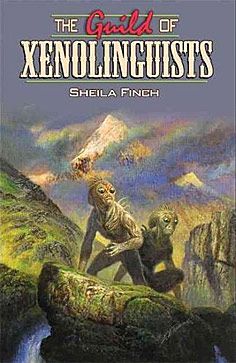
Sheila Finch: "The Guild of Xenolinguists"
Gebundene Ausgabe, 281 Seiten, Golden Gryphon 2007
Und jetzt eine ganz andere Herangehensweise ans Thema Kommunikation mit Aliens - besonders interessant deshalb, weil hier jemand am Werk war, der vom Fach kommt. Ohne böse sein zu wollen, aber China Miévilles "Stadt der Fremden" schien zwischen den Zeilen stets in gnadenloser Begeisterung zu schreien: "He, ich hab Ricœur gelesen, und jetzt baller ich euch das vor den Latz. Schlagt selbst nach, wenn ihr's nicht versteht!". Die aus England nach Kalifornien ausgewanderte Sprach- und Literaturwissenschafterin Sheila Finch geht da schon deutlich geduldiger mit ihren LeserInnen um. Langjährige Lehrtätigkeit - inklusive Kursen zum Thema Science Fiction - mag dazu beigetragen haben, dass Finch ihr Wissen in angenehm unaufdringlicher Form in die Handlung einbaut.
"The Guild of Xenolinguists" umfasst zehn Kurzgeschichten und eine Novelle aus den Jahren 1988 bis 2007, die sich um Finchs wichtigste literarische Schöpfung drehen. Zwei Romane vervollständigen den Erzählzyklus um eine Gilde von Menschen, die als die besten Übersetzer der Galaxis ihre Dienste anbieten. Eine von Finchs Prämissen ist hypothetisch, nämlich dass die Lautpalette, die unser Kehlkopf hervorbringen kann, flexibler ist als bei jeder anderen Spezies im All. Der Rest fußt auf sprachwissenschaftlichen Theorien, insbesondere auf denen von Benjamin Whorf. Sprache beeinflusst demnach das Denken, und letztlich hat die Evolution die Weichen gestellt: Von all den Sinnesreizen, die auf ein Lebewesen einströmen, kann nur ein kleiner Teil verarbeitet werden. Und nur dieser Teil wird später mit "Sprache" - in welcher Form auch immer - belegt. Für den Rest des Wahrnehmungsspektrums gibt es anschließend keinen sprachlichen Ausdruck mehr, er verschwindet somit auch aus dem Denken. Da die evolutionären Auswahlkriterien aber nicht bei allen Spezies die gleichen waren, nehmen diese dieselbe Realität in unterschiedlicher Weise wahr. Die lingsters der Gilde überwinden diese Kluft mit einem Trick: Mit Drogen erweitern sie ihr Bewusstsein und versetzen sich in einen quasi-kindlichen bzw. neutralen Urzustand, von dem aus sie sich in andere Denksysteme einklinken können. Eine ins Gehirn implantierte Schnittstelle zu einer Künstlichen Intelligenz hilft ihnen anschließend, Muster herauszufiltern und eine fremde Sprache (und Denkweise) im Eiltempo zu erlernen.
Hard SF (warum soll sich der Begriff eigentlich immer nur auf Physik beziehen?) und Soft SF verschmelzen hier zu einer Einheit. Typisch für letzteres ist die Betonung der menschlichen Aspekte - Finch stellt ihre ProtagonistInnen stets vor ethische Dilemmata. Eine zentrale Rolle spielt dabei die strikte Neutralität der Gilde. "I am a channel. First was the Word and I am its carrier", wird den Gildenmitgliedern mantra-artig eingepaukt. Niemals Emotionen das Interface beeinflussen lassen, niemals die Botschaft oder deren Absender beurteilen; "Monster" und "Heilige" werden gleichermaßen bedient. Was also tun, wenn der Kunde eine blutrünstige Invasorin ist, die ihre Gefangenen foltert ("Flight of the Words")? Oder ein Bordellbetreiber, der eine Sklavin kauft ("Babel Interface")? Auf die Spitze getrieben wird der Konflikt zwischen Moralvorstellungen und Gilde-Geboten in "No Brighter Glory", in dem eine abgelegene Wasserwelt zum biologischen Versuchsgelände wird. Man versucht verzweifelt, ein Mittel gegen ein tödliches Virus zu finden, das die Galaxis heimsucht. Zugleich sammelt lingster Alyn im Auftrag der Artenschutzorganisation PETAL (!!) Beweise für eine mögliche einheimische Intelligenzform - hat sie Erfolg, müssten die Bio-Experimente sofort eingestellt werden. Finch lässt ihre ProtagonistInnen gerne Menschlichkeit über Regeln stellen. Doch wie entscheiden, wenn es um Auslöschung versus Auslöschung geht?
Andere lingsters, andere seelische Konflikte. Etwa in "Out of the Mouths": Gildenoberhaupt Heron stimmte einst einem verzweifelten Experiment zu, ein Menschenkind zusammen mit dem Baby einer Rasse aufzuziehen, die der Menschheit den Krieg erklärt hat und im wahrsten Sinne des Wortes nicht mit sich reden lässt. ("Out of the Mouths" liefert übrigens nachträglich eine Teilerklärung für die unbefriedigende Auftaktgeschichte "First Was the Word", die seltsamerweise auf gar nichts hinausläuft ... außer zu beschreiben, wie das Wort "Xenolinguist" in die Welt kam.) Die Folgen seiner Entscheidung muss Heron jedenfalls ebenso tragen, wie die desillusionierten Hauptfiguren von "The Naked Face of God" oder "Reading the Bones" ihr Schicksal akzeptieren müssen. Denn nicht alle lingsters sind noch so idealistisch wie Oona in "A World Waiting", die allen Widrigkeiten zum Trotz beschließt, dem gleichgültigen Universum eine Niederlage zuzufügen. Sie gibt jemandem, der für nicht lebenswert gehalten wird (schräg: ein menschliches Baby, das von einem Delfin ausgetragen wird), eine Chance und wird dafür gewissermaßen belohnt: Die Geschichte erhält mit "The Roaring Ground" nämlich eine Fortsetzung, die Oonas Entscheidung nachträglich rechtfertigt. Doch die lingster-Tätigkeit verbraucht auf Dauer auch viel Substanz; nicht wenige bleiben ausgebrannt zurück.
... wie der verbitterte und alkoholsüchtige Ries in "Reading the Bones", dem die Gilde als letzte Chance einen unwichtigen Posten auf einem Kolonialplaneten zugewiesen hat. Als die Urbevölkerung des Planeten aus unbekannten Gründen Amok läuft, findet sich Ries unversehens auf einem Überlebenstrip wieder. Mit den beiden Töchtern des getöteten Botschafters - eine davon ein lästiger Teenager - im Schlepptau. Ries' traurige Vorgeschichte, die Dynamik zwischen den Hauptfiguren und natürlich das Geheimnis der planetaren UreinwohnerInnen: In dieser Novelle, 1998 mit dem "Nebula" ausgezeichnet, kommt einiges zusammen. Finch hat sie später unter gleichem Titel zu einem Roman ausgebaut. Keines ihrer Werke ist bislang übrigens auf Deutsch erschienen.
Bleiben noch zwei Geschichten, die zeigen, wie innovativ Finch mit altbekanntem Genre-Inventar umgeht. "Stranger Than Imagination Can" ist die Übertragung einer Feen-Geschichte ins Weltall. Darin bleibt der lingster ausnahmsweise eine Nebenfigur, zudem eine unsympathische - im Vordergrund steht ein geistig schlichter Gehilfe, der Wesen wahrnimmt, die andere nicht sehen können. "Communion of Minds" schließlich greift auf einen mindestens ebenso klassischen Plot zurück: Ein Rettungsteam landet auf einem unbesiedelten Planeten, nachdem es den Notruf eines Expeditionskorps empfangen hat. Nur einer der Pioniere ist noch am Leben, und während sich noch alle über dessen seltsames Verhalten wundern, kommt es schon zu den ersten Todesfällen unter den Rettern. Parasiten & Paranoia? Pöh, alter Hut. Allerdings versieht Finch das Ganze mit einem Twist und findet ein Ende, wie es Geschichten dieser Art in der Regel nicht haben. - Insgesamt ist "The Guild of Xenolinguists" eine gute Mischung aus "harten" und "weichen" Elementen. Ein Tipp insbesondere für diejenigen, die fundierte SF lesen wollen, ohne sich mit allzuviel Technologie abstrudeln zu müssen.
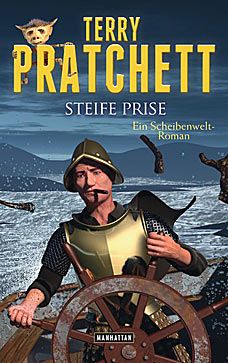
Terry Pratchett: "Steife Prise"
Kartoniert, 445 Seiten, € 18,50, Manhattan 2012 (Original: "Snuff", 2011)
Bis zu einem gewissen Grad trägt man natürlich Eulen nach Athen, wenn man verkündet, dass ein neuer Terry Pratchett auf dem Markt ist. Eingefleischte Scheibenwelt-Fans haben ihn sicher längst vorbestellt und auf jeden Fall durchgeschmökert, ehe man eine Rezension online stellen kann. Aber es gibt ja noch die GelegenheitsleserInnen. Für die also sei gesagt: Der neue Roman ist da ... inklusive eines Titelbilds, das mir einen mittelschweren Uncanny-Valley-Effekt beschert. Dafür aber ganz ohne Cameo-Auftritt von Tod, na sowas.
Alleine schon die Prämisse des Romans wird Pratchett-KennerInnen vorausahnend grinsen lassen: Samuel Mumm, pflichtbewusster Kommandeur der Stadtwache von Ankh-Morpork, wird von seiner adeligen Gattin Lady Sybil zu einem Urlaub verdonnert. Auf dem Land. Dass sich eine Stadtpflanze wie Mumm, der Bäume als "steifes Unkraut" wahrnimmt, dort nicht gerade heimisch fühlt, liegt auf der Hand. Die verheißene ländliche Stille präsentiert sich ihm so: Und dann, um fünf Uhr in der Frühe, drückte Mutter Natur auf einen Knopf, und die Welt drehte schier durch: Jeder vermaledeite Vogel und jedes vermaledeite Säugetier und, nach den Geräuschen zu schließen, auch jeder vermaledeite Alligator versuchte aus Leibeskräften, alle anderen zu übertönen.
Aber natürlich tummelt sich rings um Gut Käsedick noch mehr als die erbauliche Fauna: Nämlich vor allem Goblins, kleine Geschöpfe von bescheidener Schönheit, aber imposantem Gestank, die von den übrigen Scheibenwelt-Intelligenzwesen seit jeher geschnitten und - trotz unverkennbarer (wenn auch seltsamer) Kultur - wie Tiere behandelt werden. Für Mumm ist der Tod eines Goblin-Mädchens jedoch eindeutig als Mord zu werten. Ohnehin hatte er von Anfang an geargwöhnt, dass irgendetwas im Landidyll mächtig stinkt ... und zwar nicht die Goblins. Fast erleichtert, dass sich sein Verdacht bestätigt hat, nimmt Mumm Ermittlungen auf, die ihn in erlauchte Kreise ebenso wie auf eine rasante Verfolgungsjagd mit Flussschiffen führen werden. Und die bis nach Ankh-Morpork zurückreichen, wo gerade ein neues Produkt auf den Markt kommt - siehe die Doppelbedeutung des Originaltitels "Snuff". Für den Leser gibt es kein großes Rätselraten, wie die verschiedenen Plot-Elemente zusammengeführt werden, aber bei Pratchett ist ohnehin der Weg das Ziel. Und den geht man hier genauso gerne wie eh und je.
... ich zumindest. Seit einigen Jahren laufen in den diversen Online-Foren ja die Diskussionen heiß, dass Terry Pratchett nicht mehr so gut sei wie früher. Mal abgesehen von unzulässigen Ferndiagnosen, wie sich seine Alzheimer-Erkrankung auf die neueren Romane ausgewirkt haben könnte, liest sich das ein bisschen wie der Björk-Effekt: "Also das letzte Album ging ja noch, aber jetzt ist sie endgültig unhörbar geworden" (und das gleichlautend seit mindestens fünf CDs geäußert). Kann ich ehrlich nicht bestätigen: "Steife Prise" liegt weit innerhalb der Scheibenwelt-Bandbreite, zwischen früheren Ruhmestaten - mein persönlicher Liebling "Einfach göttlich" ("Small Gods") ist übrigens gerade in deutschsprachiger Neuausgabe wiederveröffentlicht worden - und schwächeren Werken wie "Unseen Academicals". Und die immer wieder mal auftauchende Minderheitsmeinung, dass die neueren Scheibenwelt-Romane gar nicht mehr von Pratchett geschrieben seien, ist einfach lächerlich.
Wie gewohnt strotzt der Roman vor ironischen Betrachtungen einer Fantasy-Welt, die in Wirklichkeit natürlich die unsere meint. Die Umtriebe des müßiggehenden Adels bilden dabei eines der zentralen Motive. Mumm, der im Lauf der Jahre ohnehin immer mehr zu Pratchetts Sprachrohr geworden ist, lässt es sich nicht nehmen, die gar nicht so feine Gesellschaft vor den Kopf zu stoßen, wenn's gerade mal nötig ist - mit vergnüglichem Ergebnis. Noch wichtiger aber ist das Motiv der Integration, das sich wie ein roter Faden durch drei Jahrzehnte Scheibenwelt zieht. Das gilt für die individuelle Ebene, wenn Mumm anfängliche Feinde zu Verbündeten macht, mehr noch aber fürs Gesamtgesellschaftliche - einmal mehr wird ein diskriminiertes Volk zur allgemeinen Anerkennung finden. Interessanterweise klingt in "Steife Prise" aber auch zum ersten Mal so etwas wie die Schattenseite der von Mumm und Lord Vetinari forcierten Integrationspolitik an: Auf einem Nebenschauplatz unterhalten sich Mitglieder der multikulturellen Stadtwache darüber, dass die nicht-menschlichen Völker der Scheibenwelt durch ihre Einbindung allmählich zu "Menschen" gemacht würden. Im ganz Kleinen hinterfragt Pratchett hier sein System ... sollte er sich entschließen, dies noch auszubauen, könnten sich spannende Dinge tun, falls der gesamte Scheibenwelt-Komplex tatsächlich noch einmal zu einem inhaltlichen Abschluss gebracht wird. Und nicht einfach aufgrund von Pratchetts Lebensumständen - leider, leider - auslaufen muss.
War "Unseen Academicals" ein wenig zerspragelt, so fokussiert Pratchett hier wieder aufs Wesentliche, soll heißen: auf Mumm. Neben ihm geben sich die Nebenfiguren die Klinke in die Hand, von Sybil über Klein-Sam und den mörderisch begabten Butler Willikins bis zum hoffnungsvollen Dorfpolizisten Volker Aufstrich und einer aufklärerisch veranlagten Kinderbuch-Autorin - Mumm aber überstrahlt sie alle. Dass er nicht mehr ganz derselbe ist wie früher, sollte nicht verwundern, immerhin ist er mittlerweile verheiratet, adelig und Vater. Und trägt zudem seit einiger Zeit den Rest eines dunklen übernatürlichen Wesens in sich (das er natürlich mit dem üblichen Pflichtbewusstsein im Zaum hält). Alle Wandlungen seit den ersten Wache-Romanen sind also wohlbegründet, Mumms Grundcharakter ist aber derselbe geblieben. Überhaupt gehören die Personenschilderungen zu Pratchetts Stärken. Ein kleines, aber nicht zu vernachlässigendes Detail zeigt, wie der Autor in dankenswerter Weise seinen Figuren ihre Würde lässt: Wie leicht gäbe die Konstellation adelige Frau und Mann, der sich bewusst danebenbenimmt, Stoff für reihenweise Gags ab. Doch degradiert Pratchett Lady Sybil eben nicht zum dauerindignierten Requisit - im Gegenteil, sie unterstützt ihren Mann nach Leibeskräften. Gelegentliche Standpauken muss er eben abkönnen.
Zugegeben, man - oder besser gesagt: frau - möchte vielleicht nicht unbedingt Butch sein und sich von Pratchett attestieren lassen, ein Gesicht wie eine Bulldogge, die gerade Essig von einer Distel leckt, zu haben. Derlei Untiefen halten sich aber in Grenzen, und die von manchen LeserInnen beklagten "skatologischen" Elemente des Romans wirken auch nicht so aufgesetzt ... Mumms Sohnemann interessiert sich eben brennend für Kaka; die Erfahrung haben andere Eltern mit ihren Sprösslingen auch schon gemacht. Alles in allem ist der Humor wohldosiert und intelligent - nehmen wir als Beispiel nur einen kleinen, feinen Satz, wie er Pratchett-typischer gar nicht sein könnte: Mumm tat das, was jeder besonnene Ehemann getan hätte, nämlich auf dynamische Weise überhaupt nichts. Alles also wie immer. Gut so.

Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction Jahr 2012"
Broschiert, 989 Seiten, € 34,00, Heyne 2012
Ich liebe die Bildunterschriften im Filmrezensionsteil! Das Foto zu "Game of Thrones" zeigt Daenerys Targaryen, wie sie auf dem Thron von Westeros sitzt und einen vieldeutigen Blick auf das schuppige Drachenei in ihrer Hand wirft. Darunter steht: Sobald alle wegschauen, ess ich die Ananas auf! So wie die meisten "Spiegel"-LeserInnen das Magazin vermutlich zuerst auf der letzten Seite aufschlagen, um sich die Stilblüten im "Hohlspiegel" reinzuziehen, blättere ich im traditionellen "Science Fiction Jahr" des Heyne-Verlags erst mal durch die Filmrubrik und genieße die ironisch quergedachten Bildlegenden.
... es gibt sie also noch, die seit langem liebgewonnenen Teile in der jährlich umfangreichsten Betrachtung des Phantastik-Genres auf dem deutschsprachigen Markt. Auch wenn sie seit vergangenem Jahr deutlich abgeschlankt ist und ein Nebensatz im Vorwort der heurigen Ausgabe sorgenvoll aufhorchen lässt: Dass das Heyne Science Fiction Jahr auch künftig ein (bis auf weiteres noch in Form eines gedruckten Buches präsentiertes) Paket voller überraschender, interessanter und - im besten, im Bradbury'schen Sinne - wundervoller Dinge ist. BIS AUF WEITERES. Oje.
Hauptgrund für die Abschlankung ist, dass es keinen Schwerpunkt gibt, in dem verschiedenste AutorInnen ihre Betrachtungen zu einem Generalthema beisteuern. Stattdessen gestaltet sich der "Feature"-Teil heuer als bunte Mischung, wobei die Reihenfolge der Aufsätze jedoch beinahe so etwas wie einen roten Faden ergibt. In unterschiedlicher Weise geht es an die Wurzeln des Genres, etwa wenn Grande Dame Margaret Atwood erzählt, wie ihre Liebe zur Science Fiction schon früh begann: "Malt eine Blume", hieß es in der Schule, und gemeint war damit eine Tulpe oder eine Narzisse. Aber die Blumen, die wir eigentlich malen wollten, hatten mehr mit Venusfliegenfallen gemeinsam, nur dass sie viel größer waren und halb verdaute Arme und Beine aus den Fangblättern ragten. Das wird später nur mehr von Cory Doctorows Kindheitsschilderung überboten, wie ihm sein Vater "Conan"-Geschichten vorlas und sie mit einem trotzkistischen Einschlag versah. Die Saat zu revolutionärem Gedankengut wird eben früh gelegt!
Und noch mehr zum Thema Ursprünge: SF-Kritiker Gary K. Wolfe widmet sich dem Motiv des Frontier von Wildwest-Abenteuergeschichten des 19. Jahrhunderts bis zu Kim Stanley Robinsons Mars-Trilogie. Das wiederum korrespondiert sowohl mit Rainer Eisfelds Nachruf auf den heuer verstorbenen Ray Bradbury als auch mit David Hughes' Betrachtung zu "John Carter", das auf eine satte 80 Jahre zurückreichende Verfilmungsgeschichte zurückblickt und dann leider doch zum (unverdienten) Flop geriet. Comic-Genie Mœbius, ebenfalls heuer von uns gegangen, wird vom FAZ-Feuilletonisten Andreas Platthaus in sehr schönen Worten gewürdigt, Klaus N. Frick komplettiert die Nachrufe mit "Ein Münchner in Atlan Village" über "Perry Rhodan"-Autor H. G. Francis, und Filmexperte Peter M. Gaschler schreibt über Rainer Werner Fassbinders ein Vierteljahrhundert vor "Matrix" entstandenes Monumentalwerk "Welt am Draht". "Verrückte Vernunft" schließlich liest sich genauso, wie man es sich vorab vorstellen würde, wenn Dietmar Dath unter Bezugnahme auf Niklas Luhmann über den großen Irren Philip K. Dick philosophiert.
Nach soviel Genre-Historie wird's aber auch höchste Zeit für die Gegenwart - und wer könnte die besser verkörpern als Tausendsassa Cory Doctorow ("Little Brother", "For the Win"). Im Interview erklärt der unermüdliche IT-Aktivist, warum er Revolutionen für notwendig hält und zugleich immer Optimist bleiben wird. Ganz anders in der elektronischen Sphäre verankert ist Computerspielentwickler und "Doom"-Schöpfer John Carmack, der eher in die kommerzielle Praxis blicken lässt ("Storys in PC-Spielen sind wie Storys in Pornos. Man braucht sie, aber sie sollen auch nicht vom Wesentlichen ablenken."); zusätzlich gibt es einen 70-seitigen Block mit Rezensionen von Computerspielen. Und dann wäre da noch Christian Endres' Beitrag "Your Movie Wants You!" über die vielleicht erstaunlichste filmische Erfolgsgeschichte des Jahres: Timo Vuorensolas knallige Nazis-auf-dem-Mond-und-im-Weißen-Haus-Satire "Iron Sky", die ohne Crowdfunding vielleicht nie zustande gekommen wäre.
Knapp die Hälfte des Gesamtumfangs macht der Rezensionsteil aus, davon 150 Seiten Film, 50 Seiten Comics und 100 Seiten Bücher - letzteres hätte für meinen Geschmack ruhig länger sein können; vor allem in Anbetracht des Umstands, dass das Straßenfeger-Format Hörspiele mit 90 Seiten fast ebensoviel Raum erhält. Ca. 220 Seiten umfassen dann die traditionellen Marktberichte, kurz: Die Genre-Welt in Zahlen, von Titel- und Preislisten bis zu den wichtigsten Trends auf den großen Absatzmärkten. Vom einstmals mächtigen Wissenschaftsteil des "Science Fiction Jahres" ist hingegen wenig geblieben - nur zwei Beiträge sind es: In "Bestehen Delfine den Turing-Test?" stellt sich Wissenschaftstheoretiker Klaus Mainzer den Fragen Uwe Neuholds (und bekennt sich dabei ebenfalls zum Optimismus), und auch Peter Kempin & Wolfgang Neuhaus widmen sich in "Testament für die Technoevolution" dem Wesen der Intelligenz. In diesem Fall vergnüglich gekleidet in das Gewand eines fiktiven zukünftigen Inter-Intelligenz-Symposiums über Stanislaw Lem ... in dessen Verlauf sich sogar der Meister selbst donnernd zu Wort melden wird.
Kurz zusammengefasst und mit Rückblick auf frühere Ausgaben: Ist einen Tick disparater oder auch anonymer geworden, das Ganze. Aber in Sachen umfassender Genre-Betrachtung auf dem deutschsprachigen Markt immer noch konkurrenzlos. Und damit unverzichtbar.
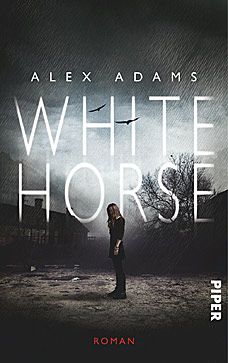
Alex Adams: "White Horse"
Broschiert, 448 Seiten, € 17,50, Piper 2012 (Original: "White Horse", 2012)
"Alex Adams' furchteinflößendes Debüt spielt in einer Liga mit Justin Cronin und Stephen King!" prangt klotzig auf der Buchrückseite. Na, das wollen wir doch erst mal sehen, hab ich mir gedacht. Ist ja selten eine gute Idee, für ein Erstlingswerk gleich so schwerkalibrige Vorschusslorbeeren-Kanonen Salut böllern zu lassen; ein Werk übrigens, das im englischsprachigen Original erst diesen Frühling auf den Markt gekommen ist. Nach der Lektüre kann ich aber zumindest sagen, dass mich das Buch auf seine durchaus eigenwillige Art gepackt haben muss: Die Lektüre ging nämlich eine Nacht lang durch ... weshalb ich mich am nächsten Morgen auch so in die Arbeit geschleppt habe, wie einst das erste Tier an Land kroch.
Mit ein Grund, warum man den Roman nicht so leicht wieder aus der Hand legen kann, ist sein ungewöhnlicher Aufbau. Zwar folgt er beim parallelen Voranschreiten auf einer "Damals"- und einer "Jetzt"-Ebene ganz dem klassischen Reißverschlusssystem, doch läuft der Wechsel zwischen den beiden Zeitebenen im Schnelltakt ab, oft schon nach ein bis zwei Seiten. Gemeinsam mit einer durchgehenden Erzählung im Präsens fesselt das; so einfach kann's gehen. Ich-Erzählerin ist in beiden Fällen Zoe Marshall, eine junge Witwe, die im "Damals" den Beginn des Weltuntergangs in den USA miterlebt und sich im "Jetzt" schwanger auf einer Odyssee durch Südeuropa befindet. Zoes Lebensweg wird von zwei Männern geprägt: Zum einen Nick Rose, Zoes ehemaliger Psychotherapeut, mit dem sie nach und nach in eine verhatschte Liebesgeschichte gedriftet ist, und zum anderen der Schweizer, ein frauenfeindlicher Psychopath, der alles auf seinem Weg massakriert. Nur an Zoe, die er auf dem Marsch durch Italien aufgabelt, hegt er ein eigentümliches - und am Ende mit Knalleffekt aufgeklärtes - Interesse.
Stichwort Weltuntergang: Alex Adams erweckt den Eindruck, als hätte sie ein Destillat aus allen möglichen Apokalypse-Szenarien erstellen wollen. Die Hauptrolle darin spielt eine "White Horse" genannte Seuche, die 90 Prozent der Menschheit getötet, fünf Prozent verschont und weitere fünf ... verändert hat (lässt ein wenig an Michael McBrides "God's End"-Trilogie denken). Dazu kommen dann noch ein durch Wettermanipulationen außer Kontrolle geratenes Klima und ein Krieg, der in der Cybersphäre begann und schließlich zum konventionell ausgetragenen Konflikt wurde. - Aber damit nicht genug: Die Autorin spielt auch solange, wie es sich machen lässt, mit der Ungewissheit, ob der Untergang der Zivilisation auf eine natürliche oder übernatürliche Weise herbeigeführt wurde. So findet Zoe eines Tages mitten in ihrer bestens abgesicherten Wohnung ein verschlossenes Gefäß vor, das der Darstellung der Büchse der Pandora auf alten Gemälden verblüffend ähnlich sieht. Zugleich wissen wir aber, dass Zoe in einem Institut arbeitet, das auf pharmazeutische Forschung spezialisiert ist. Andere mehrdeutige Faktoren sind Seuchenopfer, die eine nicht-menschliche Gestalt angenommen haben, oder diverse mythologische Anspielungen. Insbesondere ihre Erinnerungen an Griechenland scheinen die Autorin, die aus Neuseeland stammt und nach diversem Kontinentalhopping schließlich in Oregon aufgeschlagen ist, stark beeinflusst zu haben. Und natürlich auch die Bibel der Christen, siehe "Weißes Pferd".
Klar, dass sich die Handlung damit in eine etwas allegorische Richtung dreht. Die Wetterkiste beispielsweise ist völlig unnötig - außer dass der Dauerregen die deprimierende Grundstimmung noch einmal unterstreicht. Und auch das Weltkriegsszenario ist in der Schnelligkeit seines Ablaufs schwer wörtlich zu nehmen. Im Prinzip bleibt der Krieg abstrakt und fern, doch bietet er die Möglichkeit, einige archetypische Bilder in den Roman einzubauen: Etwa der Abschied vom Mann, der ins Gefecht gerufen wird, oder der rituelle Gang zum Aushang mit den Listen der Gefallenen. Autoren wie Michael McBride oder Brian Keene mögen auf der einen Seite Pate für "White Horse" gestanden haben (und ja: der Stephen-King-Verweis am Buch ist gar nicht mal so schlecht). Genauso nahe stehen ihm auf der anderen Seite aber Bücher, mit denen sich Mainstream-AutorInnen einer Genre-Handlung bedient haben, um eigentlich einen anderen Inhalt zu transportieren. Mögen die nun Juli Zeh mit "Corpus Delicti" oder - inhaltlich natürlich näher stehend - Cormac McCarthy mit "Die Straße" heißen.
Wie einige haarsträubende Zufälle im Verlauf der Handlung illustrieren, ist Adams' Hauptanliegen weniger die Plausibilität des Szenarios (eine typische Forderung von Genre-LeserInnen) als die Frage, was die Umstände mit der Hauptperson machen. Zoes Innenleben steht im Zentrum und prägt den Stil. Hier ein typisches Beispiel, ein innerer Monolog, während Zoe sich über ihre Schweizer Nemesis beugt und mit sich ringt: Das Kissen ist in meinen Händen, dann nicht, dann doch wieder. Meine Hände verändern unentwegt den Ablauf des Stücks. Es wäre so leicht, ihn auszulöschen. Einmal lang und kräftig nach unten pressen, und es gäbe eine Sorge weniger auf der Welt. Erlösung. Ich muss nur handeln. Aber ... aber ...
... was zugleich Zoes Charakter auf den Punkt bringt: Zum einen beharrt sie mit allem verbliebenen Idealismus darauf, ihre Menschlichkeit auch in der rauen neuen Welt zu bewahren. Zum anderen ist sie ganz die nüchterne Pragmatikerin, die sich beispielsweise ihr spätes Studium als Putzfrau verdiente. Weil sie so Zeit genug hatte, um den Kopf freizubekommen. Und anscheinend auch Zeit genug, um sich jede Menge geistreiche Bemerkungen auszudenken, die Adams in den Roman eingebaut hat. Aber wenn überhaupt, dann ist der Hang zum Aphorismus höchstens ein kleines Manko an einem packenden Roman, der sich um die Schuldgefühle der Überlebenden und das Bewahren von Menschlichkeit und Hoffnung unter den schlimmstmöglichen Umständen dreht.
P. S.: "White Horse" ist als erster Teil einer Trilogie deklariert - ich bin mir nicht sicher, ob ich auch die beiden Folgebände lesen werde. Nicht etwa, weil "White Horse" schlecht gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Doch findet der Roman zu einem so runden Ende (sogar inklusive eines kleinen Schlussgags), dass ich eigentlich keinen inhaltlichen Grund für eine Fortsetzung sehe. Denken wir bloß an "Matrix" ...

David Halperin: "Der Tag, an dem das UFO vom Himmel fiel"
Gebundene Ausgabe, 379 Seiten, € 20,60, Goldmann 2012 (Original: "Journal of a UFO Investigator", 2011)
"Im dichten Gewebe der Realität gibt es immer einen Schlitz. Den muss man finden. Dann Kraft sammeln, um sich einen Weg dorthin zu bahnen und durch diesen Schlitz zu schießen, wie mit einem Katapult. Auf der anderen Seite steht man dann wieder im Sonnenschein. Wo man hingehört." So sagt es sich der 16-jährige Danny Shapiro, der in diesem Roman, geschrieben als Dannys Tagebuch, auf seine Karriere als UFO-Forscher (mit Ausweis und selbstgebasteltem "Delta-Sender") zurückblickt. Eine Geschichte aus den frühen 60er Jahren, die sich um Selbstfindung, spirituelles wie sexuelles Erwachen dreht, eine Reise mit einer fliegenden Untertasse beinhaltet und doch stets nur einen Weckruf von der grauen Realität entfernt bleibt.
Danny wächst in einem Vorort von Philadelphia in einem jüdischen Elternhaus auf. Die Mutter ist schwerkrank, der Vater erweckt den Eindruck, als wäre seine Familie eine Peinlichkeit, die er am liebsten loswürde - die Stimmung zuhause ist dementsprechend gedrückt. Trost fand Danny früher bei seinen Freunden Jeff und Rosa, beide ebenso UFO-begeistert wie er; zunächst jedenfalls. Doch mit der einsetzenden Pubertät ändert sich alles: Sein "bester Freund", der Baptist Jeff, der Danny ohnehin immer mit latenter Aggression behandelte, wendet sich von ihm ab, der Umgang mit der nicht-jüdischen "Schickse" Rosa wird ihm verboten. Just da lernt Danny zum Glück drei Teenager kennen, die seinen bisherigen Freundeskreis nicht von ungefähr widerspiegeln - nur in verbesserter Form. Julian ist als UFO-Experte schon deutlich versierter als Danny. Rochelle, mit der Danny seinen ersten Sex haben wird, und Tom verfügen ebenfalls über erstaunliches Wissen. Unter dem Namen Super Science Society agieren die drei weitgehend losgelöst von der Welt der Erwachsenen, jedenfalls soweit es elterliche Einmischung anbelangt. Dafür verfügen sie über Kontakte zu diversen Geheimnisträgern. Danny ist in seinem Element.
Staatsgeheimnisse, Agentenumtriebe, Mordanschläge, der Kontakt zu Außerirdischen und eine spirituelle Reise: Die weiteren Geschehnisse des Romans spalten sich in eine reale und eine imaginierte Ebene auf, wobei der Autor geschickt mit deren Wechselspiel jongliert. Figuren der einen Ebene tauchen in veränderter Form - eigentlich ganz so wie Traumsymbole - auf der anderen auf. Auf dem Höhepunkt wird sich Danny schließlich gar auf beiden Seiten der israelisch-jordanischen Grenze wiederfinden und so beinahe sich selbst begegnen. Auch wenn die Realität wortwörtlich nur einen Schrei von den fiktiven Ereignissen in Dannys Tagebuch entfernt sein kann, lässt Halperin die Grenzen hier ähnlich geschickt verschwimmen, wie es ein Adam Roberts tut. Auch Vergleiche mit Kurt Vonneguts "Slaughterhouse-Five" - im Kontext eines Jugendromans - waren schon zu lesen. Und erst nach und nach schält sich heraus, wann genau Dannys fiktives UFO-Tagebuch wirklich aus der Realität abgebogen ist.
Der Autor heißt korrekterweise übrigens David J. Halperin - nicht dass man sich beim routinemäßigen Hinterhergoogeln über eine vermeintlich bunte Bibliografie wundert, die neben Werken mit Religionsbezug auch Bücher zu Queer Studies sowie psychologische Fachliteratur zu umfassen scheint. Es gibt nämlich auch noch David M. bzw. David A. Halperin. J. ist der einzige der drei US-Namensvettern, der es bislang zu einer deutschen Übersetzung gebracht hat: Ein Theologieprofessor, der im Ruhestand zum Schriftsteller geworden ist und in seinem späten Romandebüt auch seine eigene Biografie verarbeitet. Von der Religion zu fliegenden Untertassen ist der Sprung dann gar nicht so weit, wie man glauben sollte. Der Romanheld wächst in einer Familie auf, die zwar traditionell denkt, ihren Glauben aber nicht praktiziert. Danny verspürt eine Lücke und stopft sie auf seine Weise: "Ich erforsche UFOs, weil sie - im Gegensatz zu Gott - real sind und man sie sehen kann."
"Das letzte Einhorn"-Autor Peter S. Beagle hat sich in den vergangenen Jahren viel mit jüdischen Lebenswelten in den USA beschäftigt. Das hallt hier ebenso wider wie Michael Chabons "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay". Wo Chabon das Goldene Zeitalter der Superhelden-Comics als Hintergrund für eine Geschichte des Erwachsenwerdens verwendete, ist es bei Halperin das Goldene Zeitalter der UFOlogie. Halperin gräbt heute weitgehend vergessene Stars der Szene wie Albert K. Bender, Morris K. Jessup oder Richard Sharpe Shaver wieder aus, die als Autoren und Verschwörungstheoretiker einst auf der Welle der UFO-Hysterie surften. Roswell, das Philadelphia-Experiment und die "wahren" Men in Black (prä-Will Smith) - alles da und, versehen mit religiösen Elementen, in den Kontext eines sehr persönlichen Reifungsprozesses gestellt. Kein eigentlicher Genre-Roman, aber ein schöner.
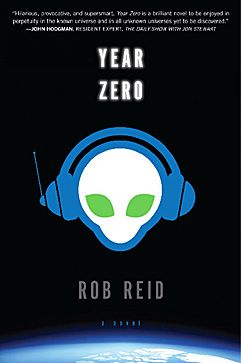
Rob Reid: "Year Zero"
Gebundene Ausgabe, 357 Seiten, Ballantine Books/Del Rey 2012
1977 war "Year Zero", das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen ... ohne es überhaupt zu bemerken. Und erst recht ohne zu wissen, dass wir damit draußen im Universum eine Kulturrevolution ausgelöst haben. Womit? Mit der Titelmelodie einer hierzulande unbekannten Sitcom - das war nämlich die erste Übertragung, die von der Erde in die aus unzähligen Völkern bestehende Refined League vorgedrungen ist. Und seitdem sind sämtliche Aliens der Galaxis und darüber hinaus süchtig nach irdischer Musik. Am meisten nach Classic Rock, aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Und mit Feinheiten braucht man ihnen in dem Bereich ohnehin nicht zu kommen: Zwar ist man in der league in wirklich jeder Beziehung maximal refined (die irdische Hauptfigur des Romans fällt beim Besuch einer Alien-Wohnung vor Wonne fast ins Koma, weil Teppich, Vorhänge und Nippes so unsagbar harmonisch aufeinander abgestimmt sind ...), nur in der Musik bringt man jenseits der Erde außer dissonantem Gekreische und Stampfen ohne Taktgefühl einfach nichts zustande. Also wird seit Jahrzehnten die gesamte Musikproduktion der Menschheit raubkopiert und ins All versandt.
... und das wird jetzt zum Problem, wie Nick Carter, Angestellter einer auf Copyrightfragen spezialisierten Anwaltskanzlei, bemerkt, als eines Tages zwei Aliens vor ihm stehen. Recht menschlich aussehend eigentlich, wenn auch exzentrisch gekleidet: Frampton in Imam-Kluft, aus der ein knallroter Haarschopf quillt (die Erklärung für dieses Outfit wird später zu einer besonders komischen Szene; Nick nennt Frampton jedenfalls provisorisch "O'Sama"). Und seine Schwester Carly, die Sexshop-Ausgabe einer Nonne. Die beiden haben Nick zwar ursprünglich ausgesucht, weil sie ihn für den gleichnamigen Backstreet Boy hielten, aber was sie ihm dann zu erzählen haben, zieht Nick die Schuhe aus: Die Liga hat festgestellt, dass sie der Menschheit Tantiemen schuldet (die nicht zuletzt dank Nicks Firma astronomisch sind) und lässt nun über ihre Abgesandten das Understatement des Jahrtausends ausrichten: "We need a licence to all of humanity's music. One that will allow ... a rather large number of beings to play it." Das Ausmaß wird Nick erst so nach und nach bewusst: "So, how much money does the Refined League owe our music industry at this point? - "All of it." - "All of it? As in ...?" - "As in, all of the wealth ever created throughout every cubic inch of the universe since the Big Bang." - "All that, huh?" - "As in, all of the wealth that could conceivably be created by every conscious being that will ever live between now and the heat death of the universe, trillions of years in the future." - "Damn that's a lot."
Dafür eine juristische Lösung zu finden, wäre schon schwierig genug. Doch leider drängt auch noch die Zeit: Aufgrund des bevorstehenden Universalruins denken einige Kräfte in der Liga nämlich an eine radikalere Lösung. Keine direkte Zerstörung der Erde - es würde schon reichen, bei der ohnehin sehr wahrscheinlichen Selbstauslöschung der Menschheit ein kleines bisschen nachzuhelfen. Agenten wurden bereits auf die Erde geschickt (ein Staubsauger-Lookalike mit wenig Grips und ein obszöner "Papagei"). Zum eigentlichen Schlag konnte aber wegen der Townshend Line noch nicht ausgeholt werden: Jener Barriere, die einst um unser Sonnensystem gelegt wurde, um Zillionen Fans von The Who vom Sturm auf die Erde abzuhalten. Dummerweise ist die aber eher ein Gerücht als wirklich wirksam, wie Carly & Frampton kleinlaut gestehen. Und schlimmer noch: In der galaxisweit übertragenen Musik-Soap, die ausgerechnet ihr Vater produziert, wird bald verkündet werden, dass es die Townshend Line gar nicht gibt: Der Countdown läuft. - So, damit hätten wir dann alle Hirnriss-Faktoren beisammen, die Nick und seine Wohnungsnachbarin Manda in einen Wettlauf gegen die Zeit treiben.
"Year Zero" ist das dritte Buch des US-Amerikaners Rob Reid, und es fallen einem auf Anhieb einige Titel ein, die es beeinflusst haben. Zwei davon, nämlich John Scalzis "Agent der Sterne" und natürlich Douglas Adams' "Per Anhalter durch die Galaxis", hat Reid auch explizit auf die Liste seiner zehn Lieblingsbücher gesetzt. Der Humor ist ganz der von Adams as opposed to Terry Pratchett. Soll heißen: Hier wird kein Wert darauf gelegt, einer humoristischen Welt auch nur den geringsten Hauch von Möglichkeit zu belassen; sie führt sich durch die von ihr produzierten Gags selbst ad absurdum. Nehmen wir nur die pluhhhs ... ups, das war schon falsch: Nehmen wir pluhhhs, ein Volk, das so uninteressant ist, dass es weder großen Anfangsbuchstaben noch bestimmten Artikel verdient, und das den Test der Evolution dadurch bestand, dass seine natürlichen Feinde vor Langeweile ausgestorben sind. Oder die Idee, dass Ruhm eine messbare physikalische Eigenschaft sei - solche Einfälle entsprechen der Adams-Schule ebenso wie die zahlreichen Fußnoten, Wortspiele und Außerirdische, die nichts anderes sind als menschliche Karikaturen vor Papp-Hintergrund. Und natürlich herrlich beschriebene Situationskomik - etwa wenn die menschenähnlichen Perfuffinites zu galaxienübergreifenden Superstars geworden sind, weil sie zu menschlicher Musik aus der Konserve die Lippen bewegen: an entire race of Milli Vanillis.
Das Lachen gefriert einem ein wenig - und das ist auch gut so -, wenn Reid sein satirisches Auge auf die Musikindustrie richtet. Die Idee, dem Kongress Filesharing als "Terrorismus" zu verkaufen, stößt in Nicks Kanzlei auf großes Wohlwollen. Und scheint fast der nächste logische Schritt nach dem Aufsehen erregenden Präzedenzfall Jammie Thomas-Rasset zu sein. Wir erinnern uns: Erst letzten Monat ist die US-Amerikanerin, auf die Reid in seinem Roman explizit eingeht, erneut zu einer Strafe von 222.000 Dollar verdonnert worden. Für die Verbreitung von ganzen 24 Songs! Da wirkt es nicht einmal mehr übertrieben, wenn Reid vom Hass der Labels auf alles, was mit Musik zu tun hat, schreibt: Von den KünstlerInnen über die Radiostationen bis zu den KonsumentInnen ("they're all a bunch of downloading geek bastard thieving-ass thieves!"). Paradoxer, bizarrer und gruseliger als die Realität kann eben nicht einmal Reids fiktives Universum sein. Hier sind so einige Erfahrungen eines Mannes eingeflossen, der ursprünglich aus der IT-Branche kommt und das Geschäft von verschiedenen Seiten kennengelernt hat. Siehe dazu auch sein vorangegangenes Buch "Architects of the Web", eine Geschichte des Internets.
Diese Verankerung in der Realität tut dem Roman gut und hebt ihn über den Status einer schnell wieder vergessenen Gag-Parade hinaus. Auch wenn die Gags oft wirklich klasse sind. Etwa wenn sich ein außerirdisches Kommunikationsgerät erst als Feuerring mit donnernder Stimme präsentiert und dann nach einem für Menschen geeigneteren Interface sucht - zum Entsetzen aller Anwesenden verfällt es dabei auf ... "Clippy", den einstigen Office Assistant von Microsoft. Der Auftritt eines versteckt auf der Erde lebenden Außerirdischen mit sehr prominentem Namen am Ende des Romans hat's auch in sich ... und liefert nebenbei eine äußerst plausibel wirkende Erklärung dafür, warum die Menschheit in ihrer Entwicklung stagniert. - So schlägt man "Year Zero" schließlich nach jeder Menge Lacher zu und verspürt leises Bedauern darüber, vermutlich nie wieder eine ernsthafte Ermahnung wie diese lesen zu können: "Oh, don't pretend your're some naive, uneducated nitwit - it's beneath the dignity of a Backstreet Boy."
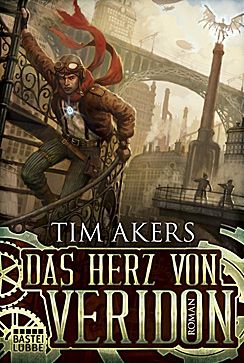
Tim Akers: "Das Herz von Veridon"
Broschiert, 350 Seiten, € 13,40, Bastei Lübbe 2012 (Original: "The Heart of Veridon", 2009)
Steampunk kann bedeuten: Rüschen, Rauch und Dampfmaschinen, die ein bisschen mehr leisten, als Dampfmaschinen eigentlich können. Man dreht einfach ein wenig an der Technologiegeschichte und sieht, was dabei herauskommt. Es gibt aber auch die Variante, in der so gut wie alles möglich scheint und die Grenzen zu wahlweise Fantasy, Science Fiction oder Horror (wenn nicht überhaupt gleich zu allen dreien) überschritten werden - siehe etwa Stephen Hunt oder China Miéville. "Das Herz von Veridon", der Debütroman des US-Amerikaners Tim Akers, fällt eindeutig in die zweite Kategorie. Das wird einem spätestens klar, wenn man diese Beschreibung eines Luftschiff-Kapitäns liest: Er war noch an das Luftschiff angeschlossen. Kabel steckten in den Zinnaugen, der Herzmechanismus ragte aus der origamiartigen Brust, Zahnräder griffen in die Schnittstelle der Kammer ein, Rohre und Schläuche verliefen unter seiner Haut und mündeten in die Leitungen seiner Knochen. Für ein ungeschultes Auge sah es grauenhaft aus, wie eine halb vollendete Sektion.
Willkommen im Stadtstaat Veridon, der jüngsten Schwester von Miévilles New Crobuzon und Hunts Jackals. Erbaut über einem Fluss, drängeln sich zwischen und über ihren zahllosen Kanälen die Gebäude, und aus den meisten davon steigt öliger Rauch empor. Selbst die Kirche präsentiert sich als qualmender Industriekomplex, aber sie heißt ja auch Kirche des Algorithmus und ist die Kirche der Kolben und Getriebe, der verwinkelten Antriebsscheiben, der klickenden Anker, der in heiligem Takt rotierenden Räderwerke - ein Tempel aus Mechanik und Öl. Gott ist eine Gleichung und Religion die Suche nach Mustern. Die neue zumindest, denn die Götter der alten Religion sind immer noch da und schweben in körperlicher Gestalt über dem Boden; bloß hat man inzwischen Gebäude um sie herum errichtet, um sie den Blicken der neuen Kirche zu entziehen. Überhaupt ist Veridon eine Stadt im Wandel: Die einstigen Gründerfamilien verlieren ihre Macht allmählich an die Neureichen und an den Rändern leben immer noch die, die schon vor den Menschen da waren. Wie die Anansi - halb Mensch, halb Spinne - oder unten im Fluss die Fehn: symbiotische Wesenheiten aus Würmern und den Körpern toter Menschen.
Angetrieben - im doppelten Sinne - wird die industrielle Revolution Veridons von den Mechagenen, avancierten Maschinenteilen, die in der Stadt niemand nachbauen kann. Sie kommen in unregelmäßigen Abständen auf Schiffen den Fluss heruntergetrieben, Herkunft unbekannt. Ein solches Mechagen wird dem Ex-Piloten Jacob Burns eines Tages in die Hand gedrückt, kurz bevor das Luftschiff, auf dem er sich gerade als Passagier aufhält, abstürzt. Jacob überlebt den Absturz als einziger, und es war nicht sein erster: Ein Unfall erstickte einst seine Pilotenkarriere im Keim, und seitdem wird der Spross aus gutem Hause gemieden. Mit Auftragsarbeiten für ein Verbrechersyndikat hält Jacob sich über Wasser - ein typischer Anti-Held in räudigem Umfeld also: Steampunk mit Betonung auf -punk.
Da Jacobs Mechagen allseits Begehrlichkeiten weckt, setzt sich bald ein Plot bekannter Machart - aber rasant erzählt - in Gang: Ein Ding wird gesucht, alle jagen hinterher. Jacob und seine Bekannte, die mögliche Doppelagentin Emily, sowie der Anansi Wilson stehen dabei auf der einen Seite, die Redshirts diverser Interessengruppen - vom Adel bis zum organisierten Verbrechen - auf der anderen. Als Wild Card ist noch ein marodierendes mechanisches Wesen im Spiel - in etwa die Terminator-Version eines Engels. Die Jagd führt von den versifftesten zu den glamourösesten Orten Veridons - ganz wie in einem Noir-Krimi ist die Stadt dabei nicht nur Schauplatz, sondern selbst schon Protagonist. Und während die nominellen Hauptfiguren ihren gehetzten Trip absolvieren, lüftet sie nach und nach auch ihre Geheimnisse. Zum Teil jedenfalls, denn "Das Herz von Veridon" ist erst der Anfang einer Trilogie.
Dark Fantasy, Krimi, New Weird, möglicherweise SF (wer ist es, der da irgendwo flussaufwärts solche Wunder der Technik herstellt?) ... viele Genres haben in Akers' Roman Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt auch der Body Horror: Wenn Menschen mechanische Engramm-Käfer in den Mund gelegt werden, um sie für eine neue Funktion buchstäblich von innen her umzukrempeln, ist dies eines der krasseren Beispiele für die invasiven Technologien, die in Veridon gang und gäbe sind und weite Teile der Stadtbevölkerung zu Cyborgs machen. Aber eben nur eines davon. Sekundärblut und Fötalmetall ... Akers' Steampunk-Konzept hat einen Grad von Körperlichkeit, der in einem visuellen Medium - sei es Film oder Comic - besonders gut rüberkommen müsste. Sollte sich jemals ein Studio die Filmrechte an "Veridon" sichern, kann H. R. Giger jetzt schon die Stifte anspitzen. So weit sind wir zwar noch nicht - aber immerhin folgt schon Anfang Dezember mit "Die Untoten von Veridon" (im Original "Dead of Veridon") Teil 2.
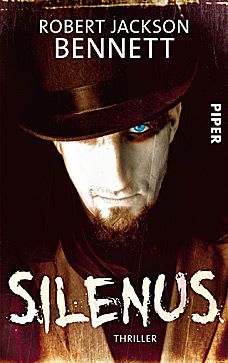
Robert Jackson Bennett: "Silenus"
Broschiert, 575 Seiten, € 13,40, Piper 2012 (Original: "The Troupe", 2012)
"Something Wicked This Way Comes" ... dem Titel von Ray Bradburys berühmtem Roman entsprechend scheint sich in der Phantastik zuletzt ein kleines Zirkus-Revival in Gang gesetzt zu haben. Titel wie Will Elliotts "Hölle", Genevieve Valentines "Mechanique" oder kürzlich die von Ekaterina Sedia herausgegebene Anthologie "Circus: Fantasy Under the Big Top" zeigen den eigentlich wenig überraschenden Umstand, dass sich dieses ganz spezielle Ambiente gut als Setting für Geschichten mit Fantasy- bzw. Gruseleinschlag eignet. Dabei müssen die fahrenden Leut' keineswegs immer wie bei Bradbury unschuldige NormalbürgerInnen in den Abgrund ziehen - aber das Schicksal scheint eine Vorliebe dafür zu haben, sie an dessen Rand zu stellen. Manchmal auch als Wächter.
... wie im neuen Roman von "Mr. Shivers"-Autor Robert Jackson Bennett, wo nicht weniger als der Erhalt der ganzen Welt auf dem Spiel steht. Genau genommen geht es in "Silenus" zwar nicht um den klassischen Zirkus im Zelt, sondern um das Vaudeville. Aber abgesehen davon, dass man schlecht Elefanten auf Varieté-Bühnen hieven kann, waren die buntgemischten Darbietungen dieser ausgestorbenen Kunstform dem Zirkus doch sehr ähnlich. Die "Truppe" des Romans und seines Originaltitels umfasst neben einer Tänzerin und einem Cellisten immerhin auch einen "Doktor", der mit unheimlichen Marionetten auftritt, und eine "starke Frau", die trotz schmächtiger Erscheinung mühelos Stahlträger verbiegt. Unter der Leitung des Impresarios Heironomo Silenus zieht diese Truppe durch den einstigen Keith-Albee-Circuit, ein Netzwerk von Vaudeville-Bühnen in den USA. Der Roman ist damit auf das frühe 20. Jahrhundert festgelegt. Eine Anmerkung, dass das Osmanische Reich fast bis Deutschland reiche, lässt zwar kurz an eine Parallelwelt denken ... aber wer weiß, vielleicht ist der US-Autor ja auch der Meinung, dass Mexiko beinahe an Kanada grenzt.
Hauptfigur ist der 16-jährige George Carole aus Ohio. Elternlos aufgewachsen, hat George seiner Großmutter entlockt, dass Silenus sein Vater sei. Und gewohnt, zu bekommen, was ihm zusteht, reist er daraufhin dessen Truppe hinterher. Der Kontakt läuft dann aber ganz anders ab, als er sich das ausgemalt hatte. Er erlebt mit, wie das Publikum nach einer Vorstellung der Truppe seltsam benommen (aber durchaus glücklich) zurückbleibt. Und bei der ersten direkten Begegnung mit seinem Vater wird er von diesem erst gewürgt und dann mit ziemlich bizarren Fragen gelöchert. Auch nachdem George sich der Truppe anschließen durfte, wird sich Silenus selten ausgemacht väterlich zeigen. Am wichtigsten ist aber eine andere Erfahrung: Die Truppe leistet einen entscheidenden Beitrag zum seit undenklicher Zeit tobenden Kampf, die Welt - oder genauer gesagt die Schöpfung - gegen das Nichts zu verteidigen. Verkleidet als Männer in Grau hat die Finsternis längst ihre Wölfe als Agenten auf die Erde geschickt.
Einer der beiden Autoren des letztes Mal vorgestellten "The 101 Best SF Novels" hatte ein ausgemachtes Faible dafür, die Namen von Romanfiguren interpretationstechnisch auszuwringen. Hier zumindest würde er schnell fündig. Silenos war ein Satyr der griechischen Mythologie - passt gut zur schmerbäuchigen, trinkfesten und jederzeit einen ordinären Fluch auf den Lippen tragenden Hauptfigur Bennetts. Dass der Name kein Zufall ist, wird dem Leser spätestens klar, wenn George den vier personifizierten Winden begegnet, deren Namen ebenfalls aus der Antike überliefert sind - auch wenn George selbst sie in dieser Situation nicht erkennt. Allerdings mischt der Autor diese und andere Versatzstücke aus der griechischen Mythologie munter mit solchen aus der keltischen und ein bissel auch aus der germanischen - in dem Punkt war das Subgenre Contemporary Fantasy aber ohnehin nie sonderlich pingelig.
Interessanter als der eigentliche Weltende-Plot, der nichts grundlegend Neues enthält, ist die Schilderung der Personenkonstellation. Jede der sechs zentralen Figuren hat ihre ganz spezielle Lebens- und Leidensgeschichte - und wie die miteinander verwoben sind, hat Bennett wirklich geschickt herausgearbeitet. "Silenus" ist damit viel weniger ein "Thriller", wie auf dem Cover prangt, als eine Familiengeschichte um Leben, Lieben, Lügen, Tod und Reue. Kein literarisches Erdbeben, aber genau die Sorte Roman, die man zwischen zwei anstrengenderen Büchern gerne zur Erholung liest.

Robert L. Forward: "Das Drachenei"
Kartoniert, 398 Seiten, € 10,30, Heyne 2012 (Original: "Dragon's Egg", 1980)
Klingt nach Fantasy. Das täuscht aber. In Wahrheit handelt es sich beim 1980 veröffentlichten "Dragon's Egg" um einen echten Klassiker der Hard SF. Zur Sicherheit steht wie schon bei der deutschsprachigen Erstausgabe von 1981 auch auf dem Cover der aktuellen Version, erschienen zum 10. Todestag des Autors, der Zusatz "Leben auf einem Neutronenstern": Damit es kein Kuddelmuddel mit den Zielgruppen gibt!
Um "Das Drachenei" richtig einschätzen zu können, muss man die Vita des Autors berücksichtigen. Robert L. Forward war ein US-amerikanischer Physiker, der sich vorwiegend mit Gravitationswellen beschäftigt hat - gerne aber auch mit spekulativen Konzepten, von Weltraumtürmen (gewissermaßen der massiven Verwandtschaft von Weltraumfahrstühlen) bis zu Zeitreisen. Obwohl Forwards Forschungstätigkeit zu einigen praktischen Anwendungen beigetragen hat, musste das meiste davon natürlich in der Theorie verbleiben. Gegen Ende seiner akademischen Laufbahn nutzte Forward zunehmend die Möglichkeit, seine Ideen im Kontext der Science Fiction auszuarbeiten. Er veröffentlichte bis in die späten 90er Jahre eine Reihe von Romanen, von denen sein Erstling "Drachenei" der berühmteste geblieben ist.
Die Grundidee: Nach einer Supernova hat sich ein Neutronenstern gebildet und auf diesem ist Leben entstanden - exotisch vom Aufbau seiner Materie her, und doch letztlich nur allzu vertraut wirkend. Eine 20 Kilometer durchmessende Kugel aus dichtgepackten Neutronen, die sich fünfmal in der Sekunde um ihre Achse dreht und die 67-milliardenfache Schwerkraft der Erde hat, klingt nicht einladend. Und doch finden auch in dieser Umgebung Prozesse des Energie- und Materieaustauschs statt, die zur Bildung sich selbst reproduzierender Einheiten führen ... also Lebensformen. Und letztlich sogar intelligente: Die Cheela sind 2,5 Millimeter kleine "Amöben" aus dichtgepackten Atomkernen, die unter der Schwerkraft ihrer Welt zufällig auf etwa 70 Kilogramm Gewicht kommen ... das dürfte dann einer der schrägeren anthropozentrischen Einschläge in der Geschichte der SF sein.
Die Welt der Cheela ist flach - für weniger avancierte Wesen ist sie genau genommen sogar eindimensional, denn das Magnetfeld des Neutronensterns ist so stark, dass Bewegung und Sinneswahrnehmung fast nur entlang der Feldlinien möglich sind. Doch eine Naturkatastrophe zwingt die Cheela, ihr Ursprungsgebiet zu verlassen und mit der schweren Bewegung die Feldlinien zu kreuzen: Der Anfang zum Aufstieg ist gemacht! Anhand einiger herausragender Cheela-Vertreter lässt uns Forward an der Entwicklung dieses bemerkenswerten Völkchens teilhaben. Wir sind live dabei, wenn sie die Fähigkeit zum abstrakten Denken entwickeln und wenn sich schließlich Staatswesen, Religion und Wissenschaft herausbilden. Und auch wenn wir es hier mit superheißen Mikro-Fladen zu tun haben, wirken die Cheela mit ihren Mühen, Sehnsüchten und Konflikten doch um vieles menschlicher als Miévilles Ariekei.
... mit einer Ausnahme: Wie alles auf dem Neutronenstern läuft auch der Lebenszyklus der Cheela millionenfach schneller ab als der unsere - vom Neugeborenen- bis zum Greisenstadium vergeht gerade einmal eine Dreiviertelstunde. Die ersten neutronischen Organismen entstanden, als auf der Erde gerade die Pyramiden gebaut wurden. Und als dort eine Forschungsexpedition zum Neutronenstern beschlossen wird, trägt dieser noch nicht einmal die Vorstufe intelligenten Lebens. Beim Eintreffen des Raumschiffs "St. George" in seinem Orbit wenige Jahre später sieht dies schon ganz anders aus ...
Wenn sich eine Spezies sehr viel schneller entwickelt als eine andere, scheinen Konflikte unausweichlich - wie der zwischen Puppenspielern und Gw'oth in Larry Nivens "Ringwelt"-Prequels. Aber dafür dachte Forward doch zu sehr in den Bahnen eines optimistischen Wissenschafters und weniger in denen eines kalkulierenden Romanciers. Seine First-Contact-Geschichte läuft unter ebenso gutmütigen Umständen ab wie die seines berühmten Astronomenkollegen Carl Sagan in dessen Roman "Contact". Sie enthält überdies die vielleicht ungewöhnlichste, ganz sicher aber schnellste kosmetische Operation in der Geschichte der SF. Für Niven hat Forward übrigens am exotischen Setting von "Der schwebende Wald" ("The Integral Trees") mitgearbeitet. Wie überhaupt sein Einfluss auf die Hard SF nicht unterschätzt werden darf: Stephen Baxters erfolgreiche Romane "Das Floß" und "Flux" (der ebenfalls einen Neutronenstern zum Schauplatz hat) scheinen ohne die Vorarbeit von "Das Drachenei" kaum denkbar.
Für Human Drama waren die Romane Robert L. Forwards hingegen nie bekannt - sie sind gewissermaßen die Antithese zur gerade auf SIXX laufenden Serie "Defying Gravity". Bei der raschen Generationenfolge der Cheela ist ohnehin klar, dass wir hier mit keinem durchgängigen Protagonisten rechnen dürfen. Aber auch bei der parallel dazu gaaanz laaaangsam einschwebenden Expedition von der Erde interessierte sich der Autor viel mehr für Faktoren wie Rotationsmanöver und Kompensatormassen (am Ende des Romans folgt ein Teil mit ausführlichen Beschreibungen der dahinterstehenden Physik) als für menschliche Beziehungen. Immerhin hat er eine fiktive Urenkelin seines Kollegen Frank Drake, Schöpfer der berühmten Gleichung über die Anzahl außerirdischer Zivilisationen in der Milchstraße, an Bord untergebracht. Forward selbst hat sein schriftstellerisches Debüt als Fachbuch, das sich als Roman verkleidet, betrachtet. Das gilt es zu berücksichtigen, um dieses Buch angemessen würdigen zu können: Space Opera mal ohne allzuviele emotionsgeladene Arien. Aber mit einem Bühnenbild, das sich sehen lassen kann.
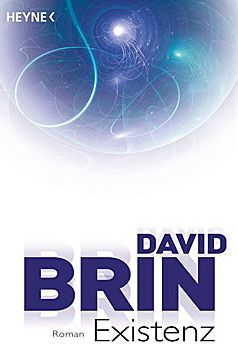
David Brin: "Existenz"
Broschiert, 896 Seiten, € 15,50, Heyne 2012 (Original: "Existence", 2012)
Wenn ich mir die Postings zu den letzten Rundschauen so durchlese, scheinen sich doch einige für David Brins Roman "Existence", der im Juni veröffentlicht wurde, interessiert zu haben. Trotz einer Fülle an Wortneuschöpfungen ist es kein Problem, den Mammutwälzer auf Englisch zu lesen. Jetzt dürfen sich aber auch alle diejenigen freuen, die doch lieber auf Deutsch schmökern: Seit dieser Woche ist auch die Übersetzung auf dem Markt.
Die ausführliche Rezension ist hier nachzulesen, ansonsten reicht es, das Szenario noch einmal in ein paar Schlagworten zusammenzufassen. Hauptfigur des Romans ist weniger eine/r der zahlreichen menschlichen (und außerirdischen) ProtagonistInnen als vielmehr unsere Zivilisation an sich. Mitte des 21. Jahrhunderts hat sie sich unter Fortschreibung der gegenwärtigen Tendenzen bis zu einem Punkt geschleppt, an dem alles mit angehaltenem Atem auf einen großen Umbruch wartet. Klimawandel, Wissenschaftsfeindlichkeit insbesondere in den USA, neue Lebens- und Kommunikationsformen durch die erweiterten Möglichkeiten der Informationstechnologie ... all das erleben wir bereits heute, Brin hat es lediglich ein, zwei Schritte weiterdenken müssen. Das Szenario wirkt wie ein bis zum Anschlag gespanntes Gummiband: Symbolisch dafür eine neue politische Gliederung der Weltgesellschaft, die eher wie ein letzter Waffenstillstand wirkt, um den finalen Krach noch einmal hinauszuzögern.
Und just zu diesem brisanten Zeitpunkt erfolgt der Erstkontakt. Noch dazu in ganz anderer Form, als alle gedacht hatten: Kein Raumschiff, keine Funkbotschaft - stattdessen ein Kristall, der auf die Erde niedergegangen ist und die holografischen Kopien zahlloser Aliens unterschiedlichster Herkunft enthält. Die sich überdies recht seltsam verhalten: Wie Kinder mit Plapperbedarf schubsen sie sich gegenseitig aus dem Weg, um mit ihrem menschlichen Kontakt sprechen zu können. Dabei nehmen die Gespräche eine unerwartete Wendung, und ich hab mir beim Lesen des Originals noch gedacht: Verdammt, auf Deutsch geht das nicht. Armer Übersetzer. Und kurz darauf: Halt, geht ja doch - sogar ganz einfach. Der Blick in die deutsche Ausgabe zeigt allerdings, dass diese Chance großzügig ignoriert wurde. Zum Glück werden noch andere Twists kommen, aber der wurde vergurkt.
Zwar muss sich Brin die Kritik gefallen lassen, seine eigentlich sorgsam aufgebauten Figuren wie einen kalt gewordenen Langos fallenzulassen. Als in Romanform gegossene Betrachtung über die Überlebenschancen der menschlichen Zivilisation - bzw. von Intelligenz und Zivilisation überhaupt - ist der Roman aber nicht nur dick, sondern auch wirklich groß.
An dieser Stelle folgen in der Regel orakelhafte Andeutungen über den Inhalt der nächsten Rundschau. Das muss diesmal entfallen - außer dem Hinweis, dass sie im November kommen wird. Zwar liegen reichlich Bücher bereit, bloß habe ich noch keine Auswahl getroffen. Daher: [insert cliffhanger here]
(Josefson, derStandard.at, 10. 10. 2012)