
Karsten Kruschel: "Vilm. Das Dickicht"
Broschiert, 310 Seiten, € 10,30, Wurdack 2013
Die Rundschau beginnt mit meinem bisherigen Lieblingsbuch mit Datumsstempel "2013". Je nach Zählung ist es der dritte oder vierte Band in Karsten Kruschels "Vilm"-Reihe - hängt davon ab, ob man "Galdäa" mitrechnen will oder nicht. Ich hatte mit "Galdäa" seinerzeit ein paar Schwierigkeiten, insbesondere formaler Art, weil dafür ältere Texte wiederverwendet wurden und die "Retroactive continuity" mich nicht ganz überzeugt hat. Jetzt aber kehren wir wieder auf den namensgebenden Schauplatz zurück. Und es ist der bisher beste "Vilm"-Roman von allen vieren.
Rückkehr nach Vilm
Die Handlung setzt etwa eine Generation nach den in Band 1 geschilderten Ereignissen ein. Nachdem ein Kolonistenschiff auf Vilm eine Crashlandung hingelegt hatte, musste man sich mit dem dauerverregneten und pflanzenüberwucherten Planeten irgendwie arrangieren. Kruschels Einfallsreichtum, was die erforderlichen Anpassungen betrifft, ist groß. So lernen wir in "Das Dickicht" beispielweise das Konzept der Weitergereichten Häuser kennen: Mobile Wohnkabinen, die sich von den Tentakeln der vilmschen Wälder in einem endlosen Kreislauf auf- und abbewegen lassen.
Die wichtigste Anpassung bleibt aber die Symbiose, die die Nachfahren der Pioniere mit den einheimischen Eingesichtern - optisch sechsbeinigen Hunden ähnelnd - eingegangen sind. Bis auf ein paar Relikte aus der Gründergeneration wie die einarmige Eliza ist jeder Vilmer nun ein auf zwei Körper verteiltes Individuum. Diese Körper sind getrennt voneinander einsetzbar, und doch steckt nur ein Geist dahinter. Beim Lesen kommt man da immer wieder ins Stolpern: Ein sehr schöner Effekt, der sich auch nicht abzunutzen scheint.
Besucherströme
Mehr noch als in Band 2 wird Vilm zum Ziel diverser Besucher von draußen. Insbesondere das Wolkengebirge, auch Supergestrolch genannt, hat es ihnen angetan: Ein kilometerhoher Wall aus Vegetation (vilm-typisch weder ganz pflanzlich noch tierisch), der sich um den Äquator zieht und in jeder Beziehung das Herz des Planeten darstellt. Der Raumfahrer Sergios Thanassatrides will seine Vermutung beweisen, dass es sich dabei um einen gigantischen organischen Computer handelt. Vertreter diverser Religionen glauben gar Gott darin zu erblicken - und andere haben es schlicht auf die zahllosen psychotropen Substanzen abgesehen, die der vilmsche Urwald liefert.
... jede Menge zu tun also für den planetaren Administrator Will und seine Helfer, damit ihre beschauliche Welt nicht allzutief in den Strudel galaktischer Interessenpolitik gerät. Deren wichtigste Akteure bleiben weiterhin geheimnisvoll, da Kruschels Vorgangsweise so ziemlich die Antithese zu Infodumps ist. Gut, die merkantile Bruderschaft der Goldenen kennt man mittlerweile ein bisschen besser (und versucht das geistige Auge zuzukneifen, wenn sie fett und nackt in ihren transparenten Schutzanzügen durch die Gegend stapfen ...). Doch was steckt hinter dem Päpste-Kollektiv (bzw. Päpstinnen-Kollektiv) und all den unzähligen konkurrierenden Splitterreligionen? Oder hinter den schon früher erwähnten ominösen Dunkelwelten? Aus einem Nebensatz erfährt man diesmal immerhin, dass eine Familie dort offenbar eine geradezu unglaubliche Zahl von Individuen umfasst. Begierig saugt man solche Info-Tröpfchen auf und wünscht sich langsam ein Vilm-Wiki.
Ökologie, Mysterien ...
Kruschel hat seinen Roman mosaikartig angelegt. Weder Will noch Sergios oder sonst jemand ließe sich wirklich als Hauptfigur bezeichnen. Diese Rolle nimmt Vilm bzw. das Supergestrolch selbst ein. "Er" bestimmt letztlich das Geschehen, und es ist ein ebenso vielseitiger wie unberechenbarer Player: Einer, der mit sich leben lässt und von seinen menschlichen BewohnerInnen auch mal Hilfe braucht, der sich aber auch - wenn nötig - zur Wehr setzt. Und der sich vor allem niemals, niemals, niemals in die Karten blicken lässt. Was zugleich den Roman selbst widerspiegelt, der sich dankenswerterweise in keinerlei Schema pressen lässt.
Nur Verwandtschaften, die gibt es natürlich. Ökologisch motivierte SF à la Ursula K. LeGuin oder Joan Slonczewski mag die mütterliche Seite bilden, die märchenartigen SF-Welten Cordwainer Smiths die väterliche. Dazu kommt aber noch ein drittes Element, das in "Das Dickicht" noch viel stärker durchschimmert als in den vorherigen Bänden: Humor. Und der ist von einer ganz besonderen Sorte.
... und genialer Witz
Sei es das stets einen Tick eigenwillige Wording (Gestrolche, Wurbls, Geländekugler), sei es haarsträubende Situationskomik (etwa wenn ein Flottenangehöriger als Ersatzkind an den Zitzen eines Muttertiers landet, dessen Junge er versehentlich getötet hat): Vom Tonfall her erinnert mich Kruschels Humor ganz stark an den eines AutorInnen-Paars aus der DDR, das ich niemals müde werde zu empfehlen: Johanna und Günter Braun. Und da Kruschel selbst aus dem Osten Deutschlands stammt, ist anzunehmen, dass deren g-r-o-ß-a-r-t-i-g-e-s Werk seinen Einfluss auf ihn hatte.
Kennzeichen? Schwer zu beschreiben, ich versuch es mal so: Mit bestenfalls einem resignierten Achselzucken nehmen die ProtagonistInnen der Brauns Situationen hin, die so absurd sind, dass jeder mit weniger Contenance sich vor Lachen brüllend am Boden winden müsste. Oder Selbstmord begehen. Wie kein anderer seit den Brauns trifft Kruschel diesen ganz speziellen Ton, der zwischen dem totalen Irrsinn und leiser Ironie angesiedelt ist. Wie schreibt Kruschel doch zur peinlichen Selbstinszenierung eines religiösen Potentaten? Dann warf er sich der Länge nach auf den Boden, der seiner Überzeugung nach den göttlichen Gesandten hervorgebracht hatte. Zur Begrüßung und als Ausdruck seiner Dankbarkeit küsste er den Boden des Regenplaneten. Der Boden, halb flüssig, versuchte auszuweichen.
"Vilm. Das Dickicht" lässt sich leicht zusammenfassen: Das pure Vergnügen.
Jo Walton: "In einer anderen Welt"
Klappenbroschur, 298 Seiten, € 15,40, Golkonda 2013 (Original: "Among Others", 2011)
Dieser Roman hat im Vorjahr die wichtigsten Genre-Preise (Hugo, Nebula, British Fantasy Award) abgeräumt - und das, obwohl er bis zum Ende offenlässt, ob die geschilderten Phantastik-Elemente tatsächlich Teil der Romanwelt sind oder ob es sie nur im Kopf der Hauptfigur gibt. Ein delikater Balanceakt, den Autorin Jo Walton mit Bravour bewältigt.
"In einer anderen Welt" findet sich die 14-jährige Morwenna zunächst mal in ganz banaler Weise wieder. Wir schreiben das Jahr 1979, und die junge Waliserin wird bei ihrem Vater untergebracht, der die Familie vor langer Zeit verlassen hat. Er lebt in England, und dort befindet sich auch das elitäre Internat, an das Morwenna gewissermaßen weitergereicht wird. Ihre Herkunft macht sie zur Außenseiterin (nebenbei bemerkt: witzig, dass man offenbar bereits in Wales das englische Essen schrecklich findet ...); dass sie wegen ihres verkrüppelten Fußes nicht an den ach so wichtigen Sportveranstaltungen teilnehmen kann, verstärkt dies noch.
Die wahren Abenteuer sind im Kopf
Doch nicht dass sich Mori deswegen in eine Opferrolle drängen ließe: Der Sport wie auch die ganzen Teenager-Rituale im Internat gehen ihr komplett am Arsch vorbei. Viel lieber liest sie sich - mit vulkanischem Lesetempo - durch das, was Buchhandlungen und Bibliotheken an Science Fiction und Fantasy hergeben; vor allem SF. "In einer anderen Welt" baut mehr Buchtitel in die Handlung ein als Lavie Tidhars "Bookman" - und die hier gibt es alle wirklich. Walton, die übrigens die gleichen biografischen Eckpfeiler hat wie Morwenna, hat sehr auf Publikationsdaten geachtet. Nur folgerichtig also und doch ein netter Gag, wenn sie die ultrabelesene Mori über etwas stolpern lässt, von dem ich noch nie gehört habe, "Per Anhalter durch die Galaxis".
Die Bücher sind für Morwenna aber nicht nur Zeitvertreib. Sie wendet deren Vokabular auf ihre Lebenswelt an (identifiziert beispielsweise gemäß Vonnegut soziale Umfelder als Granfalloon oder Karass) und greift literarische Anregungen auf, um ihr Weltbild zu schärfen. Mit jugendlicher Begeisterungsfähigkeit bezieht sie das Kommunistische Manifest auf LeGuins "Planet der Habenichtse", empört sich darüber, dass "Narnia" eine christliche Allegorie sein soll, oder erklärt feierlich in ihrem Tagebuch: "Was mir an Science Fiction schon immer gefallen hat, ist, dass es einen dazu bringt, über alle möglichen Sachen nachzudenken und sie aus einem Blickwinkel zu betrachten, an den man bisher nie gedacht hat. Von jetzt an werde ich Sex positiv gegenüberstehen."
Ebenen der Realität
Zunächst einmal ist "In einer anderen Welt" damit ein Roman über das Erwachsenwerden. Phantastik bildet einen fest integrierten Teil des Ganzen, ebenso wie Familien- und Regionalgeschichte, auf die ausführlich eingegangen wird. Menschliche Aspekte stehen für Walton stets im Vordergrund - siehe etwa die hier vor ein paar Jahren vorgestellte Alternativweltgeschichte "Farthing" über ein Großbritannien, das sich dem faschistischen Zeitgeist der 1930er Jahre ergibt.
Doch lässt man uns nie vergessen, dass Morwenna mit einer ganzen Wagenladung Geheimnisse in England angereist ist: Warum kommt sie beim ihr fremden Vater unter, obwohl ihre Mutter offensichtlich nocht lebt? Was war das für ein Ereignis, bei dem Morwennas Zwillingsschwester zu Tode kam und Mori selbst verkrüppelt wurde? War es wirklich eine magische Schlacht, wie Mori andeutet? Und gibt es die "Feen", mit denen sie spricht, wirklich? Kein sehr günstiges Wort, weil man sich dazu unwillkürlich ein fliegendes Burgfrollein mit Schultüte am Kopf und Zauberstab in der Hand vorstellt, aber für das Faerie-Konzept, das tief in der Mythologie West- und Nordeuropas verankert ist, gibt es auf Deutsch halt keine Entsprechung. Was Morwenna als "Feen" bezeichnet, erinnert sie übrigens eher an Pflanzen als an Menschen oder Tiere.
Wie gesagt: "In einer anderen Welt" vollführt einen Balanceakt. Morwenna praktiziert Magie und ist von deren Wirkung überzeugt. Aber sie sagt selbst, dass diese Magie keinem unmittelbaren Ursache-Wirkung-Prinzip folgt, sondern auf eine subtilere Weise abläuft. Und sie räumt ein, dass diese Wirkungsweise genausogut durch Zufallsfaktoren erklärt werden könnte.
Wir sind Morwenna
Abschließend kann ich's mir nicht verkneifen anzumerken, dass ein Buch über ein pubertierendes Mädchen, das im Internat lebt und Feen sieht, nicht unbedingt nach etwas klingt, das mich unwiderstehlich anlocken würde. Nichtsdestotrotz habe ich "In einer anderen Welt" in einem Rutsch durchgelesen. Wofür es erfahrungsgemäß nur eine Erklärung gibt: Das Buch ist wirklich gut.
Und letztlich braucht man sich auch nicht von demografischen Äußerlichkeiten abschrecken lassen, wenn es sich um etwas so Allgemeingültiges wie die Macht der Phantasie handelt. In diesem Sinne jedenfalls ließe sich das Vorwort auch deuten: Halten Sie das, was ich hier schreibe, ruhig für meine Memoiren. Für Memoiren, die später - zum Entsetzen aller Leser - angezweifelt werden, weil der Verfasser gelogen hat und sich herausstellt, dass er eine andere Hautfarbe und ein anderes Geschlecht hat, dass er einer anderen Schicht und einer anderen Konfession angehört, als ursprünglich behauptet. Kurz: Wir alle sind Morwenna.
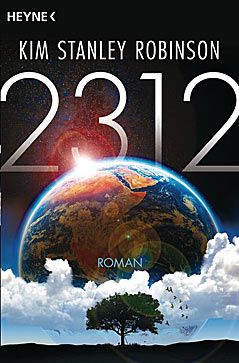
Kim Stanley Robinson: "2312"
Broschiert, 590 Seiten, € 15,50, Heyne 2013 (Original: "2312", 2012)
Nach dem Buch, das im Vorjahr Hugo und Nebula abgeräumt hat, kommt nun also mit Kim Stanley Robinsons langerwarteter Rückkehr auf den deutschsprachigen Markt ein Roman, der heuer in beiden Bewerben antreten wird. Kurz zusammengefasst: Ich würde für die Konkurrenz stimmen.
Terraforming ohne Rücksicht auf Verluste
"2312" entspricht ganz dem "Zurück-ins-Sonnensystem"-Trend, der schon seit einigen Jahren in der SF zu verzeichnen ist. Der Rest des Universums wird weitgehend als das abgehakt, was er im Grunde ist: unerreichbar. Nicht dass dieses neue Weltraumbiedermeier für Robinson selbst einen Umbruch bedeuten würde, er hat mit seiner berühmten "Mars-Trilogie" in den 90ern diesbezüglich sogar Maßstäbe gesetzt. "2312" greift das Grundmotiv der Trilogie erneut auf: Terraforming ist das zentrale Thema des Romans. Über 19.000 Himmelskörper im Sonnensystem wurden besiedelt, seien es ausgehöhlte Asteroiden, die als mobile Terrarien irdischen Biotopen Asyl gegeben haben, seien es sämtliche Gesteinsplaneten und größeren Monde.
Angst vor radikalen Methoden hatte man dabei nicht; so wurde z.B. der Saturnmond Dione komplett verwurstet, weil sein Wassereis gebraucht wurde. Liest man dazu einige sachbuchartige Passagen, in denen Habitatbau und planetare Umgestaltung im launigen Ton einer Do-it-yourself-Anleitung dargestellt werden, raunt einem unwillkürlich eine innere Stimme "Vorsicht, Hybris!" zu. Aber Robinson hat dazu eine ebenso klare wie achtbare Einstellung: [...] letztlich sind wir dazu da, uns ins Universum einzuschreiben, und es ist durchaus angemessen, dass wir uns daran erinnern, wenn man uns ein leeres Blatt hinhält. Landschaftskunst erinnert uns immer wieder daran: Wir leben auf einer Tabula rasa und müssen auf ihr schreiben. Es ist unsere Welt, und ihre Schönheit existiert allein in unseren Köpfen.
Zur Handlung
Hauptfigur Swan Er Hong, eine Land-Art-Künstlerin und ehemalige Terrarien-Designerin, lebt auf dem Merkur. Genauer gesagt in Terminator, einer Stadt auf Schienen, die in konstanter Geschwindigkeit vor dem apokalyptischen Sonnenaufgang des innersten Planeten herrollt. Bis ein Anschlag die ewige Reise der Stadt beendet. Zudem ist kurz davor die "Löwin des Merkur", Swans Großmutter, verstorben - ein verdächtiger Zufall. Swan erfährt, dass ihre Großmutter weit über den Merkur hinaus politisch aktiv war, und sieht sich widerwillig in die Rolle gedrängt, das Erbe der Löwin anzutreten.
Alles in allem ist Swan eine sehr interessante, weil vielschichtige Figur. Sie wirkt oft abweisend, hilft aber auch selbstlos einem Klimaflüchtling dabei, die Erde zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Und sie kann sich wie ein Kind über das Erleben der Natur freuen, den Aufgang der Riesensonne über ihrer Heimat genießt sie ebenso wie den blauen Himmel der Erde. Ihre Persönlichkeitsfacetten spiegeln sich gewissermaßen auch körperlich wider, denn da hat Swan große Experimentierfreude bewiesen. Sie trägt ein Quantencomputer-Implantat (mit dem sie gerne herumzickt), hat verschiedene Gehirnregionen mit Tier-DNA aufmotzen lassen und sogar einen Cocktail aus außerirdischen Mikroben geschluckt. Ach ja, und sie hat einen kleinen Penis. Letzteres ist in Robinsons Zukunftswelt des polysexuellen Hermaphroditismus aber eher die Regel als die Ausnahme.
Drei Elemente bilden das Handlungsgerüst von "2312": Anschläge auf Weltraumhabitate, das undurchsichtige Auftreten von Qubes (Künstlichen Intelligenzen auf Quantencomputerbasis) und Swans langsam wachsende Beziehung zu Fitz Wahram, dem Botschafter der Saturn-Liga. Ein musischer "Froschmensch" und eine ebenso empfindsame wie langweilige Seele. All das ist jedoch ein eher lockerer Rahmen für eine mäandernde Reise durchs Sonnensystem. Swan marschiert mit Wahram durch die Tunnel unter der Merkur-Oberfläche und diskutiert dabei über Beethoven, surft auf den Wellen der Saturnringe, bestaunt die Versuche, den grönländischen Eisschild zu retten und so weiter und so fort. In den besten Momenten erzielt Robinson dabei echten Sense of Wonder; in anderen fragt man sich, ob das alles auch mal irgendwo hinführen wird.
Merk dir das ...
"2312" ist aber nicht einfach eine Rundreise durchs Sonnensystem, es ist eine Bildungsreise. Robinson hat zwei Sorten von nicht-epischen Elementen in den Roman eingebaut. Das eine sind sogenannte Listen, Assoziationsblaster-artige Aneinanderreihungen von Begriffen aus einem bestimmten Themenfeld. Das können topologische Bezeichnungen sein, aber auch Weltraumantriebsmodelle, Zufriedenheitsfaktoren oder Extremsportarten der Zukunft ... einmal auch (im Gesamtkontext etwas pikant) Synonyme für Langeweile.
Das zweite sind Auszüge, die lexikalisches Wissen wiedergeben, heutiges oder das der Romanwelt. Zum Beispiel zum Aufbau der Planeten oder zu den historischen Epochen, die der Romangegenwart vorausgingen (Accelerando - Ritardando - Balkanisierung des Sonnensystems). Das ist mal interessant, mal relativ banal. Und "Auszüge" ist wörtlich zu nehmen, denn nur ein Teil davon ist vollständig ausformuliert. Der Rest sind Sätze bzw. Absätze wie: "drei Prozent der Säugetiere sind monogam. Im Spiel lernen Säugetiere, wie sie mit Überraschungen", und aus. Mag ja ein Stilmittel sein und in ihrer Masse gar nicht mehr erfassbare Wissensmengen suggerieren. Unterm Strich sind's aber einfach unvollständige Sätze, und auf Dauer geht das zumindest mir auf den Zünder.
Das ist aber noch nicht alles, auch innerhalb der eigentlichen Erzählung wird reichlich doziert. Bis hin zu Schul-Dialogen à la: "Erzähl mir mehr von den Gründen für Revolutionen." - [weitschweifige Erläuterung] - "Das waren alles Klassensysteme?" - [weitschweifige Erläuterung] - "Also gab es nie eine klassenlose Gesellschaft." - [weitschweifige Erläuterung]. Viel uneleganter hätte Frank Schätzing das auch nicht hinbekommen.
Kritikpunkte
"2312" hat ein gemischtes Echo ausgelöst. Ich empfehle auch einen Blick auf die Sternvergabe auf Amazon.com: Eine derartige Gleichverteilung hab ich noch nie gesehen. Verwundern kann das nicht. Ein Text, der erstens Hard SF ist und zweitens - durchaus zu Lasten einer flüssigen Handlung - derart massiv auf Wissensvermittlung setzt, muss sich natürlich auch Kritik am Umgang mit Fakten gefallen lassen.
Die einen bemängeln, dass es Robinson mit der Physik nicht so genau genommen habe, die anderen vermissen Details zum utopisch anmutenden wirtschaftspolitischen System der Raumer. In der Tat wird nicht wirklich klar, warum die Menschen draußen alles soviel besser machen sollten als daheim auf "dem einzigen Schlamassel" Erde. Da kommt auch wieder die beim Terraforming erwähnte Macher-Attitüde durch, und irgendwie klingt da doch ein Zug von "Wir in der Neuen Welt zeigen euch, die ihr die Alte verbockt habt, mal, wie's richtig geht" an.
... selbst wenn der Aktionismus haarsträubende Ausformungen annimmt. Ich wage es zu bezweifeln, dass man ein planetares Ökosystem wieder aufbauen kann, indem man die im All nachgezüchtete Tierwelt einfach über der Erde - buchstäblich - abwirft und dann alles sich selbst überlässt. Bei Cordwainer Smiths "When the People Fell" ergab das ein wunderschönes Bild, aber "2312" soll ja Hard SF sein und kein Zukunftsmärchen.
Erstickt am eigenen Anspruch
Vergleiche mit John Brunners "Stand on Zanzibar" waren vielerorts zu lesen. "2312" fällt ja auch in dieselbe Kategorie von in Collage-Technik erstellten 360-Grad-Panoramen. Das schwebt schon von seiner Grundanlage her unweigerlich an der Grenze zwischen dem Meisterlichen und dem Prätentiösen. Und das jüngste vergleichbare Beispiel ist mit David Brins "Existenz" noch gar nicht so lange her. Vielleicht ist das auch ein bisschen das Pech mit "2312": Einmal Die-ganze-Welt-in-einem-Buch alle fünf Jahre würde nämlich auch reichen.
Zumal es einen für den Sympathiewert nicht unwichtigen Unterschied dann doch gibt: "Existenz" war eine als Roman verkappte Diskussion. Während ich einfach den Eindruck nicht abschütteln kann, dass "2312" eine als Roman verkappte Belehrung ist.
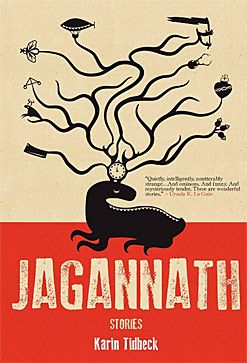
Karin Tidbeck: "Jagannath"
Broschiert, 138 Seiten, Cheeky Frawg Books 2012
Unsettling, in Rezensionen zu Karin Tidbecks großartiger Story-Sammlung "Jagannath" oft zu lesen, ist ein sehr schönes Wort. Es bringt das Gefühl zum Ausdruck, aus seiner gesicherten Wahrnehmung der Welt herausgerückt zu werden; das Bedürfnis, sich nach Haltegriffen umzuschauen, weil die Realität jederzeit unter einem weggeklappt werden könnte.
... wie es der Titelfigur von "Who is Arvid Pekon?" widerfährt, einem Telefonisten, der die Aufgabe hat, Anrufe bei Regierungsstellen oder sonstwie schwer zu erreichenden Personen mit verstellter Stimme selbst zu beantworten. Was zunächst nach einer satirischen Hommage an George Orwell aussieht, kehrt sich auf unheimliche Weise ins Gegenteil um, als eine Anruferin Arvid selbst zu sprechen wünscht. Eine glasklare Bizarro-Geschichte, inklusive ihres grausigen Endes.
Die Autorin
In ihrer Heimat ist die schwedische Autorin Karin Tidbeck schon länger bekannt, auf Deutsch gibt es meines Wissens noch nichts von ihr. Dafür hat sie mit "Jagannath" für einiges Aufsehen im englischsprachigen Raum gesorgt. Sie ist auch recht geschickt vorgegangen: Hat einen Teil der hier versammelten Geschichten - manche übersetzt, manche direkt auf Englisch geschrieben - in Magazinen wie "Weird Tales" untergebracht. Und nicht zuletzt am berühmten Clarion Workshop für SF- und Fantasy-AutorInnen teilgenommen, was in Sachen Vernetzung auch nicht schadet.
So unvermeidlich, wie in Rezensionen zu isländischer Pop-Musik sofort von "Elfen" gefaselt wird, so glauben viele in Tidbecks Werk auch gleich das "typisch Skandinavische" entdeckt zu haben. Das gilt aber nur für den Teil der hier versammelten Geschichten, die sich tatsächlich auf die nordische Mythologie und Folklore beziehen (mehr dazu später). Obiges "Arvid Pekon" würde man eher für eine Ausgeburt des Bizarro-Zentrums Portland in Oregon halten.
Geografie ist nicht alles
Gleiches gilt für "Aunts", eine von zwei lose verbundenen Geschichten aus einer zeitlosen Gartenwelt, deren nicht-menschliche BewohnerInnen sich in Dekadenz und grausamen Spielen ergehen. "Aunts" beschreibt den Lebenszyklus dreier "Tanten", die durch ständiges Gefüttertwerden Fett in konzentrischen Schichten anlegen - solange, bis sie ausgeweidet werden und an ihrem Herz der Kern einer neuen Tante wächst. Die Surrealität des Vorgangs, die eindringlichen Bilder und der hohe Grad an Körperlichkeit: Einmal mehr sind das typische Wesensmerkmale von Bizarro Fiction.
Nicht dass Tidbeck deswegen die verlorene Schwester von Carlton Mellick III wäre. Andere Geschichten sind aus anderen Gründen nicht als "typisch nordisch" zu schubladisieren. In "Beatrice" teilen sich zwei Menschen ein Fabrikslager, in dem sie die jeweilige Liebe ihres Lebens unterbringen: Er ein Luftschiff, sie eine Dampfmaschine. Liebe ist hier übrigens auch im körperlichen Sinne gemeint ... trotzdem bleibt es eine seltsam berührende Episode. Und die Titelgeschichte "Jagannath", die fällt unter SF. Hier leben Menschen wie Symbionten im Inneren einer insektenhaften Biomaschine, die sie über die Oberfläche einer angeblich gefährlichen Welt trägt. Sie nennen die Maschine "Mutter" - mit Recht, wie sich zeigen wird.
Ein weiteres Highlight ist das unheimliche "Rebecka", angesiedelt in einer Welt, in die Gott zurückgekehrt ist. Durchaus zum Leidwesen einer jungen Frau, die immer wieder versucht sich umzubringen, dank göttlicher Intervention aber stets scheitert. Ihre Versuche werden kreativer - und obwohl die Erzählung mit dem Endresultat beginnt, wächst das zunächst subtile Grauen im Verlauf weniger Seiten bis ... ja, bis Tidbeck einem mal wieder den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Die Welt neben der unseren
Nun zu den Erzählungen, in denen die Autorin Motive aus der Folklore aufgegriffen hat. "Pyret" tut dies in der Form eines wissenschaftlichen Artikels über ein Wesen, das die Gestalt derer imitiert, deren Nähe es sucht. Die Protagonistin von "Brita's Holiday Village" erhält ebenfalls Besuch von nicht-menschlichen Wesen. Und in "Reindeer Mountain" treffen zwei Mädchen mit sehr unterschiedlichen Erwartungen an die Welt auf Wesen, die - wie einst die Ahnin der Mädchen - "vom Berg herabkamen". Was in der Tat ein sehr nordisches Motiv ist.
Auffallend dabei ist, dass der Kontakt zur anderen Welt weder eindeutig positiv noch negativ bewertet wird, dafür aber stark von Melancholie geprägt ist. Das gilt für "Pyret", "Reindeer Mountain" oder "Brita's Holiday Village" ebenso wie für "Some Letters for Ove Lindström", das auf eindeutige Phantastik-Elemente verzichtet, aber ebenfalls das Verschwinden in eine andere Welt thematisiert, die gleich neben der unseren liegt.
Oder für "Cloudberry Jam", dessen Hauptfigur sich aus allerlei Zutaten in einem Topf ein beinahe-menschliches Kind zusammenbraut. Dieses beinahe Menschliche hätte das Potenzial zu einer klassischen Frankenstein-Geschichte, aber so tickt Tidbeck nicht. Zum Glück. Nicht umsonst führt sie Tove Jansson, die Schöpferin der "Mumins", als Inspirationsquelle an. So unheimlich die 13 Geschichten von Karin Tidbeck streckenweise auch sind, die Botschaft zwischen den Zeilen lautet hier wie dort: Akzeptiere, dass du manches niemals verstehen wirst, und begreife, dass "anders" nicht automatisch "besser" oder "schlechter" bedeutet. Vielleicht ist das ja die eigentliche Weltbild-Verrückung.

Tim Akers: "Die Untoten von Veridon"
Broschiert, 334 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2013 (Original: "Dead of Veridon", 2011)
Ich richtete die Flinte auf sein Gesicht und drückte auf den Abzug. Er sackte als schwarze, blutige Masse zusammen. Zwei Krähen, das Gefieder mit Körperflüssigkeiten verschmiert, kämpften sich aus seiner Brust. Jede steckte in einem Messingkäfig in den Lungen des Toten. Willkommen zurück in der Stadt Veridon, wo sich Dampfkraft, Mechanik und Magie zu einer Technologie verbunden haben, die die tollsten Effekte hervorruft. Vor allem, wenn sie erst einmal in den menschlichen Körper hineingesteckt worden ist.
Näheres zum Setting von Tim Akers' fiktiver Welt ist in der Rezension zum Vorgängerband "Das Herz von Veridon" nachzulesen. "Die Untoten von Veridon" ist keine unmittelbare Fortsetzung - es setzt zwei Jahre nach den Ereignissen von Band 1 ein -, enthält aber zahlreiche Verweise darauf. Wer "Das Herz" nicht nachlesen will, kann sich mit dem Wissen begnügen, dass die diversen ProtagonistInnen eine (weitgehend unerfreuliche und ziemlich blutige) Vorgeschichte verbindet, und wird sich dennoch zurechtfinden.
Zur Handlung
Hauptfigur Jacob Burn, ein enterbter Sohn aus gutem Hause, arbeitet mittlerweile nicht mehr für den Boss eines Verbrechersyndikats, sondern nimmt gewissermaßen als Freelancer dubiose kleine Aufträge an. Sein jüngster löst allerdings eine Katastrophe aus: Jacob liefert nichts Böses ahnend ein Päckchen bei den Fehn ab, die in den Flüssen unterhalb Veridons leben. Die Fehn sind symbiotische Würmer bzw. Schnecken mit Kollektivintelligenz, die in die Körper Ertrunkener eindringen und deren Persönlichkeit nach dem Tod für eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Jacobs Lieferung wandelt sie jedoch in eine uns geläufigere Form von Untoten um - und die ersten Zombie-Attacken sind nur der Beginn einer Welle bizarrer postmortaler Metamorphosen. Politische Machtkämpfe und eine Bedrohung von außen halten Veridon einmal mehr in Atem.
Jacobs Auftraggeber war der unheimliche Ezechiel Cranich ... obwohl: Wer ist hier nicht unheimlich? Nehmen wir Jacobs Kumpel Wilson mit seinen Spinnenarmen am Rücken, seinem Mund voller nadelspitzer Zähne und seiner immer wieder aufwallenden Mordlust. Oder die maskierte Kämpferin in hautenger Lederkluft, die "Trinity"-mäßig durchs Kampfgetümmel wirbelt. Steckt hinter der Maske gar Jacobs in Band 1 verstorbene Freundin Emily? Immerhin lehren uns die "Veridon"-Romane eines: Der Tod ist hier ein seeeehr relativer Begriff, und auf die eine oder andere Weise kommen sie (fast) alle wieder.
Glamour à la Giger
Und dann wäre da noch die Ratsherrin Angela Tomb, mit der Jacob eine Mischung aus gegenseitigem Abscheu und nostalgischen Kindheitserinnerungen verbindet. Die sollte inzwischen eigentlich auch tot sein, aber die Giger-Technologie Veridons hält sie buchstäblich aufrecht. Die Beschreibung ihres "Lokomotivkleids" verdient eine ausführliche Zitation:
Der Großteil des Aggregats war so getarnt, dass er wie in Ballkleid aussah, eine breite Kuppel aus Metallblättchen, die Rüschen, Zinnenmuster und eine Turnüre nachahmten. Angela war an der Hüfte in diese Gerätschaft geklemmt. Ihre Beine hatte man anscheinend abgeschnitten oder ins Innere eingefügt. Sie bewegte sich fast schwebend über den Boden, während hundert winzige Füße auf dem Stein trippelten wie eine Armee von kolbenbetriebenen Tausendfüßlern. [...] Dann hielt sie vor uns an und lächelte. Ein grauenhafter Anblick.
Aus der Turnüre des Lokomotivkleids ragte ein Messingtank samt Turm, der bis knapp unter den Ansatz von Angelas glattem Hals reichte. Der Turm erinnerte an einen lotrechten Spieß mit Messingspinnen, die ihre Beine in Angelas Rücken versenkt hatten und zuckten, wenn sie sich bewegte - entweder, um ihre Handlungen zu unterstützen, oder, um sie ihr vorzugeben. Die letzte der Spinnen hielt den Kopf von Ratsherrin Tomb wie ein zerbrechliches Ei. Zierliche Messingkolben umklammerten ihre Kieferpartie und umringten ihren Schädel wie ein Kranz. Ihr Friseur hatte viel Arbeit investiert, um die Maschine in Angelas sonnengoldene Locken zu integrieren.
Oberste Priorität: Action
Akers' Einfallsreichtum in Sachen biomechanischer Exzesse ist seine größte Stärke. Die Zeichnung der Charaktere hinkt da etwas hinterher. Immerhin wird Jacob in sich konsistent geschildert: Er verweigert sich konsequent sämtlichen Zwängen und (scheinbaren) Vernunftargumenten - mit Auswirkungen bis hin zur Auflösung der Geschichte. Nur ein wenig mehr emotionale Tiefe würde man sich wünschen. Zwar äußert sich Jacob immer noch betroffen über den Tod Emilys. Aber wenn er in diesem Roman ungewollt eine weitere Person, die ihm sehr nahe steht, tötet, halten sich die Gefühlswallungen in Grenzen. Ist ja nicht so, als würde so etwas kein Spannungspotenzial beinhalten. Aber Akers setzt eben lieber auf Hauen und Stechen. Stets garniert mit Herumgeflapse à la: "Wie sieht der Plan aus?" - "Hast du von mir auf diese Frage je eine nützliche Antwort bekommen?" - "Nicht wirklich." Das kennt man ja.
"Die Untoten von Veridon" vermittelt viel stärker als der Vorgängerband das Feeling, dass sich Tim Akers in seiner Welt dauerhaft eingerichtet hat. Was immer passieren wird - man wäre überrascht, wenn es ans Fundament ginge, im Sinne einer Welterklärung oder revolutionären Veränderung. Dabei gäbe es noch jede Menge offener Fragen: Woher die Menschen kamen, wer vor ihnen im Raum Veridons lebte und offenbar auf einer höheren technologischen Stufe stand, wer außerhalb der bekannten Welt lebt usw. Nur über die Fehn erfährt man diesmal einige hochinteressante neue Details.
Anders als noch in "Das Herz von Veridon" ist hier klar, dass es sich eher um ein abgeschlossenes Abenteuer in einem festgefügten Rahmen handelt. Aber die Romane erscheinen ja auch unter dem Emblem "Burn Cycle" und nicht "Burn Trilogy" oder so; einen fixen Handlungsbogen scheint Akers also vorerst nicht durchgeplant zu haben.
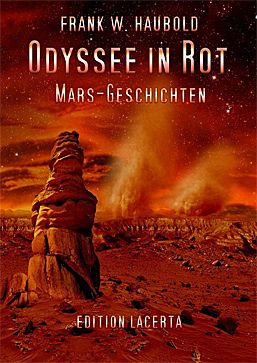
Frank W. Haubold: "Odyssee in Rot: Mars-Geschichten"
Broschiert, 238 Seiten, € 8,92, Edition Lacerta 2012
Die längste und zugleich einer meiner Lieblingsgeschichten in dieser Storysammlung, "Die Tänzerin", lässt sich lange bitten, bis der Mars ins Spiel kommt. Sie dreht sich um eine russische Primaballerina im Spätsommer ihrer Karriere, die sich das Selbstbewusstsein einer echten Diva erarbeitet hat, aber immer noch von ihren Erinnerungen getrieben wird. Lena Romanowa lässt sich zu einem Gastauftritt in ihrem alten Heimatkaff überreden und schlittert in eine Katastrophe. Das ergibt in sich eine so runde Sache, dass man denkt: Okay, Haubold wollte wie angekündigt seine Mars-Geschichten sammeln und hat diese eine einfach dazugestellt, weil sie gut ist. Aber dann taucht der Mars ja doch noch auf und verleiht dem Ganzen ein poetisches Nachspiel.
Neue Mars-Chroniken
Zugleich ist "Die Tänzerin" ein gutes Beispiel für eines der typischen Merkmale von Frank W. Haubolds ("Die Gänse des Kapitols", "Die Kinder der Schattenstadt") Erzählungen: Unvorhersagbarkeit. Neun Kurzgeschichten, geschrieben zwischen 2001 und 2007, sind in "Odyssee in Rot" enthalten und es hat sich gelohnt, sie noch einmal zusammenzufassen. Inspiriert sind sie laut Vorwort von Ray Bradburys "Mars-Chroniken", was für mich nicht automatisch verheißungsvoll klingt (mehr dazu später). Aber Haubold hat zum Glück seine ganz eigene Art zu erzählen.
Eine Parallele ist natürlich der Aufbau: Auch "Odyssee in Rot" präsentiert sich als chronologische Aneinanderreihung von Episoden, den Hintergrund bilden die fortschreitende Besiedelung des Mars durch irdische Auswanderer und ein eskalierender Krieg auf der Erde. Die Geschichten selbst sind nur lose verbunden. Die eine oder andere Figur taucht nach "ihrer" Geschichte noch einmal kurz auf - allen voran Martin Lundgren, der erste Mensch, der den Mars betreten hat. Seine metaphysischen Erlebnisse in der anfänglichen Titelgeschichte und in der letzten Erzählung des Bands ("Kalte Nacht") bilden eine ähnliche inhaltliche Klammer wie die Begegnungen Jean-Luc Picards mit Q am Anfang und Ende von "Next Generation".
Der menschliche Faktor
Womit bereits angedeutet ist: "Odyssee in Rot" ist keine Hard-SF wie Kim Stanley Robinsons "Mars-Trilogie". Haubold geht es um die Menschen und ihre ganz persönlichen Beweggründe dafür, sich zu einer neuen Welt aufzumachen. Der 15-jährige Kindersoldat, der sich in "Warchild" als blinder Passagier einschleicht, die Freelance-Agentin, die in "Die Frau im Schatten" auf dem Mars auf einen ihrer alten Fälle trifft, der Plutokrat, der sich in "Die weißen Schmetterlinge" eine ganz besondere Art von Gedenkstätte errichten lässt.
Selten sind die Motive der ProtagonistInnen so prosaisch wie in "Die alten Männer", wo der Mars als neues Paradies ohne Kriminalität, Terrorismus und Umweltverschmutzung beworben wird. Meistens sind es sehr intime Beweggründe. Erinnerungen, Reue, die Hoffnung auf eine zweite Chance und der Wunsch, Vergangenes rückgängig zu machen, sind die zentralen Motive der Geschichten.
Der Mars fungiert dabei als Projektionsfläche für all diese Wünsche und ist bis zu einem gewissen Grad sogar austauschbar. So beschließt der leicht angestaubte John in "Der Bibliothekar", dass er sein Leben auf der Erde hinter sich lassen wird ... stellt sich während der Reisevorbereitungen insgeheim aber die Frage, ob er sich nicht vielleicht wünschen sollte, dass das Schiff den Mars gar nicht erreicht. Wie in vielen anderen Geschichten bleibt auch hier etwas Ungesagtes zurück.
Magic Realism
Wenn sich der steinreiche und steinalte Lewis in "Die weißen Schmetterlinge" eine Erinnerungsblase schafft, in der er einen entscheidenden Moment seines Lebens rekonstruiert und verändert, dann handelt es sich dabei um einen real existierenden Ort, aus dem Marsboden gestampft mit allen Mitteln der Technik, die Lewis zur Verfügung stehen. Beim Protagonisten von "Der traurige Dichter", der in einem Gewächshaus in der Marswüste lebt, sieht dies schon anders aus. Er setzt seine Vergangenheit in Geschichten um, die schließlich Realität annehmen.
Orte, die besser gemieden werden, Stimmen aus dem Sandmeer, flüchtige Blicke auf schattenhafte Bewohner des Mars und Visionen, die Gestalt annehmen: Mehrfach verschwimmen in "Odyssee in Rot" die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Fantasie und Wirklichkeit - siehe auch "Warchild", das letztlich eine Orpheus-Geschichte in einem SF-Setting ist. In Bradburys "Mars-Chroniken" gab es nur eine vergleichbare Geschichte, "Night Meeting", in der ein Erdenmensch und ein Marsianer aufeinandertreffen. Beide scheinen aus unterschiedlichen Zeiten zu stammen: Wo der eine prachtvolle ur-marsianische Städte voller Leben sieht, kann der andere nur verlassene Ruinen und die Zeichen der neuen Kolonialisierung ausmachen. Es bleibt offen, wer von beiden "die" Realität wahrnimmt.
Ray Bradbury war einer der größten Stilisten, die die Phantastik jemals hervorgebracht hat. Allerdings fand ich seine Magic-Realism-Erzählungen immer sehr viel überzeugender als seine Science Fiction; man möge mir die Blasphemie verzeihen. Für meinen Geschmack hat sich Frank W. Haubold also vom bestmöglichen Teil des Vorhandenen inspirieren lassen und daraus etwas Eigenes geschaffen. Sehr schöne Sammlung.

Sean Cregan: "Das Areal"
Broschiert, 382 Seiten, € 10,30, Goldmann 2013 (Original: "The Levels", 2010)
Bei manchen Büchern kannst du dem Klappentext nicht entnehmen, ob sie unter Phantastik fallen oder nicht. Nichts weist direkt darauf hin, dass wir uns in eine Welt begeben, die nicht ganz der unseren entspricht, aber irgendetwas lässt es zwischen den Zeilen anklingen. Man kann bloß nicht den Finger drauflegen. Noch seltener sind Bücher, bei denen diese Unsicherheit auch nach dem Lesen noch anhält - Sean Cregans "Das Areal" ist eines davon.
Die Zeit ist heute oder vielleicht morgen Vormittag, der Schauplatz die Stadt Newport, wie es sie in dieser Form in den USA nicht gibt: Ein häufig vorkommender Name als Platzhalter, ähnlich dem Springfield der "Simpsons". Und am Rande Newports liegt das Keating-Areal, das Relikt eines hoffnungsvollen urbanen Traums aus der Ära des Modernismus, der mittlerweile buchstäblich im Sumpf versunken ist. Bewohnt von Verbrechern, Junkies und einer wehrlosen Unterschicht, längst aufgegeben von Politik und Polizei. Eine Dystopie im Kleinen.
Zu Handlung und Hauptfiguren
In diesem anarchischen Ghetto landen unabhängig voneinander die beiden Hauptfiguren. Beide sind Ex-irgendwas, was den Grundzug der Desillusionierung, der den Roman prägt, noch einmal unterstreicht. Nathan Turner hat früher für die CIA gearbeitet, lebt nun aber von Aufträgen eher privater Natur. Und Kate Friedman wurde vom Polizeidienst suspendiert, weil ihr Ex-Lover mit Drogen dealte und es sich nicht ganz klären ließ, wieviel sie davon wusste.
Kate gerät in den Überfall eines ultrabrutalen Serienmörders und wird dabei nicht nur verletzt, sondern auch mit einem tödlichen Virus infiziert, wie sie zu ihrem Entsetzen erfahren muss. Ein dubioses nicht-staatliches Sicherheitsteam nimmt Kate unter seine Fittiche und schleppt sie, kaum genesen, zur Jagd auf die "Bestie von der Sixth Avenue" ins Areal mit. Wo offenbar ein Biowaffen produzierendes Unternehmen illegalen Aktivitäten nachgeht. Derweil hat Nathan aus den Nachrichten erfahren, dass er bei einem Überfall getötet worden sein soll. Zum Glück hat ihn jemand verwechselt, aber wer hat es überhaupt auf ihn abgesehen? Im Areal findet Nathan vorerst Unterschlupf.
Natürlich werden sich die Wege der beiden Hauptfiguren früher oder später kreuzen, zudem trifft Nathan auf Ghost, ein traumatisiert wirkendes Teenager-Mädchen, das sich bei Bedarf in eine drogeninduzierte Tötungsmaschine verwandeln kann. Alles in allem scheint sich da ein ähnliches Familienbild wie am Ende von "Alien 2" abzuzeichnen. Umgeben von Gewalt (das Blut spritzte stoßweise, heißt es hier ständig), Verfall und Düsternis, erzählt in einem No-Nonsense-Stil in Reinkultur. "Das Areal" will in erster Linie spannend sein, und das ist es.
Surreale Atmosphäre
Und damit wieder zurück zur Frage, ob Phantastik oder nicht. Selbst wenn nicht gelegentlich ein Mann mit Clownsgesicht und einer SS-Uniform aus Latex in der Gegend herumstünde, und selbst wenn da nicht eine robentragende Sekte in einem Wohnturm hauste, hätte die Atmosphäre des Romans immer noch etwas Surreales. Das bewirken alleine schon die ehemaligen Vorzeigebauten des Areals, die wie fehlplatzierte Retro-SF-Versatzstücke im Ghetto herumstehen und längst in einer Weise umfunktioniert wurden, die sich ein Stadtplaner in seinen schlimmsten Albträumen nicht ausgemalt hätte. Außerdem zeigt sich Cregan bei der Namensfindung von der allegorischen Seite: So tummeln sich neben der Bestie und Ghost unter anderem Sorrow und die Furien im Geschehen.
Dass sich "Das Areal" schwer in eine Schublade stecken lässt, liegt am Autor. Hinter "Sean Cregan" steckt in Wirklichkeit John Rickards, ein britischer Krimi-Autor, von dem es auch auf Deutsch schon einige Thriller der konventionelleren Art gibt. Unter dem Cregan-Pseudonym überspringt er Genregrenzen ganz (etwa für die Alien-Invasionsgeschichte "Day Zero") oder siedelt seine Geschichten gezielt im Niemandsland an - wie auch in diesem Fall. Und eine Bezeichnung für die spezielle Mischung von "Das Areal", die's ziemlich gut auf den Punkt bringt, hat er auch parat: "Cyberpunk ohne Cyber-".
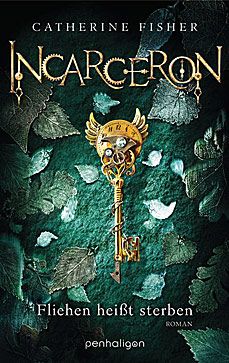
Catherine Fisher: "Incarceron"
Gebundene Ausgabe, 476 Seiten, € 19,60, Penhaligon 2013 (Original: "Incarceron", 2007)
Ihre Kern-Klientel bindet die britische YA-Autorin Catherine Fisher sicherlich mit der ewig jungen Frage, ob die beiden Hauptfiguren zueinander finden werden, an "Incarceron". Für ältere und abgebrühtere LeserInnen hat sie aber auch einen Dreh parat. Und der ähnelt durchaus dem Whodunnit-System klassischer Krimis: Es gibt eine begrenzte Auswahl an Verdächtigen, also kiefelt man bis zum Ende an der Frage, wer von denen es denn nun gewesen ist. Und bleibt damit bei der Stange.
Bei "Incarceron" geht es aber nicht um die Täterfrage, sondern darum, welches Konzept sich hinter dem Setting des Romans verbirgt. Fisher erweckt niemals den Eindruck, dass sie auf etwas gekommen sein könnte, an das von Asimov bis Zelazny nie jemand gedacht hätte, also ist die Zahl der möglichen Lösungen begrenzt. Natürlich werde ich den Teufel tun und verraten, welche die richtige ist - nur einen Hinweis kann ich mir aufgrund einer gewissen nostalgischen Wiedersehensfreude nicht verkneifen: Es ist ein sehr altes und beinahe kanonisches Konzept der Phantastik, das aber schon vor einiger Zeit komplett verlorengegangen zu sein scheint. Vermutlich weil es nicht funktionieren kann. Da "Incarceron" aber ohnehin unter Fantasy fällt, spielt das keine Rolle.
Drinnen ...
"Incarceron" handelt in zwei auf ungeklärte Weise miteinander verbundenen Welten. Da ist zum einen das gleichnamige Gefängnis, das nicht nur Zellen und Gänge, sondern auch ganze Landschaften voller metallener Bäume und teilorganischer Tiere enthält. Selbst in diesen "Freiflächen" gilt aber die herkömmliche Lichtan-/Lichtaus-Sperrstunde. Es kann zu Abschottungen und Beschuss kommen und die omnipräsenten Kameraaugen Incarcerons sehen alles. Es macht den Eindruck, als hätte Jeremy Benthams Vision vom Panopticon hier ihre ultimative Ausformung gefunden. Das Problem ist nur - neben der allgemeinen Verelendung und Brutalität im Gefängnisinneren -, dass die hinter Incarceron steckende Intelligenz anscheinend verrückt ist.
Und hier lebt der Teenager Finn, der sich nicht an seine Kindheit erinnern kann und glaubt, aus dem Außerhalb zu kommen. Er fristet ein gefährliches Dasein als Angehöriger eines Banditenhaufens und ist dementsprechend glücklich, als ihm ein unerhörtes Ding in die Hände fällt: ein Schlüssel. Damit und begleitet von ein paar mehr oder weniger vertrauenswürdigen Reisegefährten macht sich Finn dazu auf, den Weg ins Außerhalb zu finden. Einer soll dies ja schon mal geschafft haben: Der legendenumwobene Sapphique, der übrigens die Titelfigur des Fortsetzungsbandes ist.
... und draußen
Im Außerhalb fühlt sich derweil Claudia Arlexa, die Tochter des Hüters von Incarceron, ebenfalls wie eine Gefangene. Zum einen, weil sie zu einer politisch motivierten Heirat genötigt wird. Zum anderen aber auch, weil das Außerhalb selbst so seine Tücken und Zwänge hat. Irgendwann in der Vergangenheit gab es Krieg, wie wir aus kurzen Chronik-Auszügen erfahren. Danach wurden nicht nur alle politisch Missliebigen nach Incarceron abgeschoben; es wurde auch zivilisatorischer Stillstand als Mittel zur Erhaltung des Friedens propagiert.
Seitdem gilt das Gebot der Äratreue: An der Oberfläche lebt Claudia in einer ungefähr dem Barock entsprechenden Welt. Doch das sind nur Kulissen, unter denen immer noch eine Technologie schlummert, die mindestens der des 21. Jahrhunderts entspricht. Das führt zu einigen netten Einfällen Fishers und facht natürlich durch seine immanente Absurdität Claudias Rebellentum an. Sie ist fest entschlossen, aus ihrem Leben auszubrechen und herauszufinden, was es mit Incarceron auf sich hat. Irgendwann wird sie dabei natürlich über Weltengrenzen hinweg Kontakt zu Finn bekommen. Womit wir wieder bei der - pardon - Schlüsselfrage angekommen wären: Wo liegt Incarceron? Und ist "wo" eine geografische Kategorie?
Offene Fragen ...
Man könnte darüber diskutieren, ob "Incarceron" unter SF oder Fantasy fällt. Die Technologie spräche für Ersteres, aber das wäre zu oberflächlich. Fisher hat nicht nur Bilder aus Märchen entlehnt (in adaptierter Form treten etwa die drei Nornen, eine böse Königin oder auch ein "Drache", dem Jungfrauen und -männer geopfert werden, auf). Auch die Grundstruktur des Romans ist klar Fantasy: Eine Prinzessin und ein Waisenknabe ungeklärter Herkunft, der selbst ein Prinz sein könnte, müssen (buchstäblich) zueinander finden und ein magischer Gegenstand soll ihnen dabei helfen.
Soweit so gut, einige Ungereimtheiten trüben den Eindruck jedoch ein bisschen. Ein paarmal stolpert man über sprachliche Missgeschicke, die man noch einer ungenauen Übersetzung zuschreiben könnte. Auf dem Dach saßen Tauben, die gurrten und herumstolzierten, zum Beispiel - und eine ohnehin schon abscheuliche Fratze wird von einer Schutzbrille wohl auch nicht mehr entstellt werden können.
So manches Unlogische geht aber eindeutig auf das Konto der Autorin selbst. Wer würde in einer Welt, die Wissenschaft zwar selten praktiziert, aber sehr wohl kennt, ernsthaft an die Existenz einer Zauberin glauben? Allenfalls wären die BewohnerInnen einer Kulissenwelt noch skeptischer, was den äußeren Anschein betrifft, als wir. Und wie plausibel ist es, dass eine hochrangige Frau wegen des gebotenen Verzichts auf moderne Medizin im Kindbett stirbt - die Zimmermädchen aber hinter den Kulissen Waschmaschinen laufen haben? Eigenartige Prioritäten beim Schummeln sind das ...
... bis zuletzt
Im Schlussteil fährt "Incarceron" eine beachtliche Twist-Quote auf, die manche Ungereimtheit aufklärt - aber auch ganz eindeutig nicht alle. Und vieles wollte Fisher ohnehin lieber im Unklaren belassen, hat es den Anschein. Liest man sich die Buchforen zu "Incarceron" und dem Nachfolger "Sapphique" so durch, stellt man fest, dass sich die Fans auch nach dem Ende der Duologie noch immer die Köpfe zerbrechen.
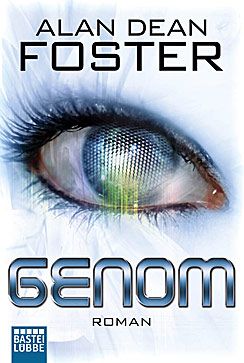
Alan Dean Foster: "Genom"
Broschiert, 349 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2012 (Original: "The Human Blend", 2010)
Dieses Buch habe ich vom vorjährigen Bestellschwung absichtlich bis zuletzt aufgehoben: Wem die Handlung von "Genom" zusagt, der kann sich dann nämlich gleich nächsten Monat die Fortsetzung ("Human") zulegen, die Mitte Mai erscheint. Denn auch wenn es befremdlicherweise nirgendwo am oder im Buch vermerkt ist: "Genom" ist der Beginn einer Trilogie, und das zentrale Rätsel bleibt am Ende dieses Bands UNGELÖST.
Der Originaltitel "The Human Blend" trifft den Kern der Sache übrigens besser. Für seine jüngste Trilogie hat Alan Dean Foster nämlich mal seine "Homanx"-Reihe und die Weiten des Weltraums hinter sich gelassen und führt uns in eine zeitlich nicht bestimmte, aber vermutlich nähere Zukunft. Die "menschliche Mischung" dieser Welt setzt sich aus den herkömmlichen Naturals und einer wachsenden Zahl von Melds zusammen, die sich in irgendeiner Weise körperlich aufmotzen haben lassen. Zugleich steht Meld für die Veränderung selbst: Kein einheitliches Verfahren, sondern ein buntes Sammelsurium aus elektronischen oder auch nur mechanischen Implantaten, Genmanipulationen, Chimärenbildung - oder auch einfach nur kosmetischen Operationen der auffälligen Art.
Die Hauptfiguren
Der junge Archibald Kowalski alias Whispr hat sich für einen ultradünnen Körper entschieden, viel dünner als der Suppen-Kaspar am Ende seines Lebens. Auf die Art kann man gut entwischen - praktisch für jemanden, der sich im tropischen Savannah des klimagewandelten US-Südens als Krimineller durchschlägt. Bei seinem jüngsten Raubzug fällt Whispr allerdings ein Beutestück in die Hände, das ihm bald sämtliche Fluchttechniken abverlangen wird, die er draufhat. Denn nicht nur Whispr interessiert sich brennend dafür, was auf dem silbrigen Faden für Daten gespeichert sein mögen. Von jetzt an wird Whispr gnadenlos verfolgt.
Derweil treffen wir mit der Ärztin Ingrid Seastrom auf eine echte Idealistin; unter anderem praktiziert sie die vergessene Kunst des Hausbesuchs. Bei einer Patientin stößt sie auf ein Nano-Implantat aus demselben Material wie Whisprs Faden: Metallischer Wasserstoff, eine physikalische Unmöglichkeit unter den Umweltbedingungen der Erde. Ingrid ist angefixt - als es Whispr samt Faden in ihre Praxis verschlägt, schließt sie sich ihm an, um das Geheimnis zu ergründen.
Und dann wäre da noch der südamerikanische Auftragskiller Napun Molé, der sich als gruselige Variante von Inspector Gadget entpuppt: Was der alles am Körper trägt und aus seinen Fingerspitzen schießt, alle Achtung! Er wird auf den Faden-Diebstahl angesetzt. Ominös dabei die Wortwahl seiner Auftraggeber: Die Wiederbeschaffung sei von "apokalyptischer Bedeutung" ...
Typischer Foster-Stil
Niemand würde sich vom alten Haudegen Foster erwarten, dass er sich groß Gedanken um die wechselseitige Beeinflussung von Psyche und veränderter Physis gemacht hätte (wie dies z.B. in Chaz Brenchleys "Rotten Row" und dessen vergleichbarer "Human Blend" geschieht). Foster liefert seit Jahrzehnten einfach bunte Abenteuer ab. "Genom" ist da keine Ausnahme und im Vergleich zu manchen "Homanx"-Romanen der jüngeren Zeit auch nicht das schlechteste Werk.
Es wird auf Krokodilen geritten, durch die Ruinen versunkener Städte gestreift, Schnitzeljagd-mäßig von einem exzentrischen Daten-Genie der Unterwelt zum nächsten gepilgert, gescherzt und Blut vergossen. Und wie gehabt lebt Foster sein Faible für Biologie voll aus: Neozoen und Neophyten spielen in der Beschreibung des Settings eine viel prominentere Rolle, als dies bei anderen AutorInnen der Fall wäre. Nebenbei bemerkt frage ich mich, ob ich irgendwann noch einmal eine deutsche Übersetzung erleben werde, in der ein "Katzenfisch" endlich wieder ein Wels sein darf.
Unterhaltung mit einem Manko
Das eine große Problem des Romans sind die Hauptfiguren. Ist es glaubwürdig, dass Ingrid ihr behütetes Dasein aus reinem Forscherdrang für ein Leben auf der Flucht opfert? Oder dass der egoistische Straßengangster Whispr zwischendurch modernisierungsskeptisch zu philosophieren beginnt ("Es gab kein Meld für Persönlichkeit, keins für Sinn für Humor, keins für Witz oder Mitgefühl")? Da passt nicht alles zusammen.
Am wichtigsten ist aber die inkonsistente Art, in der Foster mit Whispr umgeht. Man sollte nie aus den Augen verlieren, dass wir ihn zu Romanbeginn als die widerlichste Art von Verbrecher kennenlernen, die sich denken lässt: Als Raubmörder, dessen Opfer ausgeweidet wird. Das kann eine gute Hauptfigur abgeben, die dürfte in der Folge aber nicht wie ein sympathisches Schlitzohr rüberkommen. Insbesondere im Zusammenspiel mit Ingrid müsste es zumindest hin und wieder beklemmende Momente geben, in denen Whisprs wahres Wesen aufblitzt. Stattdessen serviert uns Foster einmal mehr den Antihelden-Typ à la Flinx oder Jon Meriweather, den er offenbar am liebsten hat.
Gesamtbewertung: Wie so oft ein unterhaltsames Abenteuer ohne großen Anspruch und mit ein paar Schönheitsfehlern. Sein Name verkauft sich immer noch, aber wenn Foster in der SF von heute bestehen will, muss er sich beizeiten mal auf den Hosenboden setzen und ein bisschen mehr Mühe geben.

Paul di Filippo: "Ribofunk"
Gebundene Ausgabe, 295 Seiten, Four Walls Eight Windows 1996
Fosters "Genom" ließe sich unter "Biopunk" einordnen, auch wenn es kein übermäßig beeindruckender Vertreter dieser Gattung ist. Nehmen wir also mal wieder einen Klassiker der jüngeren Vergangenheit zur Hand. Geschrieben von einem, der für den deutschsprachigen Markt bislang anscheinend weitestgehend uninteressant war: Paul di Filippo. Ein US-amerikanischer Autor, der mit Cyberpunk sozialisiert wurde, dann aber seine eigenen Wege ging. Und die sind verschlungen, warten mit herrlich bizarren Ideen auf (siehe "A Princess of the Linear Jungle"), strotzen vor popkulturellen Verweisen und spielen mit der Sprache, dass es eine Freude ist.
Gezähmte Welt
Die 13 in "Ribofunk" versammelten Geschichten wurden Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre geschrieben und haben alle dieselbe Welt des 21. Jahrhunderts als Hintergrund: Nordamerika ist unter kanadischer Führung zu einer Union zusammengefasst, im Nahen Osten hat der Zweite Dschihad gewütet, Klimawandel und Umweltzerstörung haben sich verheerend ausgewirkt - doch mit den teils aberwitzigen Möglichkeiten der Biotechnologie ist die Erde wiederbegrünt und gezähmt worden. Wobei man durchaus radikal vorgegangen ist. In der Erzählung "The Lazy River" beispielsweise treffen wir auf einen semi-intelligenten Fluss, der nur zur Hälfte aus Wasser besteht. Den Rest machen silicrobes genannte Nano-Maschinchen aus, die sich an die Wassermoleküle hängen und deren Fließgeschwindigkeit erhöhen. So ist der Fluss nämlich besser nutzbar.
Was die omnipräsenten silicrobes draußen erledigen, tun tropes und strobes genannte bioaktive Substanzen im menschlichen Körper; der hält inzwischen keinerlei Geheimnisse mehr bereit, auch die Funktionsweise des Gehirns ist vollständig entschlüsselt und beeinflussbar. (Wie das Anti-Riot-Gas "Incontibarf" wirkt, mag ich mir gar nicht erst ausmalen ...) Spontan fallen einem da gleich drei bedeutende Autoren aus jüngerer Zeit ein, in deren Werk sich Vergleichbares findet: Paolo Bacigalupi mit seiner Welt voller patentierter Lebensformen ("The Windup Girl"), David Marusek mit seiner alle Lebensbereiche durchdringenden Nanosphäre ("Counting Heads") und Peter Watts' eiskalter Blick auf die menschliche Psyche als Wechselspiel chemischer Prozesse (die "Rifters"-Trilogie).
The Human Blend, die Zweite
Die Menschen sind ein nicht weniger bunter Haufen als die in Fosters "Genom". Aus Spaß an der Freud oder auch mal aus ideologischen Gründen modifiziert man seinen Körper nach Belieben. Di Filippos Einfallsreichtum diesbezüglich ist groß: Frazettatoids pumpen ihre sekundären Geschlechtsmerkmale auf Proportionen, wie sie der legendäre Fantasy-Illustrator Frank Frazetta seinen HeldInnen verpasst hatte, auf, während Incubators in ihrem Körper den Keimen ausgerotteter Krankheiten Asyl geben. Aus ethischen Gründen. Und in "Big Eater" lernen wir eine zeitgemäße Variante des alten Familienstreit-Themas Tattoos & Piercings kennen. In dem Fall ist die Tochter des Hauses schon mit den Zusatzbeinen und Fühlern einer Kakerlake ausgestattet und hätte jetzt bitteschön auch gerne noch einen Panzer.
Intelligente Kleidung, lebende Möbel und diverse Biomechanoide bis hin zu Funktionstieren erleichtern den Alltag (wenn ein Papagei Newsfeeds verliest und Telefongespräche entgegennimmt, muss man auch schon mal an die Familie Feuerstein denken ...). Eine besondere Rolle spielen dabei splices: Genetische Chimären, für die menschliches Erbgut mit dem von allen möglichen Tierarten kombiniert wurde. Ab 51 Prozent menschlichem Anteil genießt man vollständige Bürgerrechte - darunter ist man kaum mehr als ein Gegenstand, unabhängig von Intelligenz und Empfindungsvermögen. Der richtige Nährboden für die Aktivitäten einer Krazy Kat genannten Chimäre, die in einigen der Geschichten als Sklavenbefreier und Terrorist auftritt.
Die Stories
Ich würde empfehlen, "Ribofunk" mit den drei Geschichten "The Boot", "Blankie", und "The Bad Splice" zu beginnen, die alle den gleichen namenlosen Ermittler als Hauptfigur haben. Weniger aus inhaltlichen Gründen - unter anderem trifft er auf Krazy Kat und klärt den besonders abscheulichen Fall eines Babys, das von seiner intelligenten Windel zerquetscht wurde, auf - als aus sprachlichen. Hier ist di Filippo nämlich vergleichsweise gemäßigt unterwegs, während er sonst zu Experimenten neigt.
Der Titel der Sammlung endet nicht umsonst auf "-funk", sprachlich ist da ordentlich Musik drin. Was den besonderen Reiz ausmacht, aber auch das Lesen zur Herausforderung werden lässt - insbesondere für diejenigen, die nicht Englisch als Muttersprache haben. "Television City", "Afterschool Special" und "Cockfight" schwelgen in einer Mischung aus Street Slang, Jugendsprech, multikulturellem Pidgin-Englisch, Reimen und lawinenartig über den Leser hereinbrechenden Neologismen. "Big Eater" geht noch einen Schritt weiter: Protagonist Cordy, der Bruder des Kakerlaken-Mädchens, wurde in seiner Kindheit von einem Wetware-Virus infiziert und bricht seitdem fortwährend in Tourette-artiges Rappen aus. Das kann auf die Dauer schon an den Nerven zerren.
Stilistische Experimente anderer Art finden wir in "Little Worker", das aus der Sicht eines splices geschrieben ist und dessen schlichtes Gemüt in angemessen kurzen Sätzen zum Ausdruck bringt, oder in "Brain Wars". Letzteres setzt sich aus den Botschaften, die ein Söldner von irgendeinem Kriegsschauplatz nach Hause schickt, zusammen. Und die werden immer seltsamer, nachdem er mit einer Substanz infiziert wurde, die Auswirkungen auf sein Gehirn hat. Böse. "McGregor" schließlich ist die Übertragung des Spartacus-Motivs auf die Märchenwelt Beatrix Potters, die von splices in einem Themenpark nachgestellt wird. In der Rolle des Sklavenbefreiers: ein kettenrauchender Peter the Rabbit.
Die Attacke des Urblastemas
Auch wenn Biopunk irgendwie nie den Sprung vom Topos zum eigenen Subgenre geschafft hat - Paul di Filippo hat zumindest versucht, das Ganze in seiner verspielten Abart des "Ribofunk" als Gegenmodell zu früherer Science Fiction zu etablieren. Siehe eine augenzwinkernde Passage in "Afterschool Special", in der sich zwei Teenager von einem lebenden Gleitband befördern lassen, das den ganzen Kontinent überspannt und seine Benutzer wie eine Speiseröhre weiterschiebt. "Did you ever download any reductionist paradigm fiction where the author tried to imagine a system like this and came up with miles of rubber belts on rollers?" I laughed like a hyena splice. "That's not true. You're yanking my rods."
Auf knapp 300 Seiten entwirft di Filippo eine atemberaubende Welt, die einem streckenweise den Verstand stillstehen lässt. Und den logischen Schlusspunkt der biotechnologischen Entwicklungsspirale liefert er mit der letzten Erzählung, "Distributed Mind", auch noch. Böse Pointe. Neben allen anderen Qualitäten hat der Mann eben auch einen ausgesprochen fiesen Sinn für Humor.

Sam Leith: "Die Zufallsmaschine"
Gebundene Ausgabe, 350 Seiten, € 17,50, Manhattan 2013 (Original: "The Coincidence Engine", 2011)
"Unsere Aufgabe besteht darin, Bedrohungen der nationalen Sicherheit ausfindig zu machen; mögliche Gefahren, von denen wir nicht wissen, ob sie existieren. Dabei bedienen wir uns gewisser Methoden, von denen wir nicht wissen, ob sie funktionieren. Was zu Resultaten führt, die wir gemeinhin nicht als solche erkennen, und wenn doch, dann wissen wir in aller Regel nicht, wie sie zu interpretieren sind." So erklärt der Leiter des Direktorats für das Extrem Unwahrscheinliche (DEI) einem Gast die Aufgabe seiner Behörde. Kein Wunder, dass sich da mancher Rezensent gleich wieder an Douglas Adams erinnert fühlte - ein Eindruck, dem Sam Leiths "Die Zufallsmaschine" in seiner Gesamtheit aber nicht entspricht.
Der Zufall spielt jedenfalls eine große Rolle. Wir treffen auf einen Haufen Leute, die seltsamen Tätigkeiten nachgehen und noch seltsamere Dinge erleben - bis hin zum wirklich extrem unwahrscheinlichen Ereignis zu Beginn des Romans: Ein Wirbelsturm setzt aus dem Schrott einer Müllhalde ein vollständiges Verkehrsflugzeug zusammen ... und einen wehrlosen Passanten samt Pilotenuniform aus der Altkleidersammlung im Cockpit ab. Da können die Methoden, mit denen Verzerrungen der Wahrscheinlichkeit gemessen werden, auch nicht mehr verwundern; z.B. stundenlang den iPod auf Shuffle stellen und sehen, ob sich ein Muster ergibt. Falls sich nicht eh alles in Wirklichkeit nur im Kopf abspielt. Denn wie obiger Gast dem DEI-Leiter erklärt: "Ein Zufall ist nicht etwa ein seltsames Ereignis, sondern ein Ereignis, das Sie seltsam finden."
Das Arschloch des Universums
Auch der Aufbau des Romans wirkt zunächst zufällig. So hat die am Buchrücken angekündigte Hauptfigur ihren ersten Auftritt erst nach 50 Seiten. Zu diesem Zeitpunkt wird der britische Mathematikstudent Alex Smart längst verfolgt, sowohl vom DEI als auch vom dubiosen Unternehmen MIC Industrial Futures. Alex soll nämlich - ohne dass er oder wir LeserInnen wüssten, warum - im Besitz einer Maschine sein, die die Wahrscheinlichkeit beeinflusst; gebaut angeblich vom verrückt gewordenen Mathematik-Genie Nicolas Banacharski. So mächtig soll die Maschine sein, dass sie unser gesamtes Universum durch sein eigenes Arschloch ziehen und auf links drehen würde. Schöner Satz.
Alex hat von all dem freilich keinen Tau. Überhaupt bewegt er sich so zielgerichtet durchs Leben, als wäre Valium sein Hauptnahrungsmittel. Eigentlich ist er nur in die USA gekommen, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen - dass er längst in eine transkontinentale Verfolgungsjagd hineingezogen worden ist, fällt ihm die längste Zeit nicht einmal auf.
Von allem ein bisschen
Und schon haben wir das entscheidende Stichwort: Zeit. In Flashbacks sowohl zu Alex' Vorgeschichte als auch zu der der hinter ihm herjagenden Agenten-Teams setzt sich für den Leser allmählich das Bild zusammen. Dass Leith diese Art von Aufbau gewählt hat, ist nun wieder kein Zufall. In einer der Rückblenden schwadroniert der irre Banacharski ja darüber, dass man inmitten der sich beständig auffächernden Alternativ-Pfade des Multiversums am besten die Richtung zurück nimmt; da gibt es immer nur einen Weg.
... zumindest nehme ich an, dass das Leiths Gedanke beim Konstruieren des Romans war. Sam Leith ist ein britischer Journalist und Autor von Sachbüchern (unter anderem über politische Rhetorik oder das Wesen von Pech). "Die Zufallsmaschine" ist sein erster Roman, und das merkt man auch. Vieles wird ausprobiert, nicht alles davon geht auf, nicht alles passt zusammen. Leith jongliert mit Ideen aus dem Grenzland von Philosophie, Physik und Mathematik (von der er, wie er freimütig einräumt, nichts versteht), kombiniert sie mit einer typischen Mystery-Handlung und versieht das Ganze mit einer Dosis Humor.
Was hatte Leith vor?
An Douglas Adams erinnern dabei nur die beiläufig aufgezählten absurden Zufälle, die sich im Kielwasser von Alex' Reise häufen und nicht weiter von Bedeutung sind. Viel witziger ist es, wenn Leith den ganzen Zufallskram mal beiseite lässt und sich zum Beispiel dem britisch-amerikanischen Culture Clash widmet. Siehe eine gelungene Passage, in der der hungrige Alex weit und breit nur ein Drive-in findet und sich als Fußgänger in die Auto-Warteschlange einreiht. Und wer sich von der "Zufallsmaschine" eine reine Aneinanderreihung komischer Situationen erwartet, ist ohnehin schief gewickelt. In krassem Gegensatz zu den eingestreuten Pointen liest sich nämlich die Vorgeschichte der Alex verfolgenden Agentin Bree alles andere als lustig. Einmal mehr: Dem Roman fehlt ein gemeinsamer Nenner.
Es gibt so Bücher, die sich jeder Zuordnung entziehen, von allem ein bisschen bieten, schelmisch mit der Andeutung von Tiefgang kokettieren und dann durch irgendeinen Zufall zum Bestseller werden. Irgendwie weckt "Die Zufallsmaschine" in mir den Verdacht, mit genau dieser Absicht geschrieben worden zu sein. Ich glaube aber nicht, dass der Zufall diesmal eintritt.
Und so geht es weiter
Eher sechs als fünf Wochen wird es bis zur nächsten Rundschau dauern, bis dahin sind nämlich ein paar dicke Brocken zu verdauen: Unter anderem Hannu Rajaniemis "Fraktal" (vermutlich schwierig), die endlich erschienene Biografie von James Tiptree Jr (feeeeett) und das Buch mit dem längsten Titel des Jahres. Dazu dann ein paar kleinere Happen je nach Tageskarte. (Josefson, derStandard.at, 6. 4. 2013)