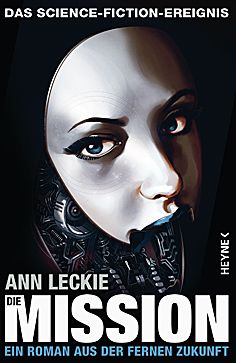
Ann Leckie: "Die Mission"
Broschiert, 480 Seiten, € 11,99, Heyne 2016 (Original: "Ancillary Sword", 2014)
Auf geht’s in den zweiten Teil von Ann Leckies "Imperial Radch"-Weltraumsaga. Und hier schlägt das Imperium nicht etwa zurück. Hier trinkt das Imperium Tee. Ohne Unterlass und Pinkelpause. Ich habe noch nie einen SF-Roman gelesen, in dem derartig viel Tee getrunken wurde, er ist mir von der bloßen Lektüre schon zu den Ohren rausgekommen. Und vielleicht hat der ganze Tee ja seinen Teil dazu beigetragen, dass "Die Mission" eine eher … beruhigende Wirk … Wi … Wrkng ha … chrrrrrrrr …
Willkommen in der Radch
Erinnern wir uns zunächst daran, was den ersten Teil der Trilogie, "Die Maschinen", so großartig gemacht hat. Die recht spät zur Romanautorin und dann gleich zum Shooting-Star gewordene Ann Leckie aus Ohio griff darin das altbewährte Motiv vom interstellaren Imperium auf, das sich seine kosmische Nachbarschaft nach und nach einverleibt. Dieses expandierende Reich, die Radch, erinnert stark an das Alte Rom: Neueroberte Provinzen werden binnen kurzer Zeit kulturell angeglichen, es legt sich eine alle Unterschiede nivellierende Decke über die Galaxis.
Diejenige Nivellierung, die bei Band 1 das meiste Aufsehen hervorrief, ist die zwischen den Geschlechtern. Nicht dass das Volk der Radchaai nicht zwischen Männern und Frauen unterscheiden könnte. Es sah sich bloß nicht veranlasst, dies sprachlich auszudrücken, und verwendet daher das generische Femininum: also das Pronomen "sie" und die Endung "-in" für jede(n). Das hat zwar einige Gynophobiker in der Leserschaft auf die Palme gebracht, doch ging deren Aufregung am Wesen der Sache vorbei. Und umgekehrt hat sich noch nie jemand am sehr, sehr viel häufigeren Fall gestört, wenn in einem Roman ein Alien als "er" bezeichnet wurde, selbst wenn die betreffende Spezies 29 Geschlechter hatte. Oder gar keines.
Kollektiv denken
Und das ist ohnehin nur die Spitze des Eisbergs. In Band 2 zeichnet sich noch stärker ab, dass die Radchaai generell dazu neigen, zwischen Individuum und Überkategorie wenig Unterschied zu machen. So wird etwa eine Soldatin erwähnt, der es Unbehagen bereitet, mit ihrem Personennamen angesprochen zu werden – viel lieber lässt sie sich als Teil ihrer Einheit mit "Eins Kalr Fünf" anreden.
Hauptfigur Breq macht es besonders deutlich: Sie war mal die Künstliche Intelligenz eines Truppentransporters. Deren Körper war aber nicht nur das Schiff, sondern auch die Armee aus menschlichen Hilfseinheiten, die dieses transportierte, jedes einzelne dieser "Individuen" sowie jede beliebige Teilmenge daraus. Egal, auf wie vielen Füßen sie stand, stets verstand sie sich als ein- und dieselbe Person. Und das tut sie auch jetzt noch, da sie nur mehr einen einzelnen menschlichen Körper bewohnt.
Der Pudelin Kern
Auch die Herrscherin der Radch ist ein kollektives Wesen. Seit über 3.000 Jahren hält Anaander Mianaai ihr Riesenreich zusammen, indem sie ihre Persönlichkeit über eine Vielzahl an geklonten Körpern, die durch Gehirnimplantate verbunden sind, über die halbe Galaxis streut. Allerdings ist mittlerweile ein Riss durch diesen Verbund gegangen – nun bekriegen sich zwei Anaanders.
Das würde schon in einem "normalen" Imperium zu heftigen Loyalitätskonflikten führen. Die Radchaai sind aber nicht nur in einem engen Korsett von Hierarchien, Ritualen und einer äußerst mühsamen Etikette gefangen, das in seiner geballten Förmlichkeit und dem Zwang zu unbedingtem Gehorsam Erinnerungen an unter anderem David Feintuchs "Nick Seafort"-Saga oder Walter Jon Williams' "Der Fall des Imperiums" weckt. Es zeichnet sich auch ab, dass das fehlende Differenzierungsvermögen im Denken und Sprechen es den Radchaai fast unmöglich macht, den Bruder-/Schwesterkrieg der Anaanders überhaupt geistig adäquat zu erfassen. Siehe etwa dieses Gespräch:
"Der Konflikt in Omaugh scheint beigelegt zu sein." [...] "Zu wessen Gunsten?" "Zu Anaander Mianaais natürlich. Was sonst? Wir alle befinden uns in einer unmöglichen Situation. Irgendeine Fraktion zu unterstützen wäre Verrat". "Genauso wie", stimmte die Gouverneurin zu, "keine bestimmte Fraktion zu unterstützen." Ebenso bezeichnend wird es später heißen, dass es eine übliche Strategie sei, die Balance zu wahren, indem man ignoriert, was man nicht sehen will. Ja, die Radchaai haben viele blinde Flecken – und das scheint ihnen nun auf den Kopf zu fallen.
Zur ... Handlung
Soweit Theorie und Hintergrund. In "Die Mission" wird nun Breq damit beauftragt, sich als Kapitänin einer kleinen Flotte ins Athoek-System aufzumachen, wo sich ein neuer Konfliktherd im reichsweiten Bürgerkrieg herauszubilden droht (und Tee angebaut wird). Begleitet wird sie von zwei Leutnantinnen: dem schon aus dem ersten Band bekannten Seivarden (ein Mann, wie wir inzwischen wissen, während wir bei allen anderen Figuren nur rätseln können) und der neu hinzugekommenen Tisarwat, die nicht ganz das ist, als das sie sich ausgibt. Was allerdings auch für Breq selbst gilt – schließlich soll niemand wissen, dass sie kein Mensch im engeren Sinne ist.
Und das war's dann im Grunde auch schon. Bis nach drei Vierteln des Romans eine Bombe hochgeht, passiert im Grunde ÜBERHAUPT NICHTS, außer dass sich Breq in die Verhältnisse vor Ort einfindet. Soll heißen, dass sie ein Geflecht aus ein bisschen Nepotismus, ein bisschen sozialen Missständen, ein bisschen Diskriminierung ethnischer Minderheiten und ein bisschen persönlichem Fehlverhalten aufdröselt. Was sie bevorzugt bei Tee und Gebäck erledigt. Und ich muss ehrlich gestehen, dass mir über all den Tischgesprächen von Flottenkapitänin Breq mit Distriktsmagistratin X, Gartenverwalterin Y und Bürgerin A bis Z allmählich die Augen glasig geworden sind.
Some action, please
Merke: Selbst ein so faszinierender Hintergrund, wie ihn Leckie für ihre Reihe geschaffen hat, fährt auf Dauer nicht alleine die Miete ein – und mit "Die Mission" ist er restlos ausgereizt. Wer jemals ein Beispiel für das "Middle Book Syndrome" gesucht hat: hier ist es. (Zur Erklärung, falls jemand den Ausdruck noch nie gehört hat: Unter diesem Effekt leiden viele Mittelteile von Trilogien. Sie haben nicht mehr den Neuigkeitswert des ersten Bands, müssen die Handlung irgendwie fortführen ... aber nicht zu weit, weil der spektakuläre Höhepunkt ja dem dritten Band vorbehalten bleiben muss.)
Schon möglich, dass hier gut versteckt zwischen den Teebeuteln die Samen einiger Entwicklungen liegen, die noch wichtig werden. Möglich aber auch, dass man am Ende der Trilogie konstatieren wird, dass man "Die Mission" einfach überspringen hätte können. Band 3 jedenfalls, "Ancillary Mercy", soll nach allem, was man so hört, wieder um einiges spannender sein. Abwarten und Kaffee trinken.

Elias Hirschl: "Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt"
Broschiert, 196 Seiten, € 17,90, Milena 2016
Warum kommen die Bücher, denen man im Dezember den Preis für den besten Titel des Jahres überreichen wird, eigentlich immer schon in den ersten Monaten auf den Markt? Etwa um potenzielle Konkurrenten schon vorab völlig zu demoralisieren? Jänner 2010: "Die Go-Go-Girls der Apokalypse". Februar 2014: "Gay Nazi Dolphins at a Gang Bang", unmittelbar gefolgt von "Der Bergfrauendoktor: Ein Leben voller Abstriche". Und jetzt das. Das.
In drei Stationen zur Zeitreise
Die Zeitreise-Satire MFHAHGUAWSMMHIDLT ist der zweite Roman des jungen Wiener Autors Elias Hirschl, der auch als Poetry-Slammer unterwegs ist. Und tatsächlich kann man sich den Text hervorragend im Rhythmus eines Vortrags vorstellen. Gleich von Beginn weg, wenn der bärbeißige Philosophie-Professor Johannes Getting ("ein durchschnittlicher österreichischer Passiv-Nazi") einen Beschwerdebrief abfeuert, in dem er sich über die physikalischen Unmöglichkeiten eines Hollywood-Films auslässt: "[...] was ein weiteres bedeutendes Indiz für die Angemessenheit meiner Aufforderung ist, dass Universal sich ficken gehen soll." Noch ungeahnt, wird hier der Grundstein für den theoretischen Unterbau des Zeitreisens gelegt.
Es folgt ein mathematischer Wettkampf – gesponsert von Red Bull – mit atemlosem Sportkommentar, wie ihn selbst Edi Finger nicht zustande gebracht hätte ("Ich will in diesem Moment einfach nur von diesem Mann befruchtet werden und niemals mit dem Gebären aufhören!"). Das Ergebnis: die Weltformel wird gefunden, Schritt 2. Als dann noch ein Computerhirn auf den Plan tritt, das diese Formel anzuwenden versteht, sind alle Vorarbeiten geleistet und die Zeitreisetechnologie steht zur Verfügung.
Bemerkung am Rande: Hirschls "Erklärung" zur Funktionsweise ist ebenso einleuchtend/hanebüchen wie alle ihre genrehistorischen Vorläufer, aber dafür einen Tick origineller: Sie basiert auf einem zyklischen Zeitmodell, weil das Universum stets in einem Big Crunch zusammenstürze und danach im nächsten Big Bang wieder genauso entstehe wie in der vorangegangenen Version. Um in die Vergangenheit zu gelangen, reist man also in Wahrheit in jene ferne Zukunft, die wieder dem Stand von gestern entspricht.
Halali!
Da MFHAHGUAWSMMHIDLT unter anderem als Brainstorming zu Paradoxa und anderen Aspekten des Zeitreisens fungiert, darf natürlich weder Klischee Nr. 1 (den eigenen Großvater töten) noch Nr. 2 (Hitler töten) fehlen. Letzteres hat dem Buch nicht nur seinen Titel beschert, sondern wird tatsächlich zum Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Und was sich Hirschl dazu alles einfallen lässt, ist sagenhaft. Attentate auf den GRÖFAZ werden binnen kurzem zum Modesport, inklusive Souvenir-Industrie, Gruppentarifen und Hashtags für jede Gelegenheit: Leute posteten Selfies mit einem toten Hitler – #TimeTravel, #SavingAnneFrank. [...] Das Verb "hitlern" (englisch: hitlering) wurde offiziell als "Die Tätigkeit, Adolf Hitler aus Spaß zu ermorden" in den Duden aufgenommen. Dann gab es wiederum welche, die fanden, dass Politiker-Töten generell out sei und stattdessen Hitlers Mutter als Kind töten. #MILH.
Oder nehmen wir diese kabarettreife TV-Diskussion, in der eine Grüne gegenüber einem FPÖ-Politiker die "Minority Report"-mäßige Hitler-Jagd beklagt: "Auch Adolf Hitler war einmal ein kleines, süßes, unschuldiges Baby, ganz genau wie ich oder Sie auch!" – "Ich möchte bitte festhalten, dass mich Frau Garner gerade mit Hitler verglichen hat und sich selbst ebenfalls mit Hitler identifiziert."
Der "Spaß" könnte ewig so weiter gehen, wären da nicht noch zwei weitere Faktoren im Spiel – und man weiß nicht, welchen davon man gruseliger finden soll: Die Cthulhu-artige Schwarze Mathematik, die aus der Entdeckung der Weltformel entsprungen ist und ein Eigenleben entwickelt, oder eine "ironistische" Terroristenbewegung, deren nicht ernst gemeinte, aber nichtsdestotrotz massenmörderische Anschläge völlig unvorhersagbar sind.
Ironie bis zum Abwinken
Ironie ist natürlich auch das Stichwort für Hirschls ganzen Roman. Mit der postmodernen Lust an der Auflösung legt Hirschl die Handlung als Mosaik aus Tagebucheinträgen, einem Prüfungsbogen, Polizeiprotokollen (wenn auch nicht am Stil als solche erkennbar), historischen Exkursen und vielen weiteren Elementen an – nicht zuletzt ergänzt um pratchetteske Fußnoten, in denen sogar mal ein Buch zitiert werden kann, das es tatsächlich gibt. Trotz dieser formalen Auflösung – und des Themas Zeitreise! – schreitet die eigentliche Handlung aber erstaunlich linear voran.
Sehr österreichisch übrigens, das Ganze: Von der Hypo-Alpe-Adria über die FPÖ und das Gwirks mit der Vergangenheitsbewältigung bis hin zum Bedürfnis zu sudern werden hier so manche Themen gestreift, die deutschen LeserInnen ein wenig fremd vorkommen mögen. Zudem schmort Hirschl noch ein bissel gar viel im Saft des Systems Universität – seine Seitenhiebe auf das Fach Psychologie und dessen ständiges Bemühen, als Wissenschaft genauso ernst genommen zu werden wie Physik oder Biologie, sind allerdings treffsicher platziert.
Die alte Genre-Frage
Als hätten Pop- und Bizarro-Literatur ein Kind gezeugt, ist MFHAHGUAWSMMHIDLT ein einziges Tohuwabohu – in Sachen Gag-Quote jedoch komplementär zur gleichnamigen berühmt-berüchtigten ORF-Sendung: Blindgänger und bemühte Pointen gibt's auch hier, sehr viel mehr Gags zünden aber in der Tat. Und es steckt auch ein unverkennbarer Schuss Douglas Adams (oder Mikael Niemis "Das Loch in der Schwarte") drin, was heißen soll: Hirschl schreckt keineswegs vor Pointen zurück, durch die sich seine Geschichte selbst ad absurdum führt und sich allmählich selbst auflöst.
Hirschl ist kein SF-Autor, er bedient sich lediglich des Zeitreisethemas als geeignetem Mittel, seine Erzählstrategie des Ironisierens und Auflösens zu verfolgen. Witzigerweise trifft er sich dabei aber mit jemandem, der aus der anderen Richtung kommt: In "Zeitmaschinen gehen anders" beschäftigte sich SF-Autor David Gerrold mit den psychedelischen Folgen konsequent weitergedachter Zeitreisetätigkeit, ganz aus einem Genre-Kontext kommend und doch zu erstaunlich gleichen Ergebnissen gelangend – bis hin zur Möglichkeit, mit sich selbst Gruppensex zu haben. Noch so ein Paradoxon.
Ich empfehle ausdrücklich, MFHAHGUAWSMMHIDLT nicht am Stück zu lesen, weil einem der ganze supersmarte Gag-Overkill sonst einfach zu viel wird. Wohlportioniert (dann hat man auch länger was davon) ist es aber ein großer Spaß, sowohl für Genre- als auch Nicht-GenreleserInnen. Und ein Werk, das beim Live-Vortrag sogar noch größeres Vergnügen bereiten dürfte (die eher beschauliche Welt von SF-Lesungen könnte Hirschl ganz schön aufmischen ...). Und nicht zuletzt ist es auch eines, nach dem man das Wort "Ironie" sehr lange nicht mehr hören möchte.
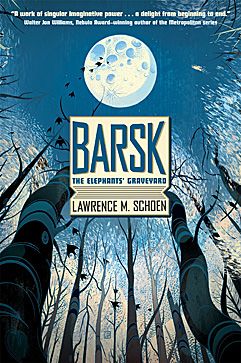
Lawrence M. Schoen: "Barsk. The Elephants' Graveyard"
Gebundene Ausgabe, 384 Seiten, Tor Books 2015/16
Furries werden diesen Roman lieben! Steckt er doch voller anthropomorpher Tiere, genauer gesagt Säugetiere von der guten alten Erde (an die sich hier allerdings niemand mehr erinnern kann): Otter, Katzen, Bären, Yaks, Präriehunde, Ameisenbären, Faultiere, Elefanten und viele mehr. Diese Bezeichnungen werden hier synonym mit abgekürzten Versionen der lateinischen Namen verwendet. Zoologisch Versierte werden gleich erraten können, was ein Myrm, Lutr, Vulp oder Ailuros ist, aber keine Angst: Für alle anderen gibt es am Ende des Buchs einen Appendix mit Auflistung und Identifizierung aller vorkommenden Völker.
Die (Ex-)Tiere haben sich seit unserem Zeitalter nicht nur soweit verändert, dass sie nicht allzu sehr um ein körperliches Mittelmaß streuen, auf zwei Beinen laufen, sprechen und abstrakt denken können. Sie haben auch eine tausende Planeten umfassende Allianz aufgebaut. Es ist, als hätten die Hunde aus Clifford D. Simaks "Als es noch Menschen gab" oder David Brins upgeliftete Tiere die Galaxis besiedelt. Oder mehr noch: Als würden Cordwainer Smiths Underpeople nun ohne Menschen weiterleben. Denn von unserer Spezies gibt es hier weit und breit keine Spur.
Meet the Fant
All diese Spezies leben so bunt gemischt und einträchtig nebeneinander wie – letzter Vergleich – in Alan Dean Fosters "Bannsänger"-Zyklus. Nur die auf den Planeten Barsk abgeschobenen Fant (also die Elefanten) werden allseits verachtet, obwohl ihre Gesellschaft geradezu ein Musterbeispiel an Friedfertigkeit und Harmonie ist. Die Fant leben in Einklang mit der Natur (den Geruch von "Plastik", also allem Künstlichen, verabscheuen sie), was im Konkreten heißt: auf einem Archipel von kleinen bewaldeten Inseln, den einzigen besiedelbaren Landmassen ihres regnerischen Planeten.
Und sie haben sich so einiges von ihrem elefantösen Erbe bewahrt: Zum Beispiel eine Untergliederung in die beiden gleichberechtigten Subspezies der Lox(odonta africana) und Eleph(as maximus). Oder dass ihre Gesellschaft auf Gemeinschaften von Müttern, Tanten und Kindern beruht, während sich die Männer einzeln oder in Junggesellengruppen etwas abseits halten. Und nicht zuletzt den hier zum Fakt gewordenen Mythos, dass jeder seinen Tod vorausahnt und sich beizeiten auf den Weg zum "Elefantenfriedhof" macht; in diesem Fall eine auf keiner Karte verzeichnete Insel.
Koph statt Spice
So sehr die Fant auch verachtet werden, liefert ihre Welt der Galaxis doch etwas Einzigartiges: Mit Hilfe der nur auf Barsk hergestellten Droge koph ist es ausgebildeten Speakers möglich, Tote heraufzubeschwören. Genauer gesagt können sie ein interaktionsfähiges virtuelles Abbild des Toten aus dessen sogenannten nefshons zusammenstellen: "subatomare Persönlichkeitspartikel", die sich im Lauf der Zeit überallhin verstreuen und die wohl irgendeine Quanteninformation enthalten. Das bringt jede Menge praktischen Nutzen mit sich (der Autor schildert diverse kreative Verwendungsmöglichkeiten), und weil man in der Allianz nicht länger von Barsk abhängig sein will, beschließt man, den ungeliebten Fant das Geheimnis mit Gewalt zu entreißen.
Einmal mehr haben wir es also mit dem bewährten SF-Motiv einer harmonischen Gesellschaft zu tun, welche über eine Ressource verfügt, die Begehrlichkeiten von außerhalb weckt. Dazu kommt ein guter Schuss "Dune": Barsk wird zum Schauplatz eines galaktopolitischen Machtspiels. Verschiedene Seiten können künftige Entwicklungen voraussehen, und alle betrachten Barsk als entscheidenden Nexus. Zudem sind Prophezeiungen hier kein ausschließlich übernatürliches Phänomen: Sie entpuppen sich auch als gezielt eingesetztes Instrument und können durch lange, subtile Planung selbsterfüllend werden. Apropos langer Geduldsfaden: Lawrence M. Schoen, ein Psychologe und Uni-Professor aus den USA, hatte die Grundidee zu "Barsk" laut eigener Aussage schon in den 80ern. Hat ja ziemlich lange gedauert, bis daraus ein Roman gewachsen ist – aber dafür ist es auch ein richtig guter geworden.
Die Hauptfiguren
Schoen hat die Handlung auf viele Schultern verteilt. Den wichtigsten Part übernimmt der junge Historiker und Speaker Jorl, der als erster Fant seit Jahrhunderten Barsk für einige Zeit verlassen und an der interstellaren Patrol teilgenommen hat. Und als wäre seine Vita nicht schon ungewöhnlich genug, scheint sich auch noch eine der jahrhundertealten Prophezeiungen der legendären Matriarchin auf ihn zu beziehen.
Ebenfalls im Spiel: Jorls Freund, der Bub Pizlo, der aufgrund der komplizierten Regeln der Fant-Gesellschaft als illegitimes Kind gilt und deshalb von jedem wie Luft behandelt wird. Das verwöhnte Party-Girl Lirlowil aus der Spezies der Otter, das wegen seiner telepathischen Fähigkeiten zwangsrekrutiert und nach Barsk geschickt wurde, um den Fant das Geheimnis des koph abzuluchsen. Sowie der greise Rüsul, der sich zu Beginn des Romans zum Elefantenfriedhof aufmachte, unterwegs jedoch von einem außerbarskischen Kommando entführt wurde – tragisch, so kurz vor der Erfüllung davon abgehalten zu werden, die letzte Ruhe zu finden.
Und dann ist da noch die vor Jahrhunderten verstorbene Matriarchin selbst, Margda: Ein hochpolitisches und höchst raffiniertes Wesen, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte. Einmal heraufbeschworen, beschränkt Margda sich nicht auf das übliche Talk-to-the-dead. Sie setzt sich in Lirlowils Kopf fest wie Zylonin Nummer Sechs und nimmt wieder die Fäden auf, die sie vor langer Zeit zu spinnen begonnen hatte. Lasst euch nicht von Rüssel und Flappohren ablenken – die Bene Gesserit würden Margda sofort mit Kusshand aufnehmen.
Und was ist jetzt eigentlich mit den Menschen?
Bleibt die Frage, die sich keine der Romanfiguren stellt, wir LeserInnen aber umso mehr: Was zum Teufel ist eigentlich mit den Menschen geschehen? Dass es darauf in "Barsk" noch eine Antwort geben wird, deutet ein früh im Roman geschilderter Flashback Jorls aus seiner Zeit bei der interstellaren Patrouille an. Damals stießen sie nämlich tief unter der Oberfläche eines Eismondes auf eine Anlage, die ihnen eine ominöse Botschaft schickte, mit der nur wir etwas anfangen können: "Gilgamesh. The Pendragon. Kal-El. I am these and more. I am the Archetype of Man, and from slumber such as you have never known have I awoken."
Damals zerstörten sie diese Anlage – aber wir dürfen getrost davon ausgehen, dass das später im Roman noch einmal aufgegriffen wird. Wie es Schoen dann aber einer schlussendlichen Lösung zuführt, ist bemerkenswert. Und das gilt auch für den ganzen Roman. Wer faszinierende Science Fantasy lesen möchte: Hier ist sie.
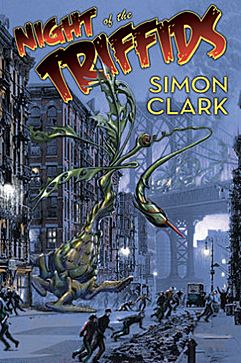
Simon Clark: "Night of the Triffids"
Gebundene Ausgabe, 406 Seiten, Cemetery Dance Publications 2015/16 (Erstveröffentlichung 2001)
Pflanzen brauchen Liiiiiebe! Und ... manchmal auch Menschenfleisch, das hat uns die Substral-Werbung leider verschwiegen. Ein paar Jahre vor dem Beginn der Rundschau schrieb der englische Autor Simon Clark eine Fortsetzung zu einem der Genre-Klassiker schlechthin, John Wyndhams "The Day of the Triffids" ("Die Triffids"). Dieses Sequel ist kürzlich beim Kleinverlag Cemetery Dance neu aufgelegt worden – Anlass genug für eine Besprechung. Und wem diese limitierte Ausgabe mit 30 Pfund zu teuer ist (signiert kostet sie noch mal erheblich mehr), keine Angst: Es schwirren noch genug ältere und billigere Versionen auf den diversen Kaufseiten herum.
Sollte es tatsächlich noch jemanden geben, der nicht weiß, was eine Triffid ist: Es handelt sich um eine übermannshohe, fleischfressende, mit einem Giftstachel bewehrte und bedauerlicherweise auch mobile Pflanze. Triffids wurden wegen ihres Öls künstlich gezüchtet – als eines Tages jedoch ein mysteriöses Himmelsphänomen den Großteil der Menschheit erblinden lässt, wird aus dem Segen ein Fluch. Langsam, aber unaufhaltsam schlurfen die Triffids los, fressen die wehrlosen Menschen auf und machen sich die Erde untertan.
Achtung, es ist wieder Saison!
John Wyndhams Originalroman aus dem Jahr 1951 endete im Ton grimmiger Entschlossenheit: Die ProtagonistInnen haben sich bis zur Isle of Wight durchgeschlagen, mit ca. 300 Überlebenden – viele davon blind – eine kleine Kolonie aufgebaut, den Triffids feierlich Rache geschworen und sich vorgenommen, das Festland eines Tages zurückzuerobern. Das haben sie 25 Jahre später, als das Sequel einsetzt, zwar immer noch nicht geschafft. Aber immerhin umfasst ihre Kolonie mittlerweile 26.000 Menschen und gedeiht prächtig.
"Night of the Triffids" beginnt mit einer Hommage ans Original: David Masen, Sohn der Hauptfigur aus Wyndhams Buch, erwacht ... und sieht nichts. Jedoch nicht, weil er erblindet ist, sondern weil sich eine mysteriöse Dunkelheit über die Welt gelegt hat – was die Triffids gleich zu neuer Aktivität anspornt. David ist Pilot, und als er mit seinem Flugzeug über die Wolkendecke vorstößt, um die Ursache zu ergründen, vergrößert sich das Rätsel noch. Allerdings wird Clark die Finsternis bald wieder stark abmildern. Eine ganze Romanhandlung in völliger Blindheit abzuspulen, das blieb dann doch Josh Malerman in "Birdbox" vorbehalten.
Neue Probleme
David legt eine Bruchlandung hin und findet sich auf einer schwimmenden Insel aus Pflanzenmaterial wieder. Wurde die etwa von Triffids angelegt, um an neue Nahrungsgründe heranzukommen? Es mehren sich die Anzeichen, dass die fiesen Pflanzen über ein gewisses Maß an Intelligenz verfügen, miteinander kommunizieren können und auch sonst einige neue Tricks auf Lager haben. Erst mal stößt David aber auf ein verwildertes Mädchen, das gegen Triffidgift immun ist, sowie auf ein Dampfschiff voller prächtiger WissenschafterInnen, die von New York aus um die Welt schippern, um zu sehen, wie's dem verbliebenen Rest der Menschheit so geht. Mit an Bord übrigens auch Davids künftiges Love Interest.
Der Großteil des Romans ist in den ehemaligen USA angesiedelt. Auf Manhattan hat sich eine gut geschützte Kolonie halten können, in der man in erstaunlichem Luxus lebt. Der hat allerdings seinen Preis, wie David bald merken wird. Schon in Wyndhams Roman waren neue Gesellschaftskonzepte, die den veränderten Lebensbedingungen besser entsprechen, ein großes Thema gewesen. Auf einem Planeten, der nur noch von geschätzt einer Million Menschen bewohnt wird, zählt vor allem rapide Vermehrung. Auf Davids heimatlicher Insel hat man sogenannte Mother Houses eingerichtet: autonome Gemeinschaften von (erblindeten) Frauen, die sich ausschließlich mit dem Gebären und Aufziehen von Kindern beschäftigen und sich dafür Männer zum Begatten aussuchen dürfen. Und in Manhattan hat man noch drastischere Maßnahmen ergriffen: "We bring techniques of mass production to the business of birth."
Kernpunkt des Romans ist Davids Weg zur Wahrheit über die diversen Gesellschaftsmodelle – kurz gesagt, wer hier die Guten und die Bösen sind. Bewaffnete Auseinandersetzungen werden nicht ausbleiben. In Zombie-Kategorien gesprochen (die Triffids gelten ja als historischer Vorläufer von Zombie-Szenarien), haben wir es dem Stadium der Post-Apokalypse zu tun, in dem man sich mehr mit Phänomenen wie dem Governor als mit den hirnlosen Menschenfressern selbst herumschlägt.
Plus und Minus
The instant I overflew the Isle of Wight coast a large gull exchanged its earthly existence for the chance of some avian paradise by the simple expedient of flying into my aircraft's one and only propeller. Clarks größte Leistung ist es, Wyndhams Sprache zu emulieren und einen britisch-wohlerzogenen Ton anzuschlagen, der sich wunderbar liest. Wir dürfen uns über jede Menge Wörter in der Preisklasse von lugubrious, tickety-boo oder crikey und Formulierungen wie "blow those murderous plants to merry hell" freuen. Während der Originalroman aber einfach nur die Sprache seiner Zeit hatte, wirkt Clarks gewollter Retro-Stil schon geradezu antiquiert. Und Clark hat nicht nur die Sprache auf alt getrimmt, er musste ja auch bei der Technologie auf einem niedrigeren Stand bleiben: Dampfschiffe hier, Propellerflugzeuge da. Spätestens wenn Panzer in den Kampf rollen, die wie Elefanten auf Walzen aussehen, wähnt man sich in einem Dieselpunk-Roman.
Auf der kleineren Minusseite steht, dass der Roman, der so ominös begann, etwas überhastet zu Ende gebracht wird. Und eigentlich eine ganze Reihe blinder Motive (pun not intended) hinterlässt, wenn man sich das Ganze nach der Lektüre noch einmal durch den Kopf gehen lässt. Macht ein wenig den Eindruck, als sollte hier der Grundstein für weitere Fortsetzungen gelegt werden, zu denen es dann allerdings nie kam.
Sag's durch die Blume
Nichtsdestotrotz gibt es zwei gute Argumente, sich "Night of the Triffids" doch zu genehmigen: Zum einen natürlich, dass es endlich ein Wiedersehen mit den scheußlich-schönen Triffids gibt, was für sich schon Grund genug ist. Oder vielleicht sollte man betonen: Wiederlesen, mit dem Sehen gibt's da ja so einige Probleme – alle drei bisherigen Verfilmungen waren eher Schrott (am besten ist immer noch die Serie von 1981). Vermutlich fällt es leichter, sich eine Pflanze gruselig vorzustellen, als dann tatsächlich zu sehen, wie sie um die Ecke gewatschelt kommt ...
Und zum anderen die Sprache des Romans, die ganz einfach Vergnügen bereitet. Nicht zuletzt die herrlich zivilisierte Britishness, die von der Hauptfigur auch auf Angehörige anderer Völker und Nationen übergesprungen zu sein scheint. Da sprach der alte Häuptling der Indianer: "Coffee would be lovely. I would, however, if it's at all possible, more than welcome a cup of tea."
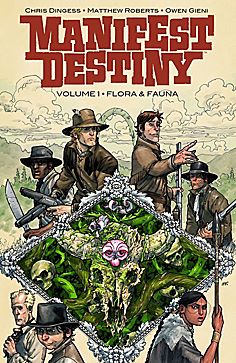
Chris Dingess, Matthew Roberts & Owen Gieni: "Manifest Destiny: Band 1. Flora & Fauna"
Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 128 Seiten, € 20,60, Cross Cult 2016 (Original: "Manifest Destiny Volume 1: Flora & Fauna", 2014)
1804 schickte US-Präsident Thomas Jefferson die legendäre Lewis-und-Clark-Expedition Richtung Westen, um die unbekannten Lande bis zur Pazifikküste zu erkunden: Geologie, Tier- und Pflanzenwelt sowie die indigene Bevölkerung. Was sie in der famosen Comicreihe "Manifest Destiny" von Autor Chris Dingess und Illustrator Matthew Roberts entdeckt, ist natürlich um einiges spektakulärer als das, was in unseren Geschichtsbüchern steht.
Es beginnt so idyllisch, wie es nur geht: Mit einem ganzseitigen Landschaftspanorama, über dem ein Reiher am Himmel schwebt ... welcher gleich darauf vom Himmel geballert wird, damit man ihn schön ordentlich skizzieren und sezieren kann. Innerhalb von nur fünf Panels bringen Dingess & Roberts damit nicht nur den damaligen wissenschaftlichen Zeitgeist auf den Punkt. So wird auch bereits das zentrale Motiv der gesamten Geschichte etabliert: die Diskrepanz zwischen Schein und Sein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Nicht von ungefähr trägt die Reihe diesen Titel: "Manifest Destiny" war im 19. Jahrhundert das Schlagwort für die US-Doktrin, man sei durch göttlichen Auftrag dazu berufen, den nordamerikanischen Kontinent in Besitz zu nehmen.
Zwei Seiten der Medaille
Das Comic steht im Zeichen einer durchgängigen Dichotomie: Hier der behutsame Wissenschafter Captain Meriwether Lewis, dessen berufsbedingte Skepsis durchaus auch mal zu Zweifeln an seiner Mission führt – dort der Haudrauf und herzlose Kommisskopp Captain William Clark. Hier freiwillige Expeditionsteilnehmer voller Pioniergeist – dort zwangsrekrutierte Sträflinge (unter ihnen einer, der eine Meuterei plant). Hier der offizielle Auftrag Jeffersons, das unbekannte Land zu erkunden – dort seine geheime Agenda, Monster aus dem Weg zu räumen, die die Expansion der jungen USA nach Westen gefährden könnten (und wir werden Monstern begegnen, keine Sorge ...).
Hier das offizielle Tagebuch der Expedition, das in die Geschichte einging – dort das geheime, das den "wahren" Verlauf der Geschehnisse schildert und bei Bedarf geschönt werden muss. Als zwei Expeditionsteilnehmer von einer hochansteckenden Infektion befallen werden, schreibt Lewis zunächst: "Captain Clark und ich selbst führten die Exekutionen selbst durch", streicht "Exekutionen" dann durch und ersetzt es durch "Quarantäne-Maßnahmen".
Gutes Team
Mit kantigen Corto-Maltese-Gesichtern lässt Matthew Roberts seine Figuren ungeahnten Gefahren ins Auge blicken: Seien es riesige Bison-Zentauren ("So einen Indianer habe ich noch nie gesehen.") oder halb pflanzliche Zombies mit grünem Blut. Beim Wechsel von Ruhephasen zu Actionsequenzen sind die Bilder gerne mal nicht mehr zentriert – dann, wenn die Attacke durch das jeweilige Monster du jour so rasend schnell kommt, dass die Kamera bzw. der Zeichner nur mehr einen Ausschnitt am Rand einfangen konnte. Und zwischendurch wechselt Colorist Owen Gieni auch mal zur Auflockerung das Technicolor-Farbschema und wir sehen nur noch Silhouetten. Einen guten Eindruck zur Optik von "Manifest Destiny" gibt dieser Trailer.
Autor Chris Dingess hat bislang unter anderem an einigen Fernsehserien mitgearbeitet – etwa als Autor und Koproduzent von Marvels "Agent Carter", was wahrlich nicht die schlechteste Empfehlung ist. Auch für "Manifest Destiny" hat er eine gute Balance zwischen Intelligenz, knalliger Action und der nötigen Dosis Humor gefunden (Hmmm, wie wird ein Zombie-Stinktier wohl die Ansteckung verbreiten ...?). Eine gelungene Mischung aus Secret History, Pionierliteratur und Horror – wobei für Letzteren die Gore-Elemente ebenso wichtig sind wie der psychologische Suspense, der sich aus der Gruppendynamik der Expedition ergibt.
Und wer weiß, was noch alles kommt. Einmal stehen Lewis und Clark vor einer riesigen pflanzenüberwucherten Struktur, die exakt wie der Gateway Arch von St. Louis aussieht. Der wurde erst in den 1960er Jahren gebaut ... zu Ehren Thomas Jeffersons übrigens. Vielleicht ist das also nur ein augenzwinkernder Gag – aber vielleicht wird die Expedition ja am Ende nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit erkunden. Man darf gespannt sein.
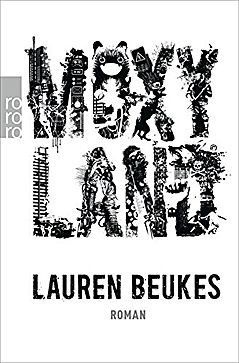
Lauren Beukes: "Moxyland"
Broschiert, 363 Seiten, € 10,30, rororo 2016 (Original: "Moxyland", 2008)
Sodala! Damit wäre jetzt das gesamte bisherige Romanwerk von Lauren Beukes auch auf Deutsch erhältlich. Schlauerweise hat sich der Rowohlt-Verlag den vielbeachteten Roman, mit dem Beukes 2008 der Durchbruch gelang, bis zuletzt aufbewahrt. Denn "Moxyland" ist anders als das mit magischen Elementen angereicherte "Zoo City" oder der Zeitschleifen-Krimi "Shining Girls" Science Fiction pur. Und aus irgendwelchen Gründen tut sich das Mainstreampublikum bekanntlich mit Elfen, Werwölfen und sprechenden Eulen viel leichter als mit Szenarien, die eine plausible technologische und gesellschaftliche Entwicklung schildern – warum auch immer. Glückwunsch jedenfalls an den Verlag, die potenzielle Hemmschwelle gegenüber Beukes gesenkt und nun auch diesen großartigen Roman nachgereicht zu haben.
Schauplatz, eigentliche Hauptfigur und, wenn man so will, im Grunde auch die Handlung des Romans ist das Kapstadt der nahen Zukunft. Keine schöne Zukunft, zumindest nicht für alle. Die Bevölkerung gliedert sich in die Corporati, also die Angehörigen großer Unternehmen, die wie Quasi-Staaten agieren und über ihre MitarbeiterInnen verfügen wie über Untertanen, sowie den großen Rest, BürgerInnen zweiter Klasse. In einem Südafrika, das von einer Regierung GmbH geleitet wird, haben die Corporati sogar ihre eigene Infrastruktur – einen kleinen Vorgeschmack auf diese Entwicklung erhielten wir vor Kurzem mit der ganz realen Meldung, dass für die saudiarabische Hauptstadt eine Drei-Klassen-U-Bahn gebaut wird.
An Zynismus kaum zu überbieten
Damit niemand aufmuckt, existiert ein einfallsreicher Strafenkatalog. Zum Beispiel kann man für einige Zeit offline gesetzt werden – da selbst die kleinsten finanziellen Transaktionen übers Smartphone laufen, kommt das einem Ausschluss aus der Gesellschaft gleich. Und wenn ein schneller Durchgriff "nötig" wird, kann die Polizei jedermanns Handy anpingen, damit es seinem Besitzer einen Stromschlag verpasst; Entschärfung nennt sich das.
Sollten alle Stricke reißen und nicht einmal mehr die allgegenwärtigen genmanipulierten Polizeihunde ausreichen, dann haben die einfallsreichen Mächte, die die Gesellschaft lenken, immer noch was in der Hinterhand. Beukes schildert, wie eine Demonstration in der U-Bahn aufgelöst wird, indem sämtliche Anwesende aus der Sprinkleranlage besprüht werden, worauf die Durchsage folgt:
"Der Satzung zufolge, die zu Ihrer Sicherheit angewendet wurde, hat man Sie dem M7N1-Virus ausgesetzt, einer laborkodierten Variation des Marburg-Virus. Brechen Sie nicht in Panik aus. [...] Der M7N1-Virus ist für Sie nur tödlich, wenn Sie NICHT innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden ein Immunitätszentrum aufsuchen und sich behandeln lassen. [...] Die Gegenimpfung ist ein kostenfreier Service der südafrikanischen Polizeibehörde."
Düsteres Gesellschaftsbild
"Moxyland" steht ganz in der Tradition von Cyberpunk und Biopunk – und hier ist das "-punk" auch gerechtfertigt. Wir bleiben großteils an denen dran, die an den Rand gedrängt wurden, die auf der Straße oder zumindest unter prekären Verhältnissen leben und zusehen müssen, wie sie an all der neuen Technologie wenigstens irgendwie mitnaschen können. Außerdem zieht sich ein unverkennbares Gefühl von "No Future" durch diese Gesellschaft: eine Ausweglosigkeit, die durch eine mittels Medien und Werbung forcierte Lethargie aufrechterhalten wird.
Vor allem im ersten Abschnitt bombardiert uns die selbst aus Südafrika stammende Autorin mit Eindrücken aus einem lebendig und glaubhaft gezeichneten Zukunfts-Kapstadt. Die Sprache tut das ihrige dazu und wirkt mit ihrer Mischung aus SFischen Neologismen und südafrikanischen Slangausdrücken (für Letztere gibt es am Ende ein Glossar) doppelt exotisch: ein weiteres gelungenes Beispiel – ähnlich Ian McDonalds "Cyberabad" – für plausible Science Fiction von der vermeintlichen Peripherie.
Die Hauptfiguren
Kendra Adams ist eine junge Fotografin, die die glitzernde Welt des Kunstbetriebs kennt. Trotzdem fürchtet sie die Armut und lässt sich deshalb das Logo des Getränkekonzerns Ghost nanotechnologisch in die Haut implantieren. Die unternehmenseigene Bahn saust auf einer Wasserhaut lautlos durch den Tunnel, überschwemmt von den Gezeitenströmungen, die man in den widerhallenden Eingeweiden von Kapstadt auf diese Weise sinnvoll nutzt – wie allen Schmutz, allen Müll in dieser Stadt. Wie letztlich auch mich, Kunsthochschulabbrecherin, schon bald neu erfunden als Markenbotschafterin. Als Sponsoren-Tussi. Als neues Ghost Girl.
Dem vergnügungssüchtigen Kleinganoven Toby scheint es vollauf zu genügen, in Sex, Drogen und Videospielen zu versinken. In Wahrheit ist er hochintelligent und hegt (wie alle Hauptfiguren übrigens) große Pläne für die Zukunft – am liebsten würde er mit seinem Streamcast "Tagebuch eines Arschlochs" groß rauskommen. Völlig anders die Vision des Aktivisten Tendeka Mataboge: Er ist ein waschechter Idealist, der die Gesellschaft verändern möchte – leidet aber unter seinem mangelnden Charisma, was ihn oft wütend und dann gewalttätig macht. Und dann hätten wir da noch die zynische Corporati Lerato Mazwai, die ihr ganz eigenes Süppchen kocht. Sie stammt übrigens aus einem Aidswaisenhaus, das ein Konzern betreibt, um seine Reihen mit Nachwuchs aufzufüllen.
Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe ...
Es gibt diverse Querverbindungen zwischen diesen Figuren, dennoch rätselt man längere Zeit, zu welchem Plot sich ihre Wege letztlich verknüpfen werden. Die Dinge kommen ins Rollen, als Tendeka einen Sabotageakt gegen eine Reklametafel plant: Klingt für uns nach einer lächerlichen Kinderaktion, würde in dieser Zukunft aber schwerst bestraft; mal ganz davon abgesehen, dass so eine Tafel durch Stacheldraht und Starkstrom geschützt wird. Werbung über alles! Angestiftet vom geheimnisvollen skyward*, mit dem Tendeka per Chat kommuniziert, schaukelt sich der Aktionismus allmählich hoch. Bis alle Handlungsfäden schließlich in einem chaotischen Höhepunkt zusammenfinden.
Beukes selbst nennt ihren Roman im Nachwort einen "heftigen Brocken". Das trifft auch zu, aber vor allem ist er eines: ein Erlebnis!
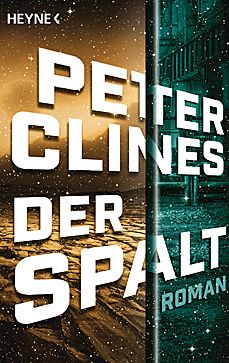
Peter Clines: "Der Spalt"
Broschiert, 526 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "The Fold", 2015)
Beam me up, Sherlock! Nerdkultur-Verwerter Peter Clines hat wieder zugeschlagen. Nicht zu verwechseln mit "Ready Player One"-Autor Ernest Cline, auch wenn sich sein US-Landsmann und Beinahe-Namensvetter Peter in "Der Spalt" alle Mühe gegeben hat, in Sachen popkulturelle Zitate an Ernest vorbeizuziehen. Zur Erinnerung: Peter Clines ist der Autor der düsteren Superhelden-vs-Zombies-Reihe "Ex-Heroes". Von der habe ich seinerzeit zwar nur den ersten Band gelesen, aber der war wirklich ausgesprochen gut.
Das sympathische Genie von nebenan
Hauptfigur Leland "Mike" Erikson hat einen IQ von 180 und dazu ein eidetisches Gedächtnis; er kann jede beliebige Erinnerung zielgerichtet und schnell abrufen. Für sich selbst visualisiert er diesen Vorgang als Ameisen, die in seinem Kopf durcheinanderwimmeln und Bilder hochhalten. Krabbeltiere hin oder her, ähnelt der Prozess der Datenverarbeitung stark dem, was sich im Oberstübchen von Benedict Cumberbatch in "Sherlock" abspielt. Und Clines versucht die Parallelen auch gar nicht erst zu verstecken, er spricht sie ehrenwerterweise explizit aus. "Mike", wie wir später erfahren werden, kommt übrigens von "Mycroft".
Mike tut das, was vermutlich viele Menschen tun, die über einen himmelhohen IQ verfügen: Er stellt sein Licht unter den Scheffel, versucht sich unauffällig in die Gesellschaft einzufügen ... und arbeitet als Englischlehrer an einer Highschool. Bis sein alter Freund Reggie, der für die DARPA arbeitet, mal wieder versucht, Mikes Fähigkeiten endlich auszuschöpfen und ein von der Regierung gefördertes Projekt, an dessen Erfolg ihm sehr viel liegt, zu evaluieren. Es geht um nichts weniger als eine Art Beam-Technologie – da kann selbst Mike nicht widerstehen.
Also quartiert sich Mike in der streng geheimen Versuchsanlage in San Diego ein, wo er es mit etwa einem halben Dutzend WissenschafterInnen zu tun hat – unter ihnen auch sein unvermeidliches Love Interest, das sich anfangs natürlich spreizt, die Physikerin Jamie Parker. Das Misstrauen der ForscherInnen gegenüber dem "Schnüffler" zu überwinden, ist die erste Herausforderung. Mit seiner leutseligen Art nimmt der sympathische Mike diese Hürde allerdings ohne Probleme – in dem Punkt ist er also alles andere als Sherlock.
Es ist was faul ...
Mit vergnügter Faszination liest man, wie Mike dank seiner Fähigkeiten immer wieder scheinbar belanglose Details verknüpft und allmählich zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Und aufzuklären gibt es so einiges: Es haben sich bereits einige kleinere Störfälle ereignet. Am schwersten wog bislang der Fall eines Politikers, der das Beam-Portal benutzen durfte und danach seine eigene Ehefrau attackierte, weil er sie für eine Fremde hielt. Inzwischen hängt über dem ganzen Projekt eine Wolke diffusen Unbehagens, auch wenn es keiner zugeben möchte.
Und noch etwas stellt Mike fest: Die WissenschafterInnen haben in Wirklichkeit keine Ahnung, wie ihr Apparat eigentlich funktioniert. Sie erzählen zwar, dass er nicht den Körper in seine Bestandteile zerlegt und verschickt wie bei "Star Trek", sondern den Raum falten würde. Aber das machen sie bloß der Regierung (und wohl auch sich selbst) weis. Soviel sei verraten: In Wahrheit funktioniert die Technologie ganz anders, als sie dachten.
Nerds unter sich
Apropos: Die Frage "Was ist Star Trek?" wird für die Handlung eine ganz besondere Bedeutung erlangen. Und inmitten einer wahren Flut an Verbeugungen gegenüber der Nerdkultur gestellt werden. Immerhin beginnt der Roman gleich mit einem Telefongespräch zweier Ehefrauen über "Game of Thrones". Es folgen unter anderem Unterhaltungen über den "Hobbit" und die "X-Men", ein Regierungsbeamter mit einem Captain-America-Schild als Krawattennadel und ein Forschungsteam, das aus "Big Bang Theory" entsprungen sein könnte: Die eine ein Trekkie, der nächste spielt "Warhammer" und immer so weiter. Nicht zu vergessen der Umstand, dass so ungefähr jeder Mike darauf anspricht, er sehe aus wie Severus Snape.
Die zahlreichen (oder besser gesagt zahllosen) Anspielungen sind fast schon ein bisschen zuviel des Guten. Zudem enthält der Roman so einige Implausibilitäten, die man aber leider nicht benennen kann, ohne total zu spoilern. – Dessen ungeachtet bleibt "Der Spalt" ein ebenso spannender wie witziger (und gegen Ende hin äußerst pulpiger) Roman, der sich mit Vergnügen lesen lässt.
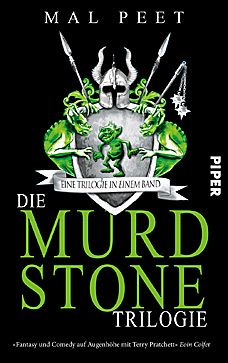
Mal Peet: "Die Murdstone-Trilogie"
Broschiert, 319 Seiten, € 13,40, Piper 2016 (Original: "The Murdstone Trilogy", 2014)
Nicht von der Aufmachung abschrecken lassen! Das ist nicht der übliche Fantasyschmonzes von der Stange, sondern eine Satire darüber (und eine überraschend fiese noch dazu). Schließlich ist die Hauptfigur des Romans selbst jemand, der einen High-Fantasy-Roman nicht mal mit der Zange anfassen würde.
Philip Murdstone heißt er und ist ein anerkannter – aber kommerziell leider nicht mehr erfolgreicher – Autor von Jugendbüchern, vornehmlich mit Fußballbezug und sozialem Anspruch. Das ist nicht der einzige Zug, den der Protagonist der "Murdstone-Trilogie" mit deren Autor teilt: Der Brite Mal Peet blickte ebenfalls auf eine entsprechende Bibliographie zurück, und auch er hatte, ganz wie seine Romanfigur, erst spät mit dem Schreiben begonnen; in seinen 50ern genauer gesagt. Und zumindest Philip fühlt sich in der Welt des schönen neuen Publishings wie ein Relikt: Dem Selbstvermarktungszwang im Internet will er sich nicht aussetzen, das sei doch "keine richtige Arbeit".
Genrewechsel
Beide wechselten jedenfalls das Genre. Mal Peet schrieb die vorliegende Fantasysatire für Erwachsene und Philip ... der muss erst noch überzeugt werden. Seine berechnende Agentin Minerva Cinch – in ihrer überzeichneten Darstellung selbst eine Satire auf ihre Zunft – redet ihm zu wie einem kranken Gaul, sich mal im einträglichen Fantasy-Genre zu versuchen. "Ach, komm schon, Philip. Es ist keine Quantenphysik. Es gibt ein Schema, eine Formel." Beim Dinner erhält er einen Crash-Kurs:
"Der Held übersteht mehrere schwere Prüfungen, was ihm eine Art mystische mittlere Reife einbringt, und dann bekommt er ein magisches Schwert. Es muss einen Namen haben, dieses Schwert. Das ist wichtig, okay?" Minerva unterstrich dreimal die Worte "Schwert hat Namen". "Was für einen Namen?", fragte Philip benommen. "Einer, der walisisch klingt, ist normalerweise in Ordnung. Etwas, das man mit normalen Zähnen im Mund nicht aussprechen kann. Oh, und da wir gerade bei Namen sind ... Es ist immer eine gute Idee, hier und dort ein Apostroph einzufügen, an den Stellen, wo man normalerweise keins erwartet."
Breitseite gegen Fließband-Fantasy
In diesem Abschnitt glänzt der – keineswegs rein humoristische! – Roman mit komischen Highlights und zündelt gegen so ziemlich alles von Christopher Paolini bis Diana Gabaldon. Letztlich sieht sich der völlig überrumpelte Philip jedenfalls genötigt, einen Stapel Fantasywälzer von Autoren, die gegen das Wort "Ende" allergisch waren, als inspirierende Lektüre mit nach Hause zu nehmen. Nur zwei Tage später hatte er das hohläugige und mitgenommene Erscheinungsbild eines Mannes, der von den Schrecken eines mittelalterlichen Schlachtfelds fortwankte.
In seiner Verzweiflung besäuft sich Philip bis an den Rand der Besinnungslosigkeit, stolpert auf dem Nachhauseweg in einen alten Steinkreis (hallo, "Outlander"!) ... und sieht sich plötzlich einem Rumpelstilzchen-artigen Wesen namens Pocket Wellfair gegenüber. Das erzählt ihm eine wahre Geschichte von einem Dunklen Lord und einem bedrohten Land – und schon hat Philip den Stoff für sein Buch: ein Derivat aller High-Fantasy-Schwarten, die es je gegeben hat. Und ein Buch, das ich nicht einmal mit der Zange anfassen würde: Der Plot des Romans-im-Roman wird recht ausführlich beschrieben, und daneben wirkt sogar Alexey Pehov originell. Natürlich wird "Dunkle Entropie" zum Mega-Bestseller.
Es wird ernst
Noch einmal sei's gesagt: "Die Murdstone-Trilogie" ist kein rein humoristisches Werk, auch wenn in Rezensionen gerne Terry Pratchett herbeizitiert wird. Ja, es gibt Entsprechendes: etwa eine höchst skurrile Exorzismus-Passage, einen Exkurs zur kroatischen Küche oder liebenswerte Details wie den Dorfbewohner, der seine Cannabisplantage mit roten Christbaumkugeln als Tomatenbeet tarnt.
Gar nicht zum Lachen ist hingegen, wenn der plötzlich im Weltruhm schwelgende Philip bei einer Lesung für einen billigen Gag einen behinderten Jungen zum Weinen bringt – also genau die Art Kind, für die er sich in seinen früheren Büchern engagierte. Dieser Bruch darf als erste Warnung verstanden werden.
Alles hat seinen Preis. Und den fordert Philips "Ghostwriter", der höchst ordinäre und gerne handgreiflich werdende, aus gutem Grund aber auch von Verzweiflung getriebene Pocket Wellfair nun ein. Allein, Philip will nicht zahlen. Er hat sich an sein neues Luxusleben gewöhnt und verlangt einen zweiten und auch noch einen dritten Band. Inzwischen ist in der Zusammenarbeit aber der Wurm drin. Während die "Dunkle Entropie" ein beunruhigendes Eigenleben entwickelt und die Romanwelt zunehmend ins reale Leben eindringt, schreitet Philips moralischer und geistiger Verfall voran. Pratchett & Co stehen hier nicht mehr Pate, das hat schon mehr Parallelen zu den Romanen, in denen Stephen King die ins Übernatürliche verlagerten Nöte eines Schriftstellers schildert, etwa "Stark – The Dark Half" oder "The Shining". Düster wird's. Und immer unvorhersehbarer und damit interessanter.
Am Ende
Die Lektüre der "Murdstone-Trilogie" führt einem exemplarisch vor Augen, wie man Bücher vorab gerne in eine Schublade stecken will. Dann irritiert ist, wenn eines nicht reinpassen will. Und schließlich erleichtert aufseufzt, wenn man doch noch eine andere findet. In diesem Fall trägt sie die Aufschrift Jonathan Carroll: Das schleichende und im Verlauf der Handlung zunehmende Gefühl des Unbehagens und das Vordringen von Märchenelementen in die Realität, das hat mich doch ziemlich an den Autor von "Schlaf in den Flammen" und "Das Land des Lachens" erinnert.
Mal Peet ist im März vergangenen Jahres im Alter von 67 Jahren verstorben. "Die Murdstone-Trilogie", deren Auflösung durch Peets Tod eine beklemmende zusätzliche Note erhält, wurde mit Lob überschüttet. Leider werden wir nie erfahren, wie es mit Peets zweiter literarischer Karriere weitergegangen wäre.

George R. R. Martin: "Die Flamme erlischt"
Broschiert, 448 Seiten, € 15,50, Penhaligon 2016 (Original: "The Dying Light", 1977)
Einen faszinierenden Schauplatz beschert uns dieser Roman aus den ersten Jahren des Schaffens von George R. R. Martin: Worlorn ist ein sogenannter vagabundierender Planet, also einer ohne Mutterstern. Laut einer Studie aus dem Jahr 2011 könnte es von diesen dunklen Wanderern in der Milchstraße doppelt so viele geben wie Sterne.
The carnival is over
Worlorn nun ist auf seiner Bahn durch ein Mehrfachsternsystem gezogen, das ihm für ein paar Jahrzehnte habitable Bedingungen beschert hat. Die besiedelten Welten der näheren Umgebung haben dies genutzt, um Worlorn mit großem Aufwand zu terraformieren – nicht zwecks dauerhafter Besiedelung, sondern nur, um dort ein großes Festival zu veranstalten. Fauna und Flora von verschiedensten Planeten wurden importiert und sind zu einer einzigartigen Mischökologie verschmolzen. Zudem hat jedes Volk eine eigene Stadt errichten dürfen, die seine Kultur widerspiegelt – von der martialischen Bergfestung bis zur Hightech-Arkologie.
Inzwischen ist Worlorn allerdings weiter gezogen: Die Party ist vorbei, die meisten Gäste sind nach Hause geflogen, der Planet sinkt mitsamt seiner umgestalteten Oberfläche langsam wieder Kälte und Dunkelheit entgegen. Und wir finden uns damit in einem wundersam melancholischen Setting wieder – wie ein verfallendes Weltausstellungsgelände von planetaren Ausmaßen.
Dem Ruf der Liebe gefolgt
Auf diese Welt der erlöschenden Flamme wird nun die Hauptfigur des Romans gerufen, Dirk t'Larien vom Planeten Avalon. Letzterer deutet schon im Namen seinen Grad an Zivilisiertheit an – das wird genau das sein, was Softie Dirk Probleme im Umgang mit den etwas ruppiger gestrickten Bewohnern der Randwelten einbrocken wird. Zur Einordnung: Der Roman gehört zum losen Zyklus der "Thousand Worlds", in denen GRRMs frühe SF-Werke angesiedelt sind; eine ferne Zukunft, in der die Menschheit weite Teile der Milchstraße besiedelt hat und die "alte Erde" den ganzen riesigen Flohzirkus nicht mehr länger zusammenhalten kann.
Dirk kommt nach Worlorn, weil dort seine Ex-Freundin Gwen Delvano als Ökologin arbeitet. Er hofft, dass sie es noch einmal mit ihm versuchen will – muss bei seiner Ankunft aber feststellen, dass sie so etwas Ähnliches wie verheiratet ist. Ihr – in Ermangelung eines besseren Wortes – "Ehemann" heißt Jaantony Riv Wolf hoch-Eisenjade Vikary (kurz: Jaan) und stammt aus der Kultur der Kavalaren. Die haben nicht nur einen höchst komplizierten Duell-Kodex entwickelt, sie hängen generell einem Männlichkeitskult an. Die engste (wenn auch nicht-sexuelle) Beziehung besteht jeweils zwischen zwei Männern; Jaans Partner heißt Garse. Frauen hängen da nur zwecks Fortpflanzung irgendwie dran und spielen eine untergeordnete Rolle. Kurz gesagt also: Dirk sieht sich unverhofft einer brisanten Ménage-à-trois gegenüber – kein Wunder, dass sich Gwen und Garse in einem fort anbitchen.
Culture-Clash
Jaan hat bereits Erfahrungen auf anderen Welten gesammelt und kann seine heimatliche Kultur daher hinterfragen. Er ist einer von der kritischen Sorte, wie sein Blutsbruder Garse leicht verzweifelt kommentiert. Durch die engen Bande zwischen ihnen ist aber auch der konservative Garse selbst zwangsläufig in ein neues Fahrwasser geraten. Im Verlauf des Romans darf man daher konstatieren, dass seine Hauptfigur (Dirk) nicht unbedingt auch sein Held ist: Jaan und Garse haben in ihrer persönlichen Entwicklung einen viel weiteren Weg zu beschreiten als Dirk. Wie weit, zeigen die wirklichen Fundis ihres Volks: Die machen Jagd auf alle Nicht-Kavalaren, als wären es Tiere. Das werden Dirk & Co beizeiten noch am eigenen Leib zu spüren bekommen.
Als roter Faden zieht sich das Thema Selbstbestimmung durch den Roman: Gwen trennte sich einst von Dirk, weil sie sich von ihm in eine Rolle gedrängt fühlte – und fand sich ironischerweise in einer noch beengenderen wieder. Womit sie nicht allein bleibt: So wird Dirk vor die Wahl gestellt, von Jaan als "geschütztes Eigentum" markiert ... oder von dessen Artgenossen gejagt zu werden. Insgesamt gelingt GRRM eine gefährliche Gratwanderung erstaunlich gut: Er denunziert die Kultur der Kavalaren nicht, sondern erklärt ihre Ursprünge. Er macht aber auch nicht den Fehler, ihre Schattenseiten – etwa die Unterdrückung von Frauen – mit einem treudoofen "Ist halt eine andere Kultur" zu entschuldigen.
Back to the 70s
"Die Flamme erlischt" ist typische 70er-Jahre-SF. Und das nicht nur, weil man(n) hier das Haupthaar lang und den Ausschnitt offen trägt, um den Brustpelz schön zur Geltung zu bringen. Ökologie, die äußere Welt als Spiegelbild von Gefühlslagen und vor allem ein Culture-Clash sind die bestimmenden Themen; Social SF eben. Fantasyeske Elemente wie z. B. ein Juwel, in das man mit Hilfe eines "Espers" seine Empfindungen füllen kann, mischen sich hier mit Hochtechnologie. Letztere ist zwar weit genug fortgeschritten, um ganze Planeten umzukrempeln – von Vernetzung hingegen hat hier noch niemand je gehört. Sämtliche Geräte bleiben fein säuberlich voneinander getrennt, und um Daten zu sammeln, muss man physisch die Archive einer Bibliothek aufsuchen.
Auch in Bezug auf das schriftstellerische Schaffen von GRRM ist "Die Flamme erlischt" eine Zeitreise. Ich kann den Roman eindeutig empfehlen: Er lebt von seiner melancholischen Stimmung (ursprünglich sollte er bezeichnenderweise "After the Festival" heißen), hat ein klares Konzept und viele gute Ideen für die Ausstattung. Für seine Handlung ist er allerdings locker um ein Drittel zu lang und auch zwischendurch immer wieder mal etwas behäbig. Es wird sehr viel erklärt und geredet – und das in einem Tonfall, der nicht immer völlig organisch wirkt. Wer plaudert schon in Partizipialkonstruktionen? Kurz: Guter Roman, aber noch nicht in der Liga der späteren Meisterwerke.
Nachtrag: Kulturelle Unterschiede in Ehren, aber das gesellschaftliche Regelwerk der Kavalaren, insbesondere was Duell und Kampf betrifft, ist so kompliziert – da schmeißt nicht nur Dirk irgendwann die Nerven weg. Plötzlich gewinnt man tiefstes Verständnis für mit westlichem Pragmatismus vorgehende Schlitzohren wie Alexander den Großen, der den Gordischen Knoten kurzerhand mit dem Schwert durchhaut, oder Indiana Jones, der den herumfuchtelnden Schwertkämpfer mit dem Revolver umnietet. Was nebenbei bemerkt eine sehr GRRM-typische Lösung wäre ...
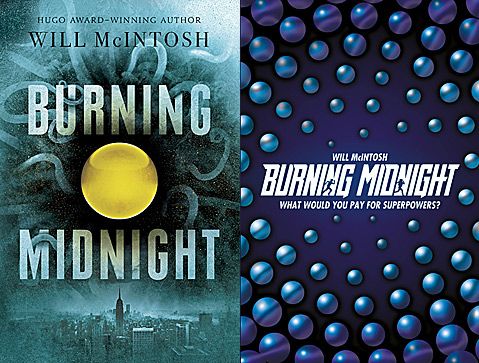
Will McIntosh: "Burning Midnight"
Gebundene Ausgabe, 320 Seiten, Delacorte Press 2016, oder broschiert, 320 Seiten, Pan Macmillan 2016
I saw the best minds of my generation destroyed by the madness of young adult literature, starving hysterical naked, dragging themselves through the plot at dawn looking for a profitable contract ... ok, das war jetzt vielleicht ein wenig dick aufgetragen. Aber Fakt bleibt, dass nach Paolo Bacigalupi mit Will McIntosh nun schon wieder ein großartiger neuer SF-Autor dem Lockruf der YA-Literatur nachgegeben hat. Wie bei Bacigalupi ist auch hier eine packende Geschichte rausgekommen (ich habe "Burning Midnight" in einem Rutsch gelesen) – aber ich komme nicht ganz drum herum, solche Romane eher als Zwischenmahlzeit bis zu dem Tag zu betrachten, an dem der Autor hoffentlich wieder ein Buch "für Erwachsene" veröffentlicht.
Auf Osterkugelsuche
Die Ausgangsidee von "Burning Midnight" ist ebenso einfach wie genial. Wir befinden uns in einer offenbar sehr nahen Zukunft (Taylor Swift und Arcade Fire sind immer noch aktuell), allerdings ist fünf Jahre vor Beginn der Handlung etwas Unerklärliches geschehen: Weltweit sind aus dem Nichts unzählige bunte Kügelchen materialisiert. Diese ballen sich in Gebieten, die von Menschen bewohnt werden, sind aber jeweils – mal besser, mal schlechter, mal nahezu unauffindbar – versteckt. Als wäre ein interstellarer Osterhase durchgezogen.
Und diese spheres haben es in sich: Wenn man sich zwei farblich übereinstimmende an die Schläfen hält, "brennen sie aus" und verändern den Benutzer in positiver Weise – jeder Farbton hat dabei eine ganz bestimmte Wirkung. Senfgelb erhöht den IQ, Rubinrot sorgt für perfekte Zähne, Aquamarin lässt Verletzungen schneller heilen und so weiter und so fort. Superkräfte verleihen die Kugeln allerdings nicht – sämtliche Optimierungen liegen innerhalb des menschenmöglichen Spektrums.
Das Ensemble
Hauptfigur des Romans ist der 17-jährige David "Sully" Sullivan aus Yonkers, New York. Der bessert das schmale Familieneinkommen auf, indem er Kugeln von glücklichen Findern aufkauft und auf dem Flohmarkt verhökert. Ein ganzer Wirtschaftszweig hat sich rund um die kleinen Wunderdinger entwickelt, die je nach Farbe von unterschiedlichem Seltenheitsgrad und damit Wert sind. Sully ist da nur ein kleiner Fisch – obwohl er längst stinkreich sein müsste, wenn die Welt ein fairer Ort wäre. Leider hat ihn aber der skrupellose Milliardär Alex Holliday, der einen der weltgrößten Kugelsammel- und -verkaufskonzerne leitet, einst übers Ohr gehauen und um sein Geld betrogen. Womit wir auch schon den großen Antagonisten des Romans hätten.
Eines Tages lernt Sully die coole Punk-Göre Hunter kennen, eine Einzelgängerin, die sich darauf spezialisiert hat, Kugeln an Orten zu suchen, an die noch nie jemand gedacht hat. Widerwillig erklärt sie sich dazu bereit, Sully auf ihre Expeditionen mitzunehmen. Und siehe da: Nach langer Mühsal finden sie eine goldene Kugel. Noch nie zuvor hat man eine Kugel dieser Farbe gesehen – ihre Wirkung ist daher unbekannt, ihr Preis unvorstellbar. Kein Wunder also, dass sich die beiden bald als Gejagte wiederfinden, zusammen mit Sullys muskelstrotzendem Kumpel Dom und der gutbürgerlichen Mandy Tuko. Letztere hegt übrigens als einzige tiefes Misstrauen gegenüber den Kugeln – schließlich komme nichts vermeintlich Kostenlose jemals ohne Preis. Und so viel sei verraten: Auch wenn keiner auf sie hören will, wird Mandy noch Recht behalten ...
Formel erfüllt
Wie gesagt: YA. Das bedeutet unter anderem eine zwangsläufige Liebesgeschichte, Freundschaften, die sich bewähren müssen, Abenteuer und sonstige Hindernisse sowie eine klare Verteilung von Gut und Böse. Klar ist auch, wie das alles ausgehen muss – bleibt als Wild Card aber immer noch das Mysterium der Kugeln. Das wird im Schlussdrittel des Romans dann in tatsächlich überraschende Ereignisse münden ... ich zumindest hätte nie mit dem gerechnet, was sich McIntosh da einfallen ließ. Obwohl es auf eine gewisse Weise nur folgerichtig ist: Schon die Jagd nach den Kugeln erinnert an das Punktesammeln in einem Videospiel – im Schlussteil geht's dann eben auf ein Level mit stark erhöhtem Risiko.
Der Verlag empfiehlt den Roman LeserInnen von "Maze Runner" und "The 5th Wave". McIntosh setzt die YA-Formel aber sehr gut um, hat Figuren, die man gerne begleitet, und wartet mit erfrischenden Kleinigkeiten auf, die vom Erwartbaren abweichen. Etwa als Sully betreten nach Hause kommt, nachdem er bei einer PR-Veranstaltung seines Widersachers eine Prügelei angezettelt hat. Doch hält ihm seine Mutter nicht die befürchtete Standpauke, sie gibt ihm dafür High five.
Durchaus empfehlenswert
Außerdem ist "Burning Midnight" eine diskrete kleine Lektion in Ökonomie. Die Kugeln sind eine Art natürliche Ressource, die zunächst allen gleichermaßen zur Verfügung stand. Doch die Mechanismen des Marktes haben mit der Zeit dazu geführt, dass aus all den kleinen Fischen einige Haie hervorgingen, die immer größer und fetter wurden, je mehr sie von den anderen schluckten. Bis aus der anfänglichen Chancengleichheit für alle schließlich ein vollkommen unfairer Verdrängungswettbewerb wurde.
"Burning Midnight" mag nicht in derselben Liga spielen wie McIntoshs großartige Romane "Soft Apocalypse" oder "Love Minus Eighty", und nicht einmal wie das schon etwas grober gezimmerte "Defenders". Zudem bleibt am Schluss eine ganze Reihe Fragen offen, wenn man's recht bedenkt. Aber es ist auf jeden Fall ein Pageturner mit sympathischen Hauptfiguren und bleibt als solcher – meinem Eingangs-"Geheul" zum Trotz – klar positiv in Erinnerung.

Herbert W. Franke: "Das Gedankennetz"
Broschiert, 184 Seiten, € 10,90, p.machinery 2015/16 (Erstausgabe 1961)
Zum Jahreswechsel hat der Verlag p.machinery seine Herbert W. Franke-Werkausgabe mit einem Dreierpaket vorangetrieben. Ich werde hier mit dem chronologisch ersten beginnen und – nicht zuletzt, weil er mir sehr gut gefallen hat – in späteren Rundschau-Ausgaben auch die beiden anderen ("Der Orchideenkäfig" und "Die Glasfalle") noch bringen.
Nachdem der mittlerweile 88-jährige Wiener Physiker, Computerkünstler und Höhlenforscher Herbert W. Franke eine Reihe von SF-Kurzgeschichten veröffentlicht hatte (zusammengefasst in "Der grüne Komet"), ließ er 1961 mit "Das Gedankennetz" seinen ersten Roman folgen. Und der hielt für die LeserInnen durchaus einige Überraschungen bereit – nicht zuletzt einen fliegenden Genrewechsel zwischen Space Opera und Dystopie und auch sonst noch so einiges.
Handlungssprünge
"Das Gedankennetz" startet in einer Zukunft, in der man eine Vorliebe für kurze Namen zu hegen scheint: Vries, Rety, Orch und Ebb – allesamt Mitglieder einer interstellaren Forschungsexpedition, für die nicht weniger als 512 Raumschiffe in Rhomboeder-Formation durchs All gleiten (das hätte das Trick-Budget von "Star Trek" nicht hergegeben). Man stößt auf einen Planeten mit den Resten einer untergegangenen Zivilisation – darunter auch einige konservierte Gehirne. Zurück an Bord, haben die wackeren Forscher nichts Besseres zu tun, als eines dieser Gehirne ans Bordsystem anzuschließen ... welches daraufhin sofort vom Eindringling übernommen wird. Wie diese ein wenig an "Captain Future" erinnernde Episode mit dem Rest des Romans zusammenhängt, wird sich erst am Ende herausstellen.
Denn in Kapitel zwei lernen wir erst einmal eine neue Hauptfigur kennen: Eric Frost, der auf einer fremdartigen Ozeanwelt zusammen mit einem Kollegen und einem Roboter zwei verschollenen Expeditionsteams hinterherforscht. Die Erkundung einer offenbar künstlichen Korallenbank, die sich aus dem Meer erhebt, ist vortrefflich beschrieben. Nicht immer, aber immer wieder pflegt Franke eine eindringlich bildhafte Sprache – hier etwa Erics Eindrücke vom Weltenmeer, das voller kleiner Gallertkügelchen ist: Sie zogen eine Wolkenspur von Flocken hinter sich her, hauchdünne Hohlkugeln wie von einem Seifenblasenspiel, Tausende von weiß-trüben Kaninchenaugen mit roten Pupillen, die sinnlos über die sanft wallende Oberfläche hetzten. Dieses trübe Gestöber legte sich wie ein Vorhang vor Sid, der die Hände an die Brüstung klammerte und ihnen mit weit geöffneten Augen nachsah.
Unsanfte Landung in der Wirklichkeit
Im darauf folgenden Kapitel treffen wir Eric wieder – diesmal jedoch auf einem ganz anderen Planeten, wo er einem abgesetzten Diktator zur Flucht verhilft. Und als wir danach erneut die Welt, aber nicht den Protagonisten wechseln, beginnen sich die ersten Nebel zu lichten. Hier diskutiert ein Panel von WissenschafterInnen den Fall des Eric Frost, dem abweichendes Sozialverhalten attestiert wurde und den man daher virtuellen Erlebnisprüfungen unterzieht. So soll entschieden werden, ob er ein Kandidat für eine Lobotomie ist.
Den Hintergrund für eine Dystopie irgendwo zwischen "Brave New World", "1984" und "Logan's Run" gibt hier eine Erde ab, die zu einer einzigen, alle Landmassen überwuchernden Betonstadt geworden ist. Die Erkundung des Weltraums hat man längst als zu kostspielig und letztlich sinnlos aufgegeben – recht bemerkenswerte Gedanken für einen SF-Roman aus den 1960ern.
Lange Vorgeschichte
Falls jetzt jemand "Spoiler!" schreit: Dass es in "Das Gedankennetz" um Illusionen und die Manipulation des Wirklichkeitsempfindens geht, steht schon auf der Rückseite des Buchs, also sollte vom Grundprinzip niemand überrascht sein. Doch keine Angst: Wir sind erst bei der Hälfte angelangt und Franke hat sich noch jede Menge für den weiteren Verlauf aufgehoben. Und wie er die einzelnen Episoden letztendlich verknüpft, ist wirklich ausgesprochen raffiniert. Mit dieser Episodenhaftigkeit wirkt "Das Gedankennetz" zugleich wie ein organischer Übergang von Frankes früheren Kurzgeschichten zum Langformat – gut möglich, dass da noch ein paar übriggebliebene herumlagen, für die er hier nachträglich einen erzählerischen Rahmen fand.
Der Band enthält ein Nachwort zur Verwendung von Virtualität bei Herbert W. Franke; zumindest in diesem Roman ist damit übrigens nicht der Cyberspace gemeint, sondern ähnlich wie in Lems "Der futurologische Kongreß" chemisch induzierte Illusionen (man verabreicht Amnesin forte und Haluzinid C siebzehn). Außerdem wartet der Anhang mit bibliographischen Informationen und Farb-Repros aller bisherigen Ausgaben des Romans auf.
Natürlich merkt man dem Buch trotz Überarbeitung durch den Autor im Jahr 1990 sein hohes Alter an. Da gehören nicht nur Lochkarten-Computer zur Ausrüstung an Bord eines Raumschiffs, sondern auch eine Schreibmaschine. Manche Termini klingen schief ("im Ultraschallgebiet"), und ein-, zweimal hat auch die Physik kurz den Raum verlassen. Das trägt aber nur dazu bei, dem Ganzen einen Touch Retrofuturismus zu verleihen – als würde man eine Vinylplatte von Kraftwerk auflegen.
Lohnt sich
Von Ausstattungsoberflächlichkeiten abgesehen, bleibt "Das Gedankennetz" ein Hard-SF-Roman, der sich gut gehalten hat und in manchen Passagen (etwa die Mission am Korallenriff) auch heute kaum besser geschrieben werden könnte. Spannend, gut erzählt und wie gesagt sehr gefinkelt zusammengefügt: "Das Gedankennetz" ist empfehlenswerte Lektüre – nicht nur aus historischem Interesse.
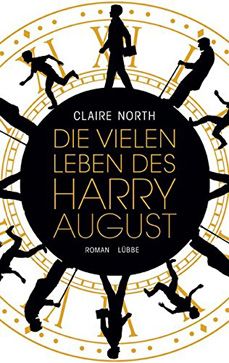
Claire North: "Die vielen Leben des Harry August"
Gebundene Ausgabe, 496 Seiten, € 20,60, Lübbe Ehrenwirth 2015 (Original: "The First Fifteen Lives of Harry August", 2014)
Asche auf mein Haupt (und ein bisschen eigentlich auch auf das der zuständigen Pressestelle): Erst mit Verspätung und auch nur durch einen Zufall habe ich bemerkt, dass der wunderbare Roman "The First Fifteen Lives of Harry August" von Claire North inzwischen auf Deutsch erschienen ist (hier der Link zur Besprechung der Originalausgabe). Sehr empfohlen!
Gut durchdachtes Szenario
Für Details siehe obigen Link – für ungeduldige Seelen hier noch einmal eine Kurzzusammenfassung: North stellt uns eine Geheimgesellschaft von Quasi-Unsterblichen vor, die unerkannt unter uns leben. Und zwar immer wieder: In einem ewigen Zyklus werden sie geboren, altern und sterben – um anschließend im Jahr ihrer Geburt erneut zum Leben zu erwachen. Allerdings haben sie ihre Erinnerungen behalten und können mit ihren Erfahrungen den nächsten Durchlauf ganz anders gestalten.
Zu dieser Vorgabe hat sich die britische Autorin einige originelle Aspekte einfallen lassen – zum Beispiel eine Art Stille Post durch die Jahrhunderte: Jemand nimmt kurz vor seinem Tod eine Botschaft mit, gibt sie nach seiner Wiedergeburt als Kind an jemanden weiter, der auf dieser Zeitebene bereits alt ist, und immer so weiter; eine bestens funktionierende Brücke in die Vergangenheit.
Interessanterweise haben wir es nicht mit einem sinistren Verschwörerbund wie in der TV-Serie "Intruders" zu tun. Man giert auch nicht nach der Weltherrschaft – große Ambitionen hat nach einigen Lebensdurchläufen niemand mehr, Hauptsache man lebt angenehm. Bis einer aus der Reihe tanzt und eben doch welterschütternde Pläne schmiedet: Der wird zum Antagonisten des Romans und darf sich mit Titelfigur Harry August ein packendes Psychoduell liefern.
Spannung, Esprit und gute Ideen: Herz, was begehrst du mehr!
++++++
Urlaubspausen wie die im Februar führen natürlich immer dazu, dass sich meine Bücherberge daheim (die Post liefert ja ungebrochen weiter) zu wahren Mountains of Madness auftürmen. Die nächste Rundschau folgt daher recht zügig – mit dabei unter anderem der nächste Einsatz der Genrenauts, der Abschluss der "Stonespring"-Trilogie und die Romanvorlage für einen Ekel-Klassiker von John Carpenter. (Josefson, 26.3.2016)