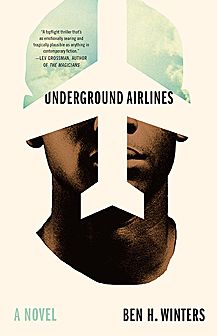
Ben H. Winters: "Underground Airlines"
Gebundene Ausgabe, 336 Seiten, Mulholland Books 2016
Die Empfehlung des Monats ist zugleich das Buzz-Buch der Saison. Phantastikromane, die sich mit afroamerikanischer Geschichte befassen, werden in den USA eigentlich immer eifrig diskutiert – siehe etwa Matt Ruffs wunderbare Verknüpfung von Cthulhu-Mythos und Rassismus in "Lovecraft Country". Die brisante Gemengelage, die sich in den vergangenen Wochen in den USA aufgebaut hat, tut natürlich das ihrige dazu, dass dem Alternativweltroman "Underground Airlines" nun noch mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Und dann stammt er auch noch von Ben H. Winters, der uns schon mit der Weltuntergangstrilogie "The Last Policeman" gefesselt hat. Und so wie diese ist auch das gleichermaßen beeindruckende "Underground Airlines" Science Fiction ohne Spezialeffekte.
Historischer Hintergrund
In Winters' Romanwelt wurde Abraham Lincoln schon unmittelbar nach seiner Wahl zum Präsidenten erschossen. Auf seinem Begräbnis fanden sich die Politiker von Nord und Süd gewissermaßen fünf Minuten nach zwölf noch einmal zusammen und schlossen den Crittenden Compromise. Dieser besagt, dass keine nachträgliche Verfassungsänderung einem Bundesstaat das "Recht" auf Sklaverei nehmen darf. Der Bürgerkrieg fand niemals statt.
Und so existiert die Sklaverei in der Smartphone- und Daily-Soap-Welt des Jahres 2016 immer noch, wenn auch nur in den Hard Four Carolina (wiedervereinigt), Alabama, Louisiana und Mississippi. Drei Millionen AfroamerikanerInnen leben hier als Persons Bound to Labor (PB) auf Farmen, in Minen oder in Fabriken. Im zweiten Teil des Romans werden wir ins Innere eines solchen Sklavenbetriebs vordringen, und was wir dort vorfinden, wird den Albtraumvisionen George Orwells in nichts nachstehen.
Das System kennt kein Entrinnen
Der Roman startet damit, dass sich der Erzähler – ein verzweifelt erscheinender Mann – hilfesuchend an einen Priester wendet, der möglicherweise für die Underground Airlines arbeitet: So lautet die metaphorische Bezeichnung für ein Netzwerk, das Sklaven auf Schleichwegen aus dem Süden rettet, angelehnt natürlich an die berühmte Underground Railroad des 19. Jahrhunderts. In Sicherheit ist man jedoch erst, wenn einen die "Fluglinie" bis nach Kanada geführt hat. Teil des Kompromisses, der die Union zusammenhielt, war es nämlich, dass entlaufene Sklaven in den Süden zurückgebracht werden müssen, wenn man sie irgendwo in den USA aufgespürt hat. Selbst wenn sie schon seit Jahren unter neuer Identität frei leben, einen Beruf ausüben und eine Familie gegründet haben. Vollstreckt wird diese unbarmherzige Politik von den US-Marshals.
... für die unser Erzähler als Agent arbeitet, wie sich umgehend zeigt. Der Mann, der sich Victor nennt, wurde selbst als Sklave geboren und konnte fliehen – verstreut über die Kapitel erzählen Flashbacks, wie es zu seiner Flucht kam. Doch Victor wurde geschnappt und vor die Wahl gestellt: Entweder zurück auf die Schweinefarm – oder er hilft den Marshals dabei, andere Geflüchtete aufzuspüren. Was hätte er schon tun können?
Der ungreifbare Victor
Wie schon "The Last Policeman" ganz wesentlich vom Charakter seines Titelhelden Hank Palace lebte, wird auch "Underground Airlines" von seiner Hauptfigur getragen. Victor teilt einige Züge mit Hank, etwa eine stoische Pflichterfüllung und eine gewisse Pedanterie, erweist sich aber als um einiges vielschichtiger – paradoxerweise deshalb, weil sein Kern ein großes Nichts zu sein scheint. I had a lot of names. Or, more precisely, it was my practice at the beginning of a new job to think of myself as having no name at all. As being not really a person at all. A man was missing, that's all – missing and hiding, and I was not a person but a manifestation of will. I was a mechanism – a device. That's all I was.
Als begnadetes Chamäleon schlüpft Victor von einer gefälschten Identität in die nächste und verinnerlicht diese so sehr, dass die Grenze zwischen falsch und echt auch für ihn verschwimmt. Bezeichnend, wie er Empörung darüber fühlt, dass ihm der Priester bei seinem gefakten Problem nicht helfen will: Ob er damit wie ein Method-Actor seiner Rolle entspricht oder – mit Blick auf seine eigene Vita – ehrlich so empfindet: Wer könnte das eine vom anderen unterscheiden? Am wenigsten wohl Victor selbst, der ohne Familie aufwuchs und in der kurzen Phase seiner Freiheit menschliche Gefühle und Beziehungen "nachlernen" musste – ein Studiengegenstand, nicht weniger fremd als Geschichte oder Chemie. Und der sich in seinem Kellerversteck laut "Ha ha ha!" vorsagte, weil es ihm zuvor nie erlaubt war, laut zu lachen.
Ein Tumor und seine unzähligen Metastasen
Es sind Details wie diese, die Winters' Roman so unwahrscheinlich echt wirken lassen. Wie der Blick auf ein Südstaatenstädtchen, in dem alle so reizend miteinander umgehen wie in einem "Sissi"-Film (Victor nennt es eine Watercolor world): Das perfekte Idyll – wäre da nicht auch ein Scharfschütze auf einem Dach postiert, der die örtlichen Sklaven im Auge behält. Und keine lange Beschreibung könnte die Effizienz der Sklavenhalterindustrie besser auf den Punkt bringen als die Tatsache, dass im Datenblatt jeder PB auch ein Vermerk wie "late-summer honey, warm tone, #76" steht: Über 200 verschiedene Haut-Tönungen hat die Bürokratie des Südens aufgeschlüsselt, um ihre Opfer besser identifizieren zu können.
Indirektes Opfer des Systems sind aber nicht zuletzt die USA selbst: Da sie sich mit der Sklaverei arrangiert haben, werden sie vom Großteil der Welt boykottiert (auf den Straßen kurven folgerichtig südafrikanische Automodelle ...). Darunter leidet ironischerweise vor allem der Norden, während die Hard Four als quasi geschützte Zone den maximalen Profit aus der Sklaverei schlagen. Besonders böses Detail: eine Ladung von Billig-T-Shirts, die zu Nulllohnkosten produziert wurden und nach China exportiert werden ...
Die Malaise geht aber weit über die Wirtschaft hinaus: Da die Sklaverei nie abgeschafft wurde, wirft sie ihren rassistischen Schatten auch über die "freien" Staaten. Und je weiter man nach Süden kommt, desto dunkler wird er, was Victor mit einem "Schwierigkeitskoeffizienten" umschreibt: I think of it sometimes as a pressure in the atmosphere, like walking under water: the extra effort required to get served at a restaurant, make a purchase at a store. Check in to a motel. "Underground Airlines" rechnet nüchtern vor, was es eine Gesellschaft kostet, wenn sie einen faulen Kompromiss mit ihren Grundwerten eingeht.
Große Empfehlung!
Und Victor? Wird er aus Selbstschutz seinem Auftrag treu bleiben? Der ihn auf eine perverse Weise sogar erfüllt, wie er sich – gnadenlos selbstanalytisch, wie er ist – heimlich eingesteht: That's the problem with doing the devil's work. It can be pretty satisfying now and again. Pretty goddamn satisfying. Wird er weiter seine Leidensgenossen verraten oder sich doch noch gegen das System wenden? Diese Frage wird uns nach einer Reihe von Twists und Überraschungen buchstäblich bis zum Ende des Romans in Atem halten.

Karsten Kruschel: "Das Universum nach Landau"
Broschiert, 277 Seiten, € 13,40, Wurdack 2016
Neuer Stoff für alle, die – so wie ich – Fans von Karsten Kruschels "Vilm"-Universum sind. Oder halt des "Universums nach Landau", benannt nach einem Wissenschafter aus der nahen Zukunft, dessen Name in Form der Landau-Modulatoren für den Sternenantrieb unsterblich werden wird. Zwei Anmerkungen zu diesem Buch vorab: Erstens – es ist kein Roman. Auch kein "Roman in Dokumenten und Novellen" wie am Cover steht, als wäre es ein kleiner Junge, den man beim Keksestibitzen erwischt hat und der nun mit irgendwelchen Ausreden herumdruckst. Es ist eine Storysammlung. Punkt. Zweitens – es ist super!
"Das Universum nach Landau" enthält 15 Texte von Novellen- bis Flash-Fiction-Länge, die Kruschel über die Jahre geschrieben und teilweise rückwirkend adaptiert hat, damit sie in die Zeitlinie der "Vilm"-Romane passen (mehr dazu später). Zusammen ergeben sie eine mit ihrem Fantasiereichtum beeindruckende Future History, die von quasi übermorgen aus hunderte, dann tausende und im Epilog wohl Millionen Jahre in die Zukunft reicht.
Dieses willkommene Kompendium zu den eigentlichen Romanen enthält auch einige Einträge aus dem galaktischen Lexikon Weltgeschichte sämtlicher Planeten. Hier werden ein paar offene Fragen aus früheren Werken geklärt (danke!) und dafür völlig neue in den Raum geworfen – Potenzial für weitere Geschichten. Die Worte, mit denen dieses Lexikon die riesige und ständig in Erweiterung befindliche Raumstation Atibon Legba beschreibt, kann man 1:1 auf Kruschels literarischen Kosmos selbst übertragen: (...) diese Angaben sind von begrenzter Gültigkeit, da der Aus- und Anbauprozess praktisch ununterbrochen anhält.
Und so beginnt es
Am Anfang statten wir sogar der guten alten Erde einen Besuch ab, die in den späteren Werken keine Rolle mehr spielen wird, weil sie den Kontakt zu ihren Kolonien abgebrochen hat. Hier steckt sie grade mitten in der Biologischen Krise: Mit dem Komplex-Gibberellin (eine Wortschöpfung, die direkt von Johanna und Günter Braun stammen könnte) wurde eine Art Superdünger ausgebracht – der darauf folgende monströse Pflanzenwuchs brachte die Zivilisation an den Rand des Zusammenbruchs.
Die an Ward Moores Satire-Klassiker "Greener Than You Think" ("Es grünt so grün") erinnernde Erzählung lehrt uns nicht nur, dass auf eine Apokalypse durchaus eine zweite folgen kann. Sie etabliert auch ein Motiv, das in Kruschels Erzählungen immer wieder auftauchen wird, nämlich wildwucherndes (Meta-)Leben: Siehe das "Dickicht" von Vilm, siehe den riesigen Evolutionskomplex in "Violets Verlies" (eine Art schwimmender Fleischberg aus lebenden Tierkörpern) oder auch den an Land gegangenen Unterwasserdschungel des Planeten Orange mit seinen Wolkenquallen, Waldhaien und Algenpalmen.
Zur Auflockerung folgt auf die Eröffnungsgeschichte ein superskurriles Kochrezept, das uns zeigt, was man mit der lästigen Riesenflora anfangen kann: Für das Gemüse ein Wirsingblatt von unter drei Quadratmetern in handliche Stücke teilen und vier Minuten blanchieren, dann in Eiswasser abschrecken. (...) Die blasigen, entarteten Partien in der nächsten Venusfliegenfalle entsorgen.
Die bunte Galaxis
Danach springen wir ein paar Jahrhunderte in die Zukunft und quer durch die kolonisierte Milchstraße, die originellerweise ein Farbschema hat: Die Planeten heißen beispielsweise Weiß, Violet, Orange oder Gelb-wie-Zwiebelgras. Letzterer ist Schauplatz einer Geschichte, in der die menschlichen KolonistInnen einer Agrarwelt über Jahrtausende hinweg von einer einheimischen Lebensform manipuliert werden. Dieses langlebige Wesen gaukelt ihnen vor, ein harmloses Maskottchen zu sein, ist in Wahrheit aber ein berechnendes und durchaus auch mörderisches Monster – und trotzdem kein Bösewicht.
Aus der Warte eines fremdartigen und von unseren Moralbegriffen nicht erfassbaren Wesens erzählt, atmet die Geschichte "Gelb wie Zwiebelgras, Jahre vor dem Frühlingsende" stark den Geist von James Tiptree Jr.; ein Highlight dieser Sammlung. Als ähnlich tückisch, wenn auch nicht ganz so stark, erweist sich "Rote Bonbons oder: Eskimos sind auch nur irgend so ein Feind", in dem ein Unterschichtmädchen das Haus einer reichen Familie besucht. Das scheint auf einen Klassenkonflikt hinauszulaufen ... doch dann kommt alles doch noch ganz anders als erwartet.
Metamorphosen
In "Weiß: Der Ausweg Blanche" erleben wir den Niedergang einer vergessenen Bergbaukolonie mit. Ihre menschlichen BewohnerInnen leben via insektenförmige "Totems" in einer vernetzten Cyber-Symbiose. Doch als sich ihre Welt unaufhaltsam auf einen tödlichen Winter zubewegt, kommt die Technologie an ihre Grenzen – nur eine körperliche Metamorphose, die Anpassung an die Umwelt von Weiß, könnte sie noch retten. Aber wollen sie zu "Tieren" werden?
Noch viel weiter fortgeschritten ist der Stand der Technik in "Schwarz:Netz:Schwarz" am Ende des Bands, das abertausende Jahre in der Zukunft angesiedelt ist. Aber auch hier hilft die Supertechnologie nichts: Als aus den Portalen, die die Welten miteinander verbinden, eine teerartige und offenbar intelligente Substanz quillt (schon wieder so ein Meta-Leben), Planet für Planet überwuchert und alles Leben erstickt, bleibt nur noch Flucht. Die vielleicht letzten Menschen Mauro und Clarissa, seit Jahrtausenden verheiratet und von Körper zu Körper gewechselt, setzen für eine letzte Transformation alles auf eine Karte: Ein Wettlauf mit der Endzeit und eine großartige Vision der Apokalypse – noch ein Highlight des Bands.
Kleine Kniffe
Metamorphosen spielen auch in der Novelle "Ende der Jagdsaison auf Orange" eine Rolle, die wir – in kürzerer Form – schon aus der Anthologie "Die Audienz" kennen. Sie gehört zu den Erzählungen, die Kruschel nachträglich ein bisschen umgemodelt hat, damit sie sich ins "Vilm"-Universum einpassen (ha, ich hab die Originale noch daheim). So tauchen in der neuen Version plötzlich Begriffe wie Landau-Modulatoren oder Atibon Legba auf, als wäre zuvor nur vergessen worden, sie zu erwähnen.
In "Violets Verlies" (erstmals erschienen in der Anthologie "Emotio") wird schon ein bisschen mehr geschummelt. Da mutiert ein zuvor ganz normaler Mensch namens Steenemark plötzlich zu Steen-82-mak und damit zu einem aus dem Volk der Goldenen: Jenen aus "Vilm" bekannten Fettklößen, die ihre nackten Leiber nur in transparente Schutzfolie hüllen. (Mir fällt bei Erwähnung der Goldenen wirklich jedes Mal wieder eine TV-Reportage über eine FKK-Kreuzfahrt ein, in der sich ein wackerer Rentner ein bisschen sehr weit übers Salatbuffet beugte und ... buon appetito!)
Klare Kaufempfehlung!
Trotz einer erstaunlichen Fülle an Weltuntergangsszenarien kommt der Humor nicht zu kurz, und er ist wie immer bei Kruschel von der skurrilen Sorte: Ob Wortwahl – eine pflanzenüberwucherte Leiche wird als teilbegrünt bezeichnet – oder Situationskomik: Etwa wenn der Mechaniker Laszlo in "Violets Verlies" zu einer Rettungsmission für seine Frau losstürmt und im ganzen darauf folgenden Remmidemmi nie die Kaffeekanne aus der Hand gibt, die er zufällig gerade gehalten hatte. Und sich selbst nimmt Kruschel auch gleich noch auf die Schippe. Eines der im Band enthaltenen "Dokumente" ist die Rezension eines fiktiven Buchs, die aber auch eine vorbeugende Parodie auf negative Rezensionen zu "Das Universum nach Landau" sein könnte:
Das Buch bietet nämlich keinen wissenschaftlich untermauerten, chronologisch geordneten Abriss zum Thema, sondern springt in der Geschichte der raumfahrenden Menschheit fröhlich hin und her. Der/die/das Autor/in (...) wirft dem Leser eine Unzahl von Anekdoten, Legenden und Überlieferungen vor, die in ihren vielfältigen Facetten zwar interessant und spannend sind, den Leser aber mit ihrer ungebremsten Fabulierfreude und chaotischen Darstellungsweise hoffnungslos überfordern.
Stimmt alles. Und es ist nicht nur gut so, sondern hervorragend.

James Tiptree Jr.: "Die Mauern der Welt hoch"
Gebundene Ausgabe, 504 Seiten, € 24,90, Septime 2016 (Original: "Up the Walls of the World", 1978)
Die Mauer der Welt, das ist ein polarer Wirbelsturm auf einem fernen Gasriesen, den seine BewohnerInnen Tyree nennen. Von hier aus horchen die Tyrenner auf der Suche nach anderen intelligenten Lebensformen ins Weltall hinaus. Sie selbst gleichen gewaltigen Rochen mit Propellerflügeln, die durch den aerogenen Dschungel ihrer buchstäblich bodenlosen Welt düsen und elektromagnetische Strahlung als Klänge wahrnehmen. Kurz: In ihrem ersten Roman tat Alice B. Sheldon alias James Tiptree Jr. das, was sie zuvor in einem ganzen Jahrzehnt voller fantastischer Kurzgeschichten seltsamerweise kaum jemals getan hatte: Sie entwarf ein komplettes außerirdisches Ökosystem. Und nicht nur das, wie wir noch sehen werden.
So gut wie alle Tiptree-typischen Motive sind hier eingearbeitet: Sehnsucht und unerfüllbare Liebe. Der Weltuntergang. Das Aufgehen in einer körperlosen Existenz, als Metapher Tolkiens Unsterblichen Landen ähnelnd. Der Twist, dass jemand eine ganz andere Funktion erfüllt, als er selbst die ganze Zeit über dachte (hier einmal explizit und einmal sehr subtil eingebaut). Vor allem anderen aber: der Kontakt mit dem unsagbar Fremden. Im Fall dieses Romans haben wir es gleich mit drei einander fremden Komponenten zu tun.
Das schwebende Utopia
Da sind zunächst die Tyrenner, für die Sheldon den immer wieder mal gebrauchten schwärmerischen Erzählmodus anwirft – deshalb, weil sie die Gesellschaft der intelligenten Flugrochen idealisiert. Die Tyrenner führen ein Leben in Glück und geistiger Gesundheit, verzichten auf materielle Habe und können durch ihre Lebens- oder Seelenfelder nicht nur telepathisch kommunizieren, sondern einander auch von negativen Aspekten befreien. Neben einem Ökosystem entwirft Sheldon – die zu diesem Zeitpunkt bereits im zweiten ... oder vierten, fünften Bildungsweg ein Psychologiestudium abgeschlossen hatte – also auch eine komplette fiktive Psychologie mit eigenem Regel- und Methodenwerk. Das dann unter anderem auf den wohl größten Patienten des Universums angewandt wird.
Zugleich bieten die Tyrenner rings um die junge Pionierin Tivonel Tiptree die Möglichkeit, eine Gesellschaft mit etwas anderen Genderverhältnissen zu entwerfen. Während sich die Männer hauptsächlich um die Kinder kümmern, sind die weiblichen Tyrenner wie Tivonel ungebundene Wandervögel. Die Feinfühligkeit, die Geduld. Welche Weibliche hat das schon? Abenteuer, aufregende Reisen und Arbeit, das ist es, was wir lieben! Tiptree zeichnet allerdings keine spiegelverkehrte Welt zu altpatriarchalischen Verhältnissen auf der Erde, in anderen Aspekten sieht das Verhältnis von männlichen und weiblichen Tyrennern nämlich wieder ganz anders aus. Das ist insgesamt ziemlich durchdacht konstruiert und wirklich erfrischend anders.
Schwarz und schwärzer
Im Kontrast zum positiven Feeling der Tyree-Kapitel stehen die, die auf der Erde handeln. Den Mittelpunkt bildet hier der Arzt Daniel Dan, der als medizinischer Begleiter eines Militärprojekts über telepathische Kommunikation fungiert. Nicht nur sämtliche ProbandInnen sind auf die eine oder andere Weise psychisch angeknackst. Auch Dan selbst ringt nach einem familiären Schicksalsschlag mit seelischen Problemen und ist tablettensüchtig. Er hält sich selbst für genauso nutzlos wie das ganze Projekt und wundert sich daher, dass ihm seine Mitmenschen nach Gesprächen stets bekunden, wie sehr er ihnen geholfen habe (den Grund dafür können wir im Lauf der Zeit zwischen den Zeilen lesen). Und dann ist da noch die unnahbare Margaret Omali, die Dan verehrt. Sie ist für das Computersystem des Projekts zuständig und kann mit Maschinen wesentlich besser als mit Menschen. Als vermeintlich kalte und sich ihrer Umgebung entziehende Frau finden wir auch in ihr ein typisches Tiptree-Element wieder.
Die letzte Komponente im Dreieck schließlich ist die fremdartigste: ein gigantisches Weltraumwesen, größer als ein Sonnensystem und kaum dichter als das Vakuum. Es ging einst zusammen mit einem Pulk von "Artgenossen" einem zerstörerischen Werk von kosmischen Ausmaßen nach (dessen Hintergrund wir erst gegen Ende des Romans erfahren werden), verließ aber die Formation und zieht nun allein durch die Milchstraße. Auf seinem Weg bringt es Sterne zur Explosion und löscht Planeten voller Leben aus – ohne die Auswirkungen seines Tuns zu verstehen. Es bezeichnet sich selbst als böse, ist auf seine Art aber auch vollkommen unschuldig und entzieht sich letztlich allen moralischen Zuschreibungen. Was aber nichts am Faktum ändert, dass es auf Tyree zusteuert und das schwebende Paradies zu vernichten droht.
Seelenwanderung
In ihrer Verzweiflung beschließen einige Tyrenner zu fliehen. Vor kurzem haben sie geistigen Kontakt mit den irdischen Telepathen aufgenommen, und diese Verbindung nutzen sie nun, um die Entfernung zwischen den Welten zu überbrücken und die Körper der Menschen zu übernehmen. Wie die Körperfresser und doch irgendwie ganz anders. Die Übernahme führt dazu, dass der Geist der Menschen im Gegenzug in die leer gewordenen Tyrennerkörper transferiert wird. Vieles wird sich daher in der Folge darum drehen, wie Menschen und Tyrenner sich nun in einer völlig neuen Umgebung zurechtfinden und mit den dortigen "Eingeborenen" interagieren müssen. Das ist spannend, erscheint mir aber auch nicht ganz ausgegoren. Eigentümlich, dass eine Psychologin die völlige Trennbarkeit von Geist und Körper zum Thema machen kann. "Die Mauern der Welt hoch" weist viele esoterische oder eigentlich gnostische Züge auf.
Lauwarme Aufnahme
Nachdem Tiptree/Sheldon jahrelang bedrängt worden war, doch endlich auch einen Roman zu schreiben, musste sie dann, als er endlich fertig war, den Schlag wegstecken, dass ihn erst mal keiner haben wollte. Tiptree-Biografin Julie Phillips berichtet, dass die Verlage mit Tiptrees Entscheidung unglücklich waren, die Geschichte im Präsens zu erzählen (das werde von den LeserInnen als zu arty-farty aufgenommen). Sie vermutet aber auch, dass das eher eine Ausrede war, weil ihnen der Roman nicht besonders gefiel.
"Die Mauern der Welt hoch" ist ein faszinierendes und absolut lesenswertes Buch – aber es stimmt: mit den besten und zweitbesten Kurzgeschichten aus Tiptrees Schaffen kann es nicht mithalten. Es fehlt ihm deren Kraft, die letztendlich wohl aus der Verdichtung entsprang. Der Roman enthält großartige Passagen – tragikomisch etwa die chaotisch ablaufende Ankunft der Tyrenner in ihren neuen Körpern, berührend der Überlebenskampf auf dem untergehenden Tyree, fesselnd Dans langsamer Weg zum Verständnis seiner selbst. Doch er ist lang und zwischendurch hätte auch so manches gerafft werden können (solche Worte wären einem zu einer Tiptree-Kurzgeschichte nie eingefallen).
Abschließend noch eines: Telepathischer Kontakt zu einem gigantischen Weltraumwesen, das seinen ursprünglichen Auftrag vergessen hat und auf einem Vernichtungszug durch die Galaxis wandert ... kommt das jemand bekannt vor? Richtig, ein Jahr nach "Die Mauern der Welt hoch" erschien "Star Trek: The Motion Picture". Und das erinnert uns daran, was Tiptrees Roman neben all den Dingen, die man über ihn gesagt hat, vor allem ist: sehr, sehr Seventies.
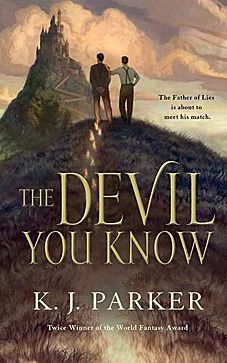
K. J. Parker: "The Devil You Know"
Broschiert, 128 Seiten, Tor.com 2016
Tom Holt alias K. J. Parker war in jüngster Vergangenheit sehr produktiv, was Novellen und ähnliche Kurzformate betrifft. Zwei davon habe ich auf meine Leseliste gesetzt, weil sie mit etwas aufwarten, das in Parkers quasi-renaissancezeitlichem Fantasy-Universum Seltenheitscharakter hat: übernatürliche Elemente. Auf eine dieser Novellen, "Downfall of the Gods", muss ich wohl noch länger warten. Sie ist bei Subterranean Press erschienen, und dort bringt man das E-Book erst dann auf den Markt, wenn die gebundene Deluxe-Ausgabe ausverkauft ist. Aber 40 Dollar für 112 Seiten ... das werde ich bei aller Liebe nicht bezahlen.
Der talentierte Mr. Aristoteles
Die andere, das höchst unterhaltsame Psychoduell "The Devil You Know", ist Teil der großen Novellenoffensive, die der Verlag Tor Books über sein Webportal gestartet hat. Es ist die Geschichte eines faustischen Pakts, der uns ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten beschert: dem aus "Blue and Gold" unvergesslich gebliebenen und in vielen weiteren Erzählungen zitierten Saloninus, dem berühmtesten Gelehrten aus Parkers Welt. Saloninus ist Philosoph, Mathematiker, Künstler und Alchemist – aber auch ein Fälscher, Dieb, Betrüger und Mörder. SF-Kritikerpapst Gary K. Wolfe beschreibt Saloninus mit den herrlich treffenden Worten "der talentierte Mr. Aristoteles".
Saloninus, den sein Lebensmotto "not necessarily believing in your beliefs" weit gebracht hat, wurde durch sein zentrales philosophisches Werk, die "Doctrine of Sides", weltberühmt: Darin argumentierte er unwiderlegbar die Relativität jedes Moralbegriffs. Es gebe weder Gut noch Böse, alles hänge von der Seite ab, auf der man steht. Ironischerweise erfahren wir später, dass diese Doktrin selbst höchst relativ ist. Sie war ein Auftragswerk für einen amoralischen Machthaber und Saloninus hätte das schiere Gegenteil genauso flüssig argumentieren können – bloß hat ihn dafür niemand bezahlt.
Armer Teufel
Sein Widerpart in "The Devil You Know" (mehrdeutiger Titel, und alle Interpretationen sind berechtigt) ist der Teufel. Genauer gesagt ein Teufel bzw. Dämon aus der mittleren Managementebene der Hölle. Die sich übrigens tatsächlich durchaus als Wirtschaftsunternehmen begreift und mit Begriffen wie customer oder department arbeitet. Und von ihrer Rechtsabteilung möglichst wasserdichte Verträge zum Kauf von Seelen ausarbeiten lässt. Aktueller Kunde ist der greise Saloninus, der seine alles andere als unbefleckte Seele gegen 20 Jahre Jugend verpfändet ... 20 Jahre zudem, in denen ihm jeder Wunsch erfüllt werden muss. Das stinkt von Anfang an nach Betrug.
I don't do evil when I'm not on duty, just as prostitutes tend not to have sex on their days off. Mit diesen Worten stellt sich uns der Teufel vor. Parker liebt das Konzept eines unzuverlässigen Erzählers, der die LeserInnen hinters Licht führt – und wer könnte unzuverlässiger sein als der Teufel? Hier erhält der oft verwendete Kniff allerdings einen besonderen Twist: Der Teufel ist nämlich zumindest fürs erste gewillt, den Vertrag auf Punkt und Beistrich genau einzuhalten. Saloninus hingegen ...
Die beiden Hauptfiguren erzählen die Geschichte abwechselnd aus der Ich-Perspektive und mehr als einmal fragt man sich verdutzt, wer denn da gerade spricht bzw. wer also der Teufel ist. "I don't care how mighty or sublime they are, if they've got a personality, they can be understood; if they can be understood, they can be deceived. If they can be deceived, I can deceive them. What can I say? It's a gift. I was born with it. God-given, you might call it." Wer war hier wohl gerade am Wort?
Die Wege des Gelehrten sind unergründlich
Saloninus' Wünsche sind völlig unberechenbar. Erst lässt er sich vom Teufel eine Streitmacht zusammenstellen, mit der er ein unbedeutendes kleines Königreich erobert. Dann lockt er erst den Abschaum der Menschheit und anschließend die bedeutendsten Künstler der Welt (plus eine Schiffsladung Huren) dorthin und formt daraus eine überraschend gut funktionierende utopische Gesellschaft. Zudem lässt er nach Gold schürfen und nimmt seine alchemistischen Experimente von einst wieder auf. Nichts davon scheint Sinn zu ergeben.
Und mit jeder überraschenden Wendung fragt sich der Teufel mit wachsender Verzweiflung, was Saloninus' wahre Absichten sein könnten. Immer wieder versichert er sich selbst, dass der Seelenvertrag kein Hintertürchen hat. Er hält sogar bei seinen höllischen Vorgesetzten Rücksprache – die ihm allerdings nonchalant erklären, dass sie ihn im Regen stehen lassen werden, falls Saloninus tatsächlich einen Weg findet, sich herauszuwinden, und der Deal platzt. Plötzlich geht es also um seine Existenz und spätestens jetzt beginnen wir aus tiefstem Herzen zu empfinden, was die Stones besangen: Sympathy for the devil.
Einfach nur herrlich
Überraschenderweise bin ich – Parker-Premiere! – auf einen Logikfehler gestoßen: In einer Szene wird nämlich erwähnt, dass der Teufel die Zukunft kennt ... wodurch der Großteil der Geschichte hier eigentlich hinfällig würde. Aber naja, niemand ist perfekt. Nicht Parker und vielleicht nicht einmal Saloninus mit all seinen Plänen und Machenschaften – daher schweben wir bis zur letzten Seite im Suspense, welcher der beiden Kontrahenten am Ende obsiegen wird. Das ist so unterhaltsam, wie es überhaupt nur geht. Und ganz locker streut Parker in seine unbedingt empfehlenswerte Novelle auch noch philosophische Konzepte wie die Pascalsche Wette, Platos idealen Staat oder Nietzsches Übermenschen ein: funkelnde Glanzlichter auf einer furiosen Neubearbeitung eines alten Motivs.

John Sandford & Ctein: "Das Objekt"
Broschiert, 571 Seiten, € 17,50, Piper 2016 (Original: "Saturn Run", 2015)
Das dürfte das Prunkstück in diesem Halbjahresprogramm von Pipers neuer SF-Schiene sein. Die Idee zu "Das Objekt" hatte der US-Amerikaner John Roswell Camp alias John Sandford, pulitzerpreisgekrönter Journalist und erfolgreicher Autor von Polizeiromanen. In der Science Fiction war er bislang nicht zuhause, darum holte er sich zwecks fachlicher Unterstützung "Ctein" als Koautor an Bord: Einen hippiesken Physiker, der sich eigentlich auf Fotografie spezialisiert hat und schon so lange unter einem einteiligen Namen durch Kalifornien läuft wie Madonna. Oder vielleicht sogar wie Cher.
Schwerpunktsache
Die Handlung, angesiedelt in den Jahren 2066 bis '68, setzt sich in Gang, als ein kilometerlanges künstliches Objekt ins Sonnensystem einfliegt. Das klingt zunächst einmal reichlich bekannt – denken wir nur an Arthur C. Clarkes "Rendezvous mit Rama" und dessen unzählige Epigonen. Aber Achtung: Sandford & Ctein haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Der Blick auf den Originaltitel hilft dabei: "Saturn Run". Im Mittelpunkt des Romans steht nämlich nicht das außerirdische Objekt selbst, sondern die Mission bzw. die konkurrierenden Missionen der USA und Chinas, die zur Saturnbahn geschickt werden; ihre Planung, Logistik und Durchführung sowie die Improvisierkünste, mit denen unterwegs auf Notlagen reagiert werden muss. Und der ganze politische Zinnober drumherum natürlich auch.
Ziel der Missionen ist genaugenommen nicht das zuerst beobachtete Riesentrumm – das fliegt schon bald wieder ab –, sondern ein anderes künstliches Objekt in den Saturnringen, mit dem es ein Rendezvous hatte. Und trotzdem ist diese vermutlich außerirdische Station nichts anderes als ein großer MacGuffin: Der Erstkontakt, soviel kann man verraten, wird bemerkenswert banal ablaufen. Und um noch einmal extra zu unterstreichen, dass es ihnen nicht um eine klassische First-Contact-Geschichte ging, lassen die beiden Autoren den extraterrestrischen Gesprächspartner auf die Frage "Hast du eine Botschaft an die Menschen?" eine Antwort geben, die manche LeserInnen verärgern mag. Ich fand sie zum Schreien komisch.
Für Technikfreunde
Auf der Rückseite des Buchs steht "Der Bestseller für alle Fans von 'Der Marsianer!" Solche Blurbs sind in der Regel mit Vorsicht zu genießen. Aber so ganz unpassend ist dieser nicht. Wie gesagt, es geht primär um die Technik, die für die Mission gebraucht wird. Und hier kommt von der Hightech-Kamera bis zum VASIMR-Antrieb nichts zum Einsatz, was nicht heute schon zumindest als theoretisches Konzept existiert.
Im Anhang toben sich die Autoren (bzw. wohl hauptsächlich Ctein) noch einmal ausführlich über Reaktionsmassen, Bahnberechnungen, Wärmeableitung usw. aus und schreiben, dass sie wantum mechanics à la "Star Trek" unbedingt vermeiden wollten. Deshalb bleibt der Roman auch trotz großer Kulisse die ganze Zeit spürbar bodenständig. Und wegen diverser Unfälle und Sabotageakte darf auch immer wieder fleißig macgyvert werden, um ein Problem zu lösen: auch das eine Parallele zum "Marsianer".
Das Ensemble
Während Andy Weirs megaerfolgreicher Roman allerdings eine One-Man-Show war, haben wir es hier mit einem Ensemblestück zu tun. Im Grunde sind so viele Quasi-Hauptfiguren im Spiel, dass man kaum weiß, wen man herausgreifen soll. Da hätten wir etwa Sanders Heacock Darlington, den Entdecker des Objekts: ein Millionenerbe, der als Caltech-Praktikant den Ruf eines Bummlers hat – erstaunt erfahren wir, dass er mal einer Armeespezialeinheit angehörte und unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet. Oder Naomi Fang-Castro, Kommandantin einer Raumstation, die die USA kurzerhand zum Fernerkunder umrüsten, um schneller beim Saturn zu sein als die Chinesen. Becca Johnson, eine begnadete Technikerin, die sich trotz püppchenhafter Erscheinung nicht am Zeug flicken lässt, wenn es um ihr Fachgebiet geht. Sie geigt sogar der ewig cholerischen US-Präsidentin Amanda Santeros die Meinung.
Und so weiter und so fort. Im letzten Drittel werden dann auch noch die Angehörigen der chinesischen Mission einzeln vorgestellt, aber so spät habe ich keine Lust mehr, mir neue Charaktere zu notieren. Entweder hätten die Autoren von Anfang an gelegentlich zu Zhang Ming-Hoa & Co switchen müssen – oder auf deren Perspektive auch später verzichten. Eine wirklich überragende Rolle spielt allerdings ohnehin keiner der Beteiligten (nicht einmal der facettenreiche Sanders). Im Wesentlichen dienen die sympathisch und bunt, aber nicht allzu tiefgründig gezeichneten Figuren dazu, munter zu interagieren und schöne Sätze von sich zu geben wie diesen: "Mir scheint, wir haben es hier mit dem ersten echten interplanetaren bürokratischen Clusterfuck zu tun."
Zu viel Denglish, aber sonst sehr fein
Zur Sprache ist anzumerken, dass man bzw. frau ruhig noch das eine oder andere Wort mehr ins Deutsche übertragen hätte können. Offenbar vom Anglizismen-Strudel des handlungsbedingten Technosprechs davongerissen, hat die Übersetzerin des Öfteren auch dort englische Ausdrücke stehen lassen, wo sie nicht notwendig oder angebracht sind: "World-Cup-Soccer-Match" etwa; und ein "gerbil" ist auf Deutsch eine Rennmaus. Und es macht eigentlich auch keinen Sinn, wenn die chinesischen RaumfahrerInnen untereinander [auf Deutsch=Chinesisch] von einer "Elementary School" sprechen oder ihr Raumschiff "Celestial Odyssey" nennen. Das liest sich mitunter, wie sich jene seltsamen Bürokollegen anhören, die einem "Ein schönes Weekend" wünschen. Aufs Ganze besehen, ist das aber nur ein kleiner Abstrich.
In den Kundenbewertungen der Kaufseiten sind die Meinungen offenbar geteilt. Das Wort "langweilig" taucht öfter mal auf, was ich jedoch nicht unterschreiben kann. Es geht eben primär um die technische Durchführbarkeit und letztliche Durchführung eines Hightech-Projekts. Und zwischendurch streuen Sandford & Ctein genug Episoden ein, die das Ganze würzen: tragische (eine der Hauptpersonen stirbt zur Halbzeit), vor allem aber komische. Etwa wenn Präsidentin Santeros wieder einmal vor Wut auszuckt, weil sie gerade erfahren hat, dass sie respektive ihre Regierung unwissentlich Millionen Dollar in eine Studie über die Versorgung der Raumschiffcrew mit weiblichen und männlichen Nutten gepumpt hat.
Der beste Gag des Romans ist allerdings der Name des Pionierschiffs selbst: Weil die USA China und den Rest der Welt so lange wie möglich über den Zweck ihrer Weltraummission schamlos belügen, finden sie einen idealen Namenspatron – und sogar eine beinahe glaubwürdige Begründung für die spätere offizielle Verlautbarung: "In Würdigung des Präsidenten, der als Erster die Amerikaner und Chinesen dazu brachte, in einer aufgeschlossenen, fortschrittlichen Zeit dauerhaft miteinander zu kooperieren, der vor fast hundert Jahren die Schranken niederriss, die unsere Völker viele Jahrzehnte lang trennten, werden wir die USSS-3 in die RICHARD M. NIXON umbenennen." Das hat Klasse.

Bill Schutt & J. R. Finch: "Hell's Gate"
Gebundene Ausgabe, 384 Seiten, William Morrow 2016
Hier tragen Nazis Redshirts: Für seinen Secret-History-Roman um eine deutsch-japanische Geheimbasis im Zweiten Weltkrieg schmeißt das Autorenduo Bill Schutt und J. R. Finch den armen Achsenmächtlern nämlich so ziemlich alles entgegen, was der brasilianische Dschungel an gefährlichen Tieren aufzubieten hat. Sogar ein Candiru kommt hier zum Einsatz. Und wer nicht schon vom Wort allein die Beine zusammenkneift: Das ist dieser Fisch, der vom Uringeruch angelockt wird, wenn man ins Wasser pinkelt, und dann ... *kreisch*
"Hell's Gate" ist der erste Roman einer geplanten Reihe um R. J. MacCready, "den Indiana Jones der Zoologie". Schutt, seines Zeichens Professor für Wirbeltierzoologie und Experte für Fledermäuse, lässt es sich natürlich nicht nehmen, seinen Hauptberuf in seinen ersten Roman einzubringen. Mehrfach beschreibt er in kurzen Intermezzi, wie sich die Ankunft der Menschen in den Augen (oder Nasen, Ohren usw.) der einheimische Tierwelt gestaltet. Darunter sind übrigens auch einige ausgestorbene Spezies. Nachdem der Schauplatz ein Hochplateau in Brasilien ist (das Portão de Inferno, also "Höllentor"), darf man "Hell's Gate" getrost als Hommage an "The Lost World" betrachten. Auch wenn Schutts lebende Fossilien deutlich jünger – und damit auch nicht ganz so unwahrscheinlich – sind wie Arthur Conan Doyles Dinosaurier.
Zur Handlung
1944 hat die US-Regierung Wind davon bekommen, dass hunderte Kilometer landeinwärts im Rio Xingu ein riesiges japanisches U-Boot gefunden wurde; die Besatzung ist offenbar mit einem zweiten weitergezogen. Ein Rangerkommando, das der Sache nachgehen sollte, ist verschwunden, also wirft man kurzerhand MacCready per Fallschirm in der Region ab. Allein! Ein Mann für alle Fälle eben ...
Im Dschungel trifft MacCready nicht nur einen totgeglaubten Akademikerkollegen wieder, er stößt auch auf das Camp Nostromo, in dem Deutsche und Japaner ihrem Projekt zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen nachgehen. Welche das sind bzw. sein werden, haben wir bereits im Prolog erfahren, der zeitlich etwas später angesiedelt ist und in dem ein deutsches Überschallflugzeug über sowjetischen Truppen eine Substanz versprüht, die binnen Minuten tausende Menschen verbluten lässt (die Beschreibungen im Buch sind grimmig detailreich).
Im Grunde dreht sich die ganze Romanhandlung also darum, wie es zu diesem Massaker kam. Eine wichtige Rolle wird dabei die real existiert habende Vampirfledermausart Desmodus draculae spielen, die Schutt allerdings ähnlich umfangreich mit Zusatzfeatures ausstattet wie Steven Spielberg seinerzeit die Velociraptoren.
Ambitioniert
Im ziemlich langen Anhang lassen die beiden Autoren Revue passieren, wie viel Recherche in den Roman eingeflossen ist, insbesondere zum Zweiten Weltkrieg und den Wunderwaffenprogrammen der Nazis. Der Raketeningenieur Eugen Sänger und die Pilotin Hanna Reitsch kommen sogar als Nebenfiguren vor. Die Hauptperson auf Nazi-Seite ist allerdings der fiktive Raketenbauer Maurice Voorhees, der vom Weltraum träumte und stattdessen im zynischen Alltag eines Programms für Massenvernichtungswaffen landete und sich mitschuldig machte: eine erfundene Vita, stellvertretend für eine verlorene Generation von Wissenschaftern.
Voorhees wird mit seiner tragischen Geschichte übrigens eine glaubwürdigere Charakterisierung zuteil als dem Romanhelden. MacCreadys Persönlichkeit wird anfangs zweimal explizit beschrieben: Zum einen sei er ein Zoologie-Enthusiast und zum Leidwesen seiner Umwelt entsprechend mitteilsam, was sein Fachgebiet betrifft ("It was all so interesting.") Zum anderen habe sich nach dem Tod von Mutter und Schwester sein Gemüt verdunkelt. Weder vom einen noch vom anderen ist dann aber viel zu spüren. Stattdessen kommt MacCready seinem Vorbild aus der Archäologie recht nahe und allzuweit ins weite Land der Seele stoßen wir nicht vor.
Ein Lesespaß, wenn auch nicht perfekt
Im Gegensatz zur Recherche, was die NS-Waffenprogramme betrifft, stehen ein paar unnötige Schlampereien. Desmodus draculae wurde erst 40 Jahre später entdeckt und – das ist der eigentlich wichtige Teil – so benannt. Nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand ganz anderes just auf dieselbe Idee gekommen wäre, aber hier heißt das Tier halt auch so. Anderes Beispiel: Die Einheimischen nennen die gruseligen Vampire "Chupacabras". Dieses Wort ist nicht nur bedeutend jünger, als die meisten glauben würden, es ist vor allem Spanisch – im Dschungel von Brasilien hat es also nichts verloren.
Klar sind das Kleinigkeiten, aber sie hätten sich auch leicht bereinigen lassen. Zusammen mit Motiven, die am Schluss des Romans in der Luft hängen bleiben, und einigen kleineren Plotfehlkonstruktionen ergibt das doch den einen oder anderen Abstrich. "Hell's Gate" ist insgesamt um einige Klassen höher anzusiedeln als ein anderer Tierhorror-Roman, der gegen Ende dieser Rundschau noch vorgestellt wird. Luft nach oben wäre aber auch hier noch gewesen.
We have been dreaming for years about penning the proverbial "believable" vampire story, schreiben Schutt und Finch im Anhang. So ganz ist dieser Traum – nicht nur der ihre – also wieder nicht in Erfüllung gegangen. Aber originellerweise lag's diesmal nicht an den Vampiren.
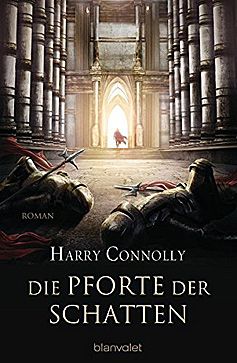
Harry Connolly: "Die Pforte der Schatten"
Broschiert, 608 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2016 (Original: "The Way Into Chaos", 2014)
"Was nun die Ehre betrifft: Krieger gelangen zu Ehre. Soldaten gewinnen Kriege. (...) Soldaten mögen keine fairen Kämpfe. Soldaten nutzen jeden Vorteil, so wie etwa ein hungerndes Kind, das etwas Essbares von einem Karren stiehlt. Und ich sage Euch Folgendes: Man begegnet viel mehr alten Soldaten als alten Kriegern."
Der Einfluss von George R. R. Martin auf die moderne Fantasy ist wirklich nicht hoch genug einzuschätzen. Selbst eine so klassisch gestrickte Epic Fantasy wie die mit diesem Band begonnene Trilogie "The Great Way" von US-Autor Harry Connolly will auf einen Schuss Realismus (andere mögen sagen: Zynismus) nicht mehr verzichten. Und irgendwie macht einem das die ProtagonistInnen paradoxerweise noch sympathischer – wie den alten Haudegen Tejohn, der obige Ansprache zur Motivierung seiner Truppe hält.
Die Ausgangslage
Sein Figurenensemble schöpft Connolly aus einer recht originellen Konstellation, für die es durchaus Entsprechungen in der menschlichen Geschichte gibt. Am Hof von Peradain ist der junge Kronprinz Lar Italga von einem eher speziellen Freundeskreis umgeben: Es sind die Kinder der Herrscher kleinerer Reiche, die Peradain eingegliedert wurden.
Das führt rein menschlich betrachtet zu einer perversen Situation: Zwar sind diese Kinder und Jugendlichen de facto Geiseln und werden von den meisten Einheimischen als potenzielle Feinde betrachtet. Zugleich aber ist der Hof, an dem sie selbst von Dienstboten gemobbt werden (ein eher unglaubwürdiges Detail) ihr einziges Zuhause, und dem Prinzen sind sie in echter Freundschaft zugetan. Auch Lars Braut in spe, die noch kindliche Vilavivianna, steckt in diesem seltsamen Zwiespalt fest. Kein Wunder also, wenn auch zwischen Waffenmeister Tejohn und der jungen Geisel Cazia Misstrauen und Abneigung herrschen – und die beiden werden das heldische Duo des Romans bilden.
Die Pforte öffnet sich
Dass Peradain so erfolgreich expandieren konnte, liegt an einer besonderen Art von Technologietransfer. Alle 23 Jahre öffnet sich am Hof ein Portal, durch das vage, aber in etwa elbisch beschriebene Gäste – das Abendvolk – zu Besuch kommen. Für die veranstaltet man ein mehrtägiges Festival, und wenn sie mit dem Dargebotenen zufrieden sind, hinterlassen sie stets ein Geschenk: Magische Steine für jeden Zweck, ob Wundheilung, Sprachübersetzungen oder Antigravitation – jede Generation erhielt ein anderes. Das Reich ist von diesen Geschenken, die nur von Gelehrten (=Magiern) in der Praxis angewandt werden können, derart abhängig geworden, dass man sogar die Zeitrechnung an den durchnummerierten Geschenken festgemacht hat.
Und jetzt ist es wieder soweit: Der Hof ist in freudiger Erwartung versammelt, die Pforte öffnet sich und heraus strömt statt des Abendvolks ... Connollys einziger echter Fehlgriff. Schön und gut, angriffslustige Riesenyetis, die Menschen durch Bisse ebenfalls verwandeln können, gehen ja noch. Aber müssen sie ausgerechnet fliederfarben sein? Um Himmels Willen! Ich hab mich im Anschluss an diese Szene gleich durch diverses Richard-Corben-Artwork geklickt, bis ich etwas wenigstens ansatzweise Ähnliches gefunden habe, um mir Connollys Wer-Li-La-Launebären halbwegs gruselig vorstellen zu können. Immerhin lösen die eine zombieske Epidemie aus, in deren Verlauf sich das ganze Reich aufzulösen droht.
Retten, was zu retten ist
Nach dieser ersten Attacke geht es zunächst natürlich nur noch darum zu retten, was zu retten ist. Aber Tejohn und Cazia fassen – getrennt voneinander – schon bald weiterreichende Pläne. Er begibt sich Richtung Westen auf die Suche nach einem Gelehrten, der möglicherweise ein Mittel gegen die monströse Epidemie kennt. Sie hingegen bricht in ein Tal im hohen Norden auf, aus dem Legenden zufolge schon seit Generationen immer wieder Wellen neuer Monsterarten ins Reich schwappen. Und wir bekommen damit zwei Questen zum Preis von einer.
Erfreulicherweise gelingt Connolly eine runde Zeichnung beider Hauptfiguren. Cazia erscheint als die typische jugendliche Fantasyheldin – ihre allzu intensive Beschäftigung mit der Magie wird allerdings auch ihre dunkleren Seiten hervorholen. Und der alte Waffenmeister Tejohn zeigt überhaupt die unterschiedlichsten Facetten. Obwohl Kriegsheld, ist er durch ein trauriges Lied, das er einst für das Abendvolk sang, noch berühmter geworden – heute ist ihm das etwas peinlich. Pragmatisch und grundvernünftig bis ins Mark, kann er im Kampf auch in einen Berserkermodus verfallen, der ihn selbst erschrecken würde, wenn sich der Adrenalinschub nicht so gut anfühlte. Und zu alledem ist er – das hat man bei einem Fantasyhelden selten – auch noch kurzsichtig. Irgendwie goldig, wie sich der alte Stratege vor einer Schlacht erst mal von seinen Weggefährten schildern lassen muss, wer wo Aufstellung genommen hat.
Keine Angst vor Spoilern
600 Seiten sind nicht eben kurz, aber Connolly löst das Ganze stets in spannende Einzelsituationen von Kampf, Gefangenschaft und Flucht auf, und so bleibt der schwere Schmöker erstaunlich kurzweilig. Vorwarnung allerdings: Er endet mit einem Cliffhanger. Oder schlichter ausgedrückt: Er hört einfach mittendrin auf. Trilogie, wie gesagt. Und der nächste Teil erscheint auf Deutsch erst im Jänner 2017.
Wie schon öfter bekundet, bleibe ich bei Serien nur in seltenen Ausnahmefällen am Ball, sie würden einfach irgendwann die Lesezeit monopolisieren. Zudem weiß man bei den meisten – mal früher, mal später –, wie sie ticken, und dann will zumindest ich eigentlich nur noch den Schluss wissen. Für die Akten quasi. Ordnungshalber. Ich habe mir seinerzeit verraten lassen, wer der letzte Zylone ist (by the way: richtig getippt). Und zum maßlosen Entsetzen meiner Umgebung hab ich mir neulich auch die Inhaltsangabe und Totenliste der letzten "Game of Thrones"-Folge durchgeschaut, nachdem ich die ganze Staffel dank Senderwechsel nicht sehen konnte.
Das Gleiche hab ich auch hier gemacht, um den Grund für die Monsterinvasion zu erfahren; auf Englisch ist die Trilogie ja bereits vollständig erschienen. Und ich sage nur soviel: Also darauf wäre wohl niemand gekommen.

Greg Bear: "Im Schatten des Saturn"
Broschiert, 431 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "Killing Titan", 2015)
Trotz des deutschen und des Originaltitels, der über dem Mittelteil von Greg Bears "War-Dogs"-Trilogie steht, begeben wir uns erst im kürzeren zweiten Abschnitt des Buchs ins äußere Sonnensystem. Dann allerdings spielt's Granada, wenn wir durchs elektrochemische Getümmel des Ozeans unter Titans Eiskruste tauchen.
Und schon der Weg dorthin hat es in sich: Wir bzw. die Hauptfiguren reisen nämlich an Bord eines Spuker genannten seltsamen Raumschiffs, das vermutlich nicht von Menschen konstruiert wurde und wie ein riesiges Makramee-Kunstwerk anmutet. Und auf dem man sich erst einmal einem bizarren quantenphysikalischen Säuberungsritual unterwerfen muss, wenn man die Niederungen des inneren Sonnensystems hinter sich lassen will: "Sonnenabwärts haben Sie sich noch vor Ihrer Geburt in schlechter Gesellschaft herumgetrieben. Vergangenheiten, die nie gewesen sind, Zukünfte, die nie sein werden. Das alles ist Ballast."
Das ist Greg Bear, wie wir ihn kennen: Der Hard-SF zugehörig, aber metaphysischen Ausflügen, die bis ins Esoterische lappen können, keineswegs abgeneigt. Da fragen sich nicht nur die Romanfiguren manchmal: "Häh?" Das ist – je nach Sichtweise – ein Schritt vor oder zurück nach dem Eröffnungsband "Die Flammen des Mars", mit dem Bear seine aktuelle Trilogie 2014 eingeleitet hatte. Die formal zur Military-SF zu rechnen ist und für die er sich anfangs bemerkenswert zurückgenommen hatte. Aber langsam kommt der alte Bear wieder hervor.
Die Ausgangslage
Zur Erinnerung: Im Sonnensystem haben sich Gurus genannte Außerirdische eingenistet, die als Mentoren der Menschheit auftreten. Sie scheuen sich aber nicht, ihre Schützlinge als Kanonenfutter im seit langer Zeit tobenden Krieg gegen ihre Erzfeinde einzusetzen. Diese Antags wollen angeblich nicht weniger als das ganze Sonnensystem demontieren, um die daraus gewonnene Energie in die Weiten der Milchstraße zu verschicken. Bei einer solchen Steilvorlage stürzen sich die Menschen natürlich bereitwillig für die Gurus in die Schlacht – aber kann man denen wirklich vertrauen?
Im ersten Band war der Mars das Schlachtfeld. Dabei wurde auch ein Fragment eines Eismonds erkundet (und am Ende zerstört), das vor langer Zeit auf dem Roten Planeten abgestürzt ist – und in dem immer noch fremdes Leben wohnt. Die Hauptfigur der Trilogie, Sergeant Michael Venn, ist mit diesem Leben in Kontakt gekommen, und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Er hört in seinem Kopf nicht nur die Stimmen von Kampfgefährten, die im Inneren des Mondfragments zu Tode gekommen sind. Er durchlebt auch höchst realistisch wirkende Träume, in denen er als arthropode Lebensform durch fremde Landschaften zieht. Dieses andere Ich könnte ein Echo der Wesen sein, die vor Milliarden Jahren den Mond bewohnten.
Ausbruch in die Action
"Vielleicht bin ich kein Mensch mehr", denkt Michael. Das fürchten wohl auch die Gurus, denn erst einmal stecken sie ihn nach seiner Rückkehr vom Mars in eine monatelange Quarantäne. Der Roman beginnt damit, wie Michael in seiner Zelle schmort und im Verlauf einiger superkurzer Kapitel ("Noch ein hübscher Tag im Glas") einer Explosion immer näher rückt. Bevor es dazu kommt und bevor ihn die Gurus womöglich sicherheitshalber umbringen lassen, wird er jedoch befreit. Innerhalb des menschlichen Bedienpersonals – jener Institutionen, die direkt mit den Gurus in Kontakt stehen – gibt es nämlich längst unterschiedliche Fraktionen. Und zumindest eine davon hat das Vertrauen in die geheimnisvollen Mentoren verloren.
Konkurrierende Machtblöcke, undurchsichtige Pläne, uralte Zivilisationen und Superwaffen, Tote, die von einer extraterrestrischen Masse absorbiert werden und sich anschließend wieder bei den Lebenden melden: Hier sind einige Elemente im Spiel, die wir auch von der leider fettärschig gewordenen "Expanse"-Reihe von James Corey kennen. Das ist nun die schlankere Version, aber mit Zusatz-Features.
Military-SF mit Tücken
Zur hurrapatriotischen Variante von Military-SF hat die "War-Dogs"-Reihe von Anfang an nicht gehört. Dafür sorgte alleine schon das schleichende Misstrauen der Hautpfiguren gegenüber den Befehlshabern (in Form der Gurus) und damit auch gegenüber der Sinnhaftigkeit des Kriegs an sich. Das unangenehme Gefühl von Fremdbestimmtheit verstärkt sich in diesem Band noch und kehrt als Leitmotiv in allen möglichen Situationen wieder: Etwa wenn Michael sich fragt, wer und was sich denn noch alles in seinem Kopf eingenistet hat. Wenn die Soldaten auf dem Titan vernetzte Schutzanzüge anlegen, die auf höchst invasive Weise die Kontrolle über den Körper des Trägers übernehmen. Oder wenn sie an Bord des Spukers für ein Raumgefecht auf ihre Stationen gerufen werden. Das dann so bizarr und technologisch unverständlich abläuft, dass sich nach geschlagener Schlacht alle fragen, was zum Teufel sie da eigentlich gemacht haben.
Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass Greg Bear mit dem ersten Band der Trilogie voll subversiv eine Falle aufgestellt hat, um Actionfreunde einzufangen und nun sukzessive an Regionen heranzuführen, die noch nie ein Military-SF-Fan zuvor gesehen hat. Aber das ist auf jeden Fall mal eine Trilogie, die sich weiterentwickelt.

Hermann Ritter, Johannes Rüster, Dierk Spreen & Michael Haitel (Hrsg.): "Heute die Welt – morgen das ganze Universum. Rechtsextremismus in der deutschen Gegenwarts-Science-Fiction. Science-Fiction und rechte Populärkultur"
Broschiert, 216 Seiten, € 12,30, p.machinery 2016
Ein kleines bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. Dieser verheißungsvoll aufgemachte Band enthält zwar drei lesenswerte Beiträge zu einem an sich hochspannenden Thema. An der Aktualität, die der ultralange Titel suggeriert, mangelt es aber. Immerhin: Als motiv- und zeitgeschichtliche Betrachtung ist "Heute die Welt – morgen das ganze Universum" empfehlenswert, insbesondere für diejenigen, die sich noch nie mit der Schnittmenge aus Phantastikliteratur, rechter Esoterik und Verschwörungstheorien befasst haben. Dass es eine solche gibt, sollte niemanden überraschen – immerhin basieren alle drei Geschäftsmodelle letztlich auf Dingen, die nicht existieren.
Braune Spuren im Sand
Den Löwenanteil des schmalen Bands nimmt "Die geheime Weltregierung tagt in Tibet" des Historikers, Sozialarbeiters und auch in der Phantastik sehr aktiven Autors Hermann Ritter ein. Das zugleich ein Beispiel dafür ist, wie ein insgesamt sehr interessanter Text darunter leiden kann, wenn eine vergurkte Einleitung ihren Schatten auf ihn wirft. Befremdlich weil völlig entbehrlich ist, dass Ritter binnen einer Seite gleich mehrfach bejammert, was für Schund er hierfür lesen musste und sonst nie in die Hand genommen hätte und irgendwann hätte es ihm damit auch gereicht und so weiter. Ja, was soll man dazu schon sagen? Dann halt ein anderes Thema aussuchen. Quellenstudium ist kein Ponyhof.
Blendet man diese Einstellung, die in weiterer Folge immer wieder aufblitzen wird, aus, hat man eine umfassende Betrachtung jener Traditionslinien vor sich, über die altbekannte Motive zum Teil schon seit der Theosophin Helena Blavatsky aus dem 19. Jahrhundert weitergereicht wurden: Versunkene Superzivilisationen wie Mu, Lemuria und Atlantis und deren erstaunlich frühe Verknüpfung mit Thule und dem "Ariertum", esoterisch verbrämte Herrenmenschengelüste und Verschwörungstheorien über geheime Bünde und Weltregierungen, Hohlwelt- und Welteistheorie, Schwarze Sonne, Reichsflugscheiben und sonstige Superwaffen und so weiter und so fort.
Sachliteratur und Belletristik
Ritter fokussiert dabei primär auf Autoren, deren Werke formal unter Sachliteratur laufen müssten, etwa den Deutschen Jan Udo Holey alias "Jan van Helsing", den Bestsellerproduzenten unter den Verschwörungstheoretikern. Auch der österreichische ehemalige SS-Angehörige Wilhelm Landig, der eine Romantrilogie zum Thule-Mythos schrieb, erhält aber breiten Raum (eine Perle ist dessen etymologische Verknüpfung von "Atlantis" und "Vaterland": Deutsch ist die Erbsprache von Atlantis!). Insgesamt bildet die Belletristik hier aber nur ein Nebenthema. Von weit rechts ausgerichteten Büchern wie denen Landigs abgesehen, geht Ritter nur kurz auf die Vielzahl an Werken ein, die all diese Topoi weitgehend ideologiebefreit als Versatzstücke für Abenteuergeschichten verbraten haben, und nennt beispielsweise Edgar Rice Burroughs und Robert E. Howard.
Spannende Auslassung: Beim Wort "Lemuria" dürfte die erste Assoziation jedes einigermaßen alten deutschsprachigen SF-Fans "Perry Rhodan" sein. Die Serie wird aber nur gegen Ende des Beitrags kurz erwähnt, nämlich in Zusammenhang mit der jüngeren und klar rechtslastigen Serie "Aldebaran". Paradoxerweise liest sich die Stelle dann aber, als hätte "PR" den Lemuria-Mythos erfunden. (Und bevor sich jetzt jemand aufregt: Nein, das soll hier kein Aufwärmen der alten "PR ist faschistoid"-Diskussion aus den 80ern werden, in diesem Fall geht's nur um Motivgeschichte.)
Inhaltlich wie gesagt ein hochinteressanter Beitrag mit beeindruckender Bibliografie. Was die Präsentation anbelangt, hätte es dem Text allerdings gut getan, etwas weniger selbstherrliche Attitüde raushängen zu lassen (Keine Fragen. Setzen.) und einfach die Fakten für sich – und damit gegen die angeführten Autoren – sprechen zu lassen.
Hitler hat den Krieg gewonnen
Einen völlig anderen Zugang zum Thema wählt der Literaturwissenschafter Johannes Rüster, der sich in "Ein Volk, ein Reich und/oder ein Führer?" jenem Segment von Alternativwelterzählungen widmet, in dem der Zweite Weltkrieg respektive die NS-Geschichte einen etwas anderen Verlauf genommen hat: Ein beliebtes Thema vor allem im angloamerikanischen Raum, das in jüngerer Vergangenheit aber auch zunehmend im deutschsprachigen aufgegriffen wurde. Durch die Bank geht es hier nicht um Nazi-Verherrlichungen, sondern um kritische bzw. satirische Betrachtungen – oder auch (siehe "Hellboy" oder "Captain America") einfach nur um solche, in denen NS-Versatzstücke die Ausstattung aufpeppen sollen.
Rüster widmet sich den verschiedenen Varianten des Subgenres, indem er auf jeweils ein oder mehrere Werke etwas ausführlicher eingeht: Hauptsächlich Klassiker wie Robert Harris' "Fatherland" oder Otto Basils "Wenn das der Führer wüsste!", aber auch Neueres wie Oliver Henkels "Im Jahre Ragnarök", in dem das Leben eine nicht enden wollende Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert ist (sehr schöne Charakterisierung). Mehr als ein paar Beispiele herauszugreifen ist auf gut 20 Seiten nicht möglich. Spannend aber der kurz erwähnte Umstand, dass just die Massenvernichtung von Menschen das am wenigsten verwendete Motiv in solchen Alternativweltgeschichten sei: Da würde sich noch eine eingehendere Betrachtung lohnen.
Reichsflugscheiben am Horizont
Der letzte Beitrag, "Rechtsextreme Populärkultur" von Dierk Spreen, ist nichts Neues, er erschien bereits im "Science Fiction Jahr 2009" bei Heyne und ist der berüchtigten Romanserie "Stahlfront" gewidmet, die 2008 bis 2009 erschien und zum Teil auf dem Index landete. Und die ungefähr alles verknüpfte, was Hermann Ritter schon in seiner Motivgeschichte aufgezählt hat: Reichsflugscheiben, geheime Weltverschwörungen, "gute" Nazis in der Antarktis bzw. Neuschwabenland, Esoterik, Gewaltverherrlichung und unverblümten Rassismus.
Der Text ist hier inklusive der gleichen Abbildungen und – sehr gut gewählten! – Originalzitate noch einmal abgedruckt, erweitert um minimale Ergänzungen (etwa zu "Iron Sky") und am Schluss zwei Seiten über den hinter "Stahlfront" stehenden Verleger Hansjoachim Bernt und dessen Strategie, rechtslastige Gewaltfantasien als Ironie zu verharmlosen. Plus dessen auch nicht zu unterschätzender Versuche, die Grenzen zu populären SF-Reihen wie "Perry Rhodan" zu verwischen und sich bzw. sein Verlagskonstrukt Unitall/HJB als Erbe des "Erben des Universums" auszugeben.
Zurück in die Gegenwart
Spreen bezeichnet "Stahlfront" – analog zur Musik von Nazi-Bands – als taktisches Mittel, rechtsextremes Gedankengut in popkulturelle Unterhaltungsangebote einsickern zu lassen und damit neue Zielgruppen anzusprechen. Das ist ein beachtenswertes Thema – allein, "Stahlfront" hat halt schon einige Jahre auf dem Buckel. Wie sieht es heute aus? Wie sind spätere Unitall-Serien wie "Kaiserfront", "Stahlzeit" oder "Anderswelt" einzuschätzen? Ist rechtsextreme SF ein Serien-Phänomen oder gibt es auch eine größere Bandbreite an Einzelromanen? Und konzentriert sich alles Derartige bei Unitall/HJB oder gibt's außerhalb davon noch mehr?
All diese Fragen würden sich für einen aktualisierten Text lohnen, doch bis auf ein kurzes Eingehen auf die Serien "Aldebaran" und "Maddrax" in Ritters Beitrag verharrt "Heute die Welt – morgen das ganze Universum" auf dem Stand von 2009/2010. Dem Titelzusatz "Rechtsextremismus in der deutschen Gegenwarts-Science-Fiction" im Sinne einer umfassenden Betrachtung des Ist-Zustands wird der Band insgesamt nicht gerecht.

Chris Dingess, Matthew Roberts & Owen Gieni: "Manifest Destiny: Band 2. Insecta & Amphibia"
Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 128 Seiten, € 20,60, Cross Cult 2016 (Original: "Manifest Destiny Volume 2: Insecta & Amphibia", 2015)
&
Ivan Brandon & Nic Klein: "Drifter 2: Die Wache"
Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 128 Seiten, € 25,80, Cross Cult 2016 (Original: "Drifter Volume 2: The Wake", 2015)
Gong für die jeweils zweite Ausgabe zweier Mysteries mit exotischen Schauplätzen! Den von Chris Dingess' Secret-History-Reihe "Manifest Destiny" – nämlich die westlichen Regionen Nordamerikas – glauben wir zwar gut zu kennen. Doch die geheimen Tagebücher der berühmten Lewis-und-Clark-Expedition vom Beginn des 19. Jahrhunderts belehren uns eines Besseren. Wenn zu Beginn ein scheinbar normaler Marienkäfer durchs Bild krabbelt und sich erst nach einigen Panels zeigt, dass er die Größe einer Riesenschildkröte hat, lässt sich bereits erahnen, womit wir es in Band 2 zu tun bekommen werden. Ich sage nur: Gelsensaison!
Nach den blutigen Erlebnissen in Band 1 hat sich die zur Hälfte aus freiwillig gemeldeten Soldaten und zur Hälfte aus Sträflingen bestehende Expedition um die Überlebenden des von Pflanzenzombies überrannten Forts La Charrette erweitert. Unter ihnen sind auch einige Frauen, was zu Konflikten führt. Ebenfalls der Expedition angeschlossen hat sich die schoschonische Späherin Sacagewea, deren kompromisslose Kampfkraft noch gebraucht werden wird.
Im Belagerungszustand
Ein bunter Haufen also – und alle zusammen laufen sie mit ihrem Flussschiff auf. Nicht auf einer Sandbank freilich, sondern auf einem weiteren dieser an den Gateway Arch erinnernden natürlichen(?) Felsbögen, von denen im Wilden Westen noch mehr herumzustehen scheinen (da zeichnet sich ein Leitmotiv ab). Die Hälfte der Expeditionsmitglieder ist an Land gegangen, der Rest sitzt auf dem Schiff fest – und zwischen ihnen lauert ein Belagerer in Form einer vielzüngigen Riesenkröte. Den Mega-Marienkäfer hatte man noch stoisch mit "Ungewöhnlich" kommentiert. Dieses neue Monster wird schon etwas mehr Aufmerksamkeit verlangen.
Sehr hübsch, wenn Illustrator Matthew Roberts ein angstverzerrtes Gesicht in einem riesigen Facettenauge spiegelt. Und das Papier kreischt geradezu, wenn Colorist Owen Gieni vom häufig verwendeten Steampunk-Sepia zu Blutrot wechselt, als Captain Lewis den letzten Einsatz von Captain Ahab nachstellt. Neben der etablierten Optik behält "Manifest Destiny" aber auch sein inhaltliches Grundmotiv bei, die Diskrepanz von Sein und Schein. Da lesen wir etwa in Lewis' Aufzeichnungen ein Loblied auf die Tapferkeit seiner Männer, während parallel dazu einer davon eine Frau vergewaltigt. Und auch zum Leitungsduo der Expedition selbst erhalten wir durch Rückblenden neue Einblicke: Offenbar ist Lewis nicht ganz das zarte Gelehrtenpflänzchen, als das er sich bislang präsentierte, ebensowenig wie Clark der unerschütterliche Haudrauf ist. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergehen wird. Und was hat es bloß mit diesen verdammten Bögen auf sich?
Hier gibt es viel zu sehen ...
Erheblich weniger leicht zugänglich ist die SF-Mystery "Drifter" von Ivan Brandon & Nic Klein, und das hat sich gegenüber dem ersten Band der Reihe ("Crash") sogar noch verstärkt. Darin legte der Raumfahrer Abram Pollux eine Bruchlandung auf einem abgelegenen Planeten hin, wo er sich im Western-artigen Ambiente einer Pioniersiedlung wiederfand, die sich Menschen mit tendenziell dämonisch aussehenden Aliens teilen. Abrams Erlebnisse dort geraten zusehends zum Psychotrip.
In Teil 2 stellen die von Ressourcenknappheit geplagten SiedlerInnen von Ghost Town eine Expedition zusammen, um weitere Teile von Abrams Schiffswrack zu finden. Das führt sie auf die Nachtseite des Planeten – und beschert uns ein fantastisches zweiseitiges Panorama in Indigo und roter Biolumineszenz, durch das bleiche Pterodactylen schweben (erinnern mich ein bisschen an die Betonpapageien aus dem "Incal"). Der zielsicher eingesetzte Farbenrausch von Illustrator Nic Klein bleibt die Hauptattraktion der "Drifter"-Reihe. Am Ende läuft er in Sachen großformatige Bilder zu buchstäblich explosiver Hochform auf.
... bitte rätseln Sie weiter
Währenddessen schmort Marshal Lee Carter daheim in Ghost Town im eigenen Saft, nachdem ihr Assistent ermordet wurde und sie den Täter gerichtet hat. Schuld und Sühne sind ein wichtiges Thema in "Drifter". Nimmt man dazu die Wheeler genannten Aliens mit ihren glühenden "Teufelsaugen" und die seltsame graue Eminenz von Ghost Town – der Mann in der Dunkelheit mit seinem nebelartig wabernden Nicht-Gesicht –, dann könnte man durchaus auf die Idee verfallen, dass diese Welt eine Art Limbus oder Purgatorium darstellt. Dass der Zeitverlauf in ihr nicht verlässlich ist und mehrere Figuren unter unerklärlichen Gedächtnislücken leiden, verstärkt den Eindruck noch. "Du hast verloren, was du bist", sagt ein Wheeler zu Abram.
Band 1 endete mit einem spektakulären Cliffhanger. Der wird hier aber nicht etwa aufgeklärt – stattdessen endet auch Teil 2 mit einem, und zwar einem auf gewisse Weise ähnlichen. Ist der Name der Welt – Ouro – doch nicht zufällig gewählt und sollen wir im Geist -boros ergänzen, weil sich das Ende in den Anfang kehrt? Nach den ersten beiden Bänden macht die "Drifter"-Reihe einen rätselhaften, geradezu hermetischen Eindruck. Sie wirkt aber auch wie etwas, bei dem sich am Ende alles zu einer passgenauen Konstruktion zusammenfügen wird. Bis dahin rauchen die Köpfe.

Thomas E. Sniegoski: "Savage"
Gebundene Ausgabe, 416 Seiten, Simon Pulse 2016
Ein Fall von: Na schön, hab ich's schon mal gelesen, dann erwähn ich's halt auch in der Rundschau. Wie langjährige LeserInnen wissen, kann ich Tier-Apokalypsen nicht widerstehen. Nicht einmal dann, wenn sie von einem Fließbandautor wie Thomas E. Sniegoski stammen, der schon für alle möglichen Franchises gearbeitet hat. Und der offenbar auch dann nicht über seine Schreibe hinauswächst, wenn er endlich mal – wie hier – eine Welt selbst entwerfen darf.
"Savage" beginnt damit, dass ein Wissenschafterteam in einem Luxus-Resort auf einer Pazifikinsel eintrifft, auf der bis auf ein panisches kleines Mädchen alle Menschen und Tiere tot sind. Aus den Gesprächen der Forscher deutet sich an, dass es nicht das erste Vorkommnis dieser Art war – und dass sich das nächste bereits abzeichnet.
Wieder und wieder und wieder
... womit wir nach Benediction Island schwenken, eine kleine Insel vor der US-Ostküste und Schauplatz des restlichen Romans. Dort lernen wir erst mal der Reihe nach einige InsulanerInnen kennen, allen voran Sidney Moore, die gerade die Highschool abgeschlossen hat und den Umzug nach Boston plant. Stattdessen wird sie sich schon bald zusammen mit ihrem Ex Rich, dem gemeinsamen Freund Cody und dem hörbehinderten Nachbarssohn Isaac durchs Gelände schlagen müssen, während die Inselbevölkerung von der lokalen Fauna dezimiert wird. Insekten, Spinnen und ähnliches Krabbelgetier machen den Anfang. Es folgen Hunde, Katzen, Eichhörnchen, Möwen, kurz: alles, was ein Ökosystem im östlichen Nordamerika hergibt. Jede Menge Gore und Graus sind garantiert.
Die erste Attacke kommt so früh im Buch, dass man es nicht für möglich hält, Sniegoski könnte noch fast 400 Seiten so weiter machen. Doch das tut er! Abgesehen von einem finalen Showdown (der die Geschichte allerdings flugs vom B- zum C-Movie herunterstuft) besteht die komplette Handlung aus einer tierischen Angriffswelle nach der anderen. Das liest man mit ähnlich befremdeter Faszination, wie man sich als Schnellduscher über jemanden wundert, der jeden Tag eine Stunde unterm Wasser stehen kann. Hier haben wir es halt mit einer Dusche aus Wanzen, Wespen und Waschbären zu tun.
Auch stilistisch ist Sniegoski als One-Trick-Pony unterwegs: Jedes der Kapitel endet mit einem Cliffhanger in einer lebensbedrohlichen Situation. Und ganz besonders gerne setzt Sniegoski einen bedeutungsschwangeren kurzen Satz ans Ende, damit auch noch der letzte kapiert, wie gravierend das alles grade ist. Auf Dauer wird dieses Muster ordentlich überstrapaziert.
Ein kleiner Sommerschauder
Elegant ist das nicht, spannend irgendwie schon. Und natürlich rätselt man, welcher Effekt denn da die Tiere gegen die Menschen aufhetzt und sich in Form eines metallischen Films über dem rechten Auge sogar physisch manifestiert. Ist es eine Alien-Attacke? Ein Regierungsprojekt? Dämonen aus der Hölle? Gaias Rache an ihren destruktiven Kindern? Wildgewordene Nanotechnologie? Die Meister der Insel? Das wird beantwortet werden, da aber offenbar Sequels geplant sind, bleiben am Schluss einige andere Fragen offen. Allen voran die, die vermutlich nie beantwortet werden wird: Wäre es nicht viel ökonomischer, wenn der mysteriöse Angreifer seine Waffe, die offenbar eh bei jeder Spezies vom Arthropoden bis zum Wirbeltier funktioniert, gleich auf Menschen kalibrieren würde?
"Savage" ist ein typisches Buch für den Strand und auf seine simple – wirklich simple – Art durchaus fesselnd. Zwischendurch wird man vielleicht einen skeptischen Blick auf den Hund des Nachbarn oder die Möwen am Himmel werfen. Aber besser nicht zu lange ablenken lassen, sonst hat man das Buch schon vergessen, während man's noch in der Hand hält.
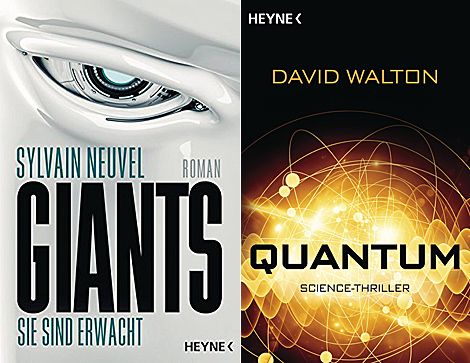
Sylvain Neuvel: "Giants. Sie sind erwacht"
Broschiert, 416 Seiten, € 15,50, Heyne 2016 (Original: "Sleeping Giants", 2016)
&
David Walton: "Quantum"
Broschiert, 384 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "Superposition", 2015)
Das ging ja ruckizucki! Erst in der letzten Rundschau habe ich die Originalausgabe von Sylvain Neuvels "Sleeping Giants" besprochen, und da war das Buch noch ziemlich neu. Trotzdem soll die deutsche Übersetzung schon in einer Woche erscheinen. Lohnt sich! Es ist die perfekte Sommerlektüre – leicht zu lesen, trotzdem nicht geistlos.
Nur kurz zur Erinnerung: Der Roman dreht sich darum, dass über die ganze Erde verstreut Teile eines offenbar nicht von Menschen gebauten Riesenroboters gefunden und Stück für Stück zusammengebaut werden ... unter verschwörungstheoretischen Umständen. Wir dürfen nicht nur rätseln, wer das vermeintlich von der US-Regierung geleitete Projekt wirklich vorantreibt, sondern auch, was der ursprüngliche Zweck des Roboters war. Die ausführliche Rezension des à la "World War Z" in Interviews und Dokumenten erzählten Mecha-Romans steht hier.
Doppelungen
Ziemlich genau in derselben literarischen Preisklasse wie "Giants" spielt David Waltons "Quantum", mit Erstveröffentlichungsjahr 2015 auch noch recht frisch und ebenfalls bereits in einer Rundschau besprochen (siehe hier). Hier bekommen es die Romanfiguren mit Doppelgängern ihrer selbst zu tun, weil ein Wissenschafter das Tor in die Quantenwelt geöffnet hat und deren dem Hausverstand widersprechende Effekte nun auch auf die Makrowelt übergreifen. Um sicherzugehen, dass sein Roman spannend genug ist, hat Walton auch noch intelligente Bewohner der Quantenwelt erfunden. Die statten uns nun einen Besuch ab. Und sie sind schlecht gelaunt.
"Giants" und "Quantum": Zwei SF-Abenteuer, die schlicht und einfach Spaß machen. Beide Romane sind übrigens jeweils der Start einer Reihe. Warten wir mal ab, ob sie das auch im Deutschen sein werden oder ob auch sie auf dem immer größer werdenden Verlagshaufen des Mittendrinabgebrochenen landen. We'll always have English, of course.
In der nächsten Rundschau brechen wir vom Weltraumbahnhof von Tel Aviv aus in unbekannte Regionen auf. Dort begegnen wir unter anderem einem Mann, der ein Universum ganz für sich allein hat, und der (nicht nur im übertragenen Sinne) unsterblichen Marlene Dietrich. (Josefson, 30. 7. 2016)