
Linda Nagata: "The Red: Morgengrauen"
Broschiert, 520 Seiten, € 16,50, Cross Cult 2016 (Original: "The Red: First Light", 2013/15)
Nnedi Okorafor: "Lagune"
Broschiert, 370 Seiten, € 18,60, Cross Cult 2016 (Original: "Lagoon", 2014/15)
Carolyn Ives Gilman: "Dunkle Materie"
Broschiert, 450 Seiten, € 14,40, Cross Cult 2016 (Original: "Dark Orbit", 2015)
Was hochqualitative Science-Fiction-Romane in deutscher Übersetzung betrifft, ist es ein goldener Herbst. In einem Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen rittern derzeit drei Verlage darum, wer das anspruchsvollste Saisonprogramm hat: Der Fischer-Verlag mit seiner brandneuen SF-Schiene Tor, der langjährige Branchenprimus Heyne mit einem nach längerem Schwächeln aktuell wiedererstarkten Angebot und Cross Cult, der Verlag für Comics und mehr.
Und dieses "mehr" wird bei Cross Cult tatsächlich immer mehr. Zu Vernor Vinges "Das Ende des Regenbogens" (kommt demnächst) und Connie Willis' Zeitreise-Dilogie "Dunkelheit/Licht" (steht Anfang 2017 an) gesellen sich diese drei Romane. Da hier schon deren jeweilige Originalausgaben besprochen wurden (skurrilerweise alle drei in derselben Rundschau), reicht an dieser Stelle eine kurze Noch-mal-Vorstellung. Bei jedem Buch führt ein Link zur ausführlichen Rezension von damals.
1) "Morgengrauen"
Mit "The Red" hat US-Autorin Linda Nagata die vielleicht beste Military-SF-Reihe der vergangenen Jahre vorgelegt. Angesiedelt in einer nahen Zukunft, in der Konzerne mehr Einfluss auf die Weltpolitik haben als staatliche Regierungen, werden kleine Militäreinheiten wie die von Lieutenant James Shelley von Krisenschauplatz zu Krisenschauplatz geschickt. Durch Implantate sind die technisch hochgerüsteten SoldatInnen untereinander und mit ihrer Einsatzleitung vernetzt. In Shelleys Feed schaltet sich aber immer wieder auch eine mysteriöse Entität ein, die ihn vor Gefahren zu warnen scheint: "The Red".
Shelley vermutet, dass irgendeine Künstliche Intelligenz dahintersteckt. Aber was sind deren Pläne? Warum speist sie seine Kampferlebnisse als Soap-Opera in die öffentlichen Kanäle ein – und ist sie ihm wirklich so freundlich gesinnt, wie es auf den ersten Blick scheint? Hier kommen alle auf ihre Kosten: Technik- und Action-Fans ebenso wie solche, die eine kritische Beleuchtung von politischem Zynismus oder gutes altes Human Drama schätzen. Und zu alledem kommt auch noch eine gehörige Portion Paranoia. Sehr empfehlenswert! Teil 2 soll auf Deutsch übrigens im Februar folgen.
2) "Lagune"
In der Bucht vor Lagos geht ein außerirdisches Raumschiff nieder und spuckt nicht nur eine Botschafterin mit der Fähigkeit zum Gestaltwandeln aus, sondern beginnt auch auf seine Umgebung Einfluss zu nehmen. Die Meeresfauna ist als erste betroffen, aber bald steppt auch an Land der Bär. Ähnlich wie in der deutschen Erstkontakt-Reihe "Biom Alpha" prallen hier nämlich die unterschiedlichsten Interessengruppen aufeinander: Jeder hat seine eigenen Vorstellungen davon, was hinter dem Besuch aus dem All steckt, und jeder will sein Stück vom außerirdischen Kuchen haben.
Nnedi Okorafor, eine US-Amerikanerin mit nigerianischen Wurzeln, zählt zu den derzeit meistdekorierten SF-AutorInnen, da sie eine ganz neue Stimme ins Genre eingebracht hat und vor schreiberischer Fantasie nur so übersprudelt. Die Kehrseite der Medaille ist zwar, dass sie vor lauter Eifer mitunter den erzählerischen Faden verliert. Das spielt in "Lagune" ("Lagoon") allerdings eine geringere Rolle als in anderen Werken. Denn in dieser bunten Mischung aus Science Fiction und westafrikanischer Mythologie ist fröhliches Chaos das eigentliche Thema.
3) "Dunkle Materie"
Auf den Spuren Ursula K. Le Guins schließlich wandelt die dritte Autorin dieses Dreierpacks, Carolyn Ives Gilman. Mit "Dark Orbit" hat die Autorin, die ebenfalls aus den USA kommt, ein faszinierendes Planetenabenteuer vor dem Hintergrund einer von Menschen besiedelten Galaxie abgeliefert. Die diversen Seitenzweige der Menschheit haben sich kulturell weit genug voneinander entfernt, dass die Mitglieder der divers zusammengesetzten Expedition zur Kristallwelt Iris im Umgang miteinander einige Mühe haben.
Die Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund unterschiedlicher Weltbilder verblassen aber angesichts der Herausforderung, die sich auf Iris selbst stellt. Auch dort leben nämlich Menschen – allerdings in vollkommener Dunkelheit. Der Kontakt zu ihnen zeigt, wie unterschiedlich man die Welt wirklich wahrnehmen kann. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die vermeintlich zurückgebliebenen HöhlenbewohnerInnen über Möglichkeiten verfügen, von denen man draußen in der hochtechnisierten Galaxis nur träumen konnte.
Drei Titel, alle vor Kurzem erst erschienen, jeder empfehlenswert.
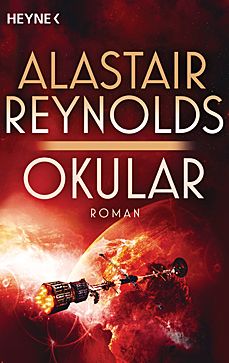
Alastair Reynolds: "Okular"
Broschiert, 810 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "Blue Remembered Earth", 2012)
Alastair Reynolds, einstmals ein Eckpfeiler im SF-Programm von Heyne, ist nach mehrjähriger Pause zurückgekehrt – und zwar mit Karacho! In seinem jüngsten Roman, dem zusammen mit seinem britischen Landsmann Stephen Baxter geschriebenen "The Medusa Chronicles", ist noch die Druckerschwärze feucht, und schon liegt die deutsche Übersetzung vor (kommt in der nächsten Rundschau). Zeitgleich ist nun endlich auch das umfassende Zukunftspanorama "Blue Remembered Earth" auf Deutsch erschienen. Das darauf aufbauende "On the Steel Breeze" ist für März unter dem Titel "Duplikat" angekündigt.
Gleich der Prolog von "Okular" führt uns vor Augen, wie sehr wir Reynolds vermisst haben. Im Osten Afrikas stoßen die beiden Geschwister Geoffrey und Sunday Akinya auf einen vergrabenen Panzer mit Künstlicher Intelligenz: ein Relikt aus einem Zeitalter, als es noch Kriege gab. Es ist ein stimmungsvoller Einstieg, in dem sich das Ende der Kindheit und damit auch der Unschuld andeutet.
Sicherheit durch Überwachung
Für die Haupthandlung springen wir ein Stück in die Zukunft. Geoffrey und Sunday sind mittlerweile – wir schreiben die 2160er Jahre – erwachsen, gelten aber immer noch als die Sorgenkinder ihrer Familie. Denn während der übers ganze Sonnensystem verstreute Akinya-Clan eines der mächtigsten und innovativsten Wirtschaftsimperien seiner Zeit leitet, gehen die beiden ihren Hobbys nach und wollen mit der Firmenpolitik nichts zu tun haben. Geoffrey etwa studiert Elefanten, führt ein Einsiedlerleben und reagiert auf Kontakte aus dem geldversessenen Teil der Verwandtschaft ausgesprochen griesgrämig – was überhaupt seine grundlegende Einstellung zur Welt zu sein scheint. Aber er wird sich noch wandeln.
Sunday indes lebt in der Überwachungsfreien Zone auf der Rückseite des Mondes: einem anarchistischen Sammelbecken kreativer Geister und gesellschaftlichen Experimentierfeld, in dem die Wahrung der Privatsphäre an oberster Stelle steht. Ganz anders als im Rest des Sonnensystems, insbesondere auf der Erde – der Überwachten Welt. Die Obligatorischen Implantate merzen kriminelle Neigungen im Gehirn, soweit erkennbar, schon von Kindheit an aus. Den Rest erledigen die Myriaden Kameraaugen des Mechanismus, der jede potenzielle Bedrohung eines Menschen vorausberechnen und fast immer auch beseitigen kann. "Wir leben zwar alle in einem totalitären Staat, aber es ist fast immer eine freundliche, wohlwollende Diktatur. Sie erlaubt uns nahezu alles, ausgenommen Opfer von Unfällen zu werden und Verbrechen zu begehen."
Die Reise beginnt
Eines Tages ereilt Geoffrey die Nachricht, dass seine Großmutter gestorben ist. Eunice Akinya legte einst den Grundstein des Familienimperiums: Eine Visionärin und Pionierin ... auch wenn Geoffrey sie eher als kalte und gebieterische Schreckschraube in Erinnerung hat, die sich nicht um ihre Enkelkinder kümmerte und die letzten Jahrzehnte ihres Lebens allein in einer Mini-Raumstation um den Mond kreiste.
Geoffreys Cousins fürchten, dass die systemweit berühmte Firmengründerin eine Leiche im Keller liegen haben könnte. Sie haben nämlich von der Existenz eines Schließfachs in einer Bank auf dem Mond erfahren und wollen Geoffrey nun dafür bezahlen, dort einmal nachzusehen. Da er unter chronischem Geldmangel leidet, willigt er nolens volens ein – auch wenn er bislang kaum seine tansanische Heimat verlassen und höchstens von der Möglichkeit des Chingens Gebrauch gemacht hat, einem Bewusstseinstransfer in robotische Ersatzkörper an anderen Orten. Jetzt aber heißt es in Fleisch und Blut auf Reisen zu gehen.
Es ist der Beginn eines Trips, der Geoffrey und bald auch Sunday an die verschiedensten Orte führen wird, ob Mond, Mars, Phobos oder darüber hinaus. Geleitet werden sie dabei stets von kryptischen Hinweisen, die Großmutter Eunice ihnen hinterlassen hat (als erstes übrigens den Handschuh eines alten Weltraumanzugs). Kurz gesagt: "Okular" hat die Struktur einer guten alten Schnitzeljagd! Und während sich die beiden von Etappenziel zu Etappenziel weiterhangeln, dürfen sie – und wir mit ihnen – rätseln, welches Geheimnis Eunice da vor der Öffentlichkeit verbergen wollte.
Die neue Welt
"Okular" weist einige unverkennbare Parallelen zu Kim Stanley Robinsons "2312" auf (und ist wie dieses ein wenig gar lang geraten, aber zum Glück weniger prätentiös). Es ist eine Rundreise durchs Sonnensystem, voller Gedanken über Technologie und Kultur, Evolution, Klimawandel und Politik. Wir lernen in allen Facetten eine Zivilisation kennen, die sich vom Erbe unseres Zeitalters erholt hat – wenn auch um den Preis der allumfassenden Überwachung und mit neuen Machtkonstellationen: Europa und Nordamerika werden hier kaum erwähnt, die neuen kulturellen und technologischen Großmächte sind China, Indien und vor allen anderen das vereinigte Afrika. Zudem verläuft eine Trennlinie zwischen den bisherigen Staaten und den Vereinten Wasser-Nationen, die auf künstlichen Archipelen entstanden sind.
Der Besuch in einer solchen Wasserstadt voller genetisch veränderter Menschen ist ein spektakuläres Highlight des Romans. Andere originelle Ideen sind beispielsweise Geoffreys cybertelepathische Kommunikationsversuche mit einer Elefantin oder das Evolvarium: ein sich selbst überlassenes evolutionäres Schlachtfeld auf dem Mars, auf dem selbstreplizierende Roboter sich im Überlebenskampf ständig weiterentwickeln. Menschen beobachten diese "Robot Wars" vom Rand aus und schöpfen brauchbare Innovationen, die die Roboterevolution hervorbringt, gewinnbringend ab. Und auf der Mondoberfläche liegt die gute alte ISS herum – mittlerweile ein Restaurant.
Zurücklehnen und genießen
Reynolds versteht es, uns diese Reise genießen zu lassen – wie Geoffrey es bei seiner zeitweiligen Rückkehr zur Erde tut: Er war vollkommen damit zufrieden, sich auf dieser Parkbank zurückzulehnen und mit den Augen den sechs Gitarrensaiten des Weltraumaufzugs zu folgen, die sich himmelwärts schwangen und wie zur präzisen Demonstration einer Fluchtpunktperspektive im Nichts zusammenliefen. Gondeln glitten wie meniskusförmige schwarze Öltropfen an den Drähten auf und ab. Brandungswellen brachen sich mit niemals endendem monotonem Schlagzeuggeschmetter an der Seemauer der Halbinsel. Möwen schossen durch sein Blickfeld, blendend weiße vogelförmige Fenster in eine andere, reinere Schöpfung.
Die wahren Abenteuer sind eben im Kopf, man muss sie nur zu erzählen verstehen. Dazu passend ein Gespräch zwischen Sunday und einer virtuellen Konstruktion ihrer Oma über die langen Weltraumaufenthalte in den frühen Tagen der Raumfahrt: "Wie habt ihr euch ... die Zeit vertrieben?", fragte Sunday. "Ich nehme an, ihr konntet euch nicht einfach nach draußen chingen." – "Wir hatten eine andere Form des Chingens", sagte Eunice. "Eine Frühform der virtuellen Realität, die viel robuster und von Zeitverzögerungen vollkommen unberührt war. Du hast vielleicht davon gehört. Wir nannten es 'Lesen'."

Wesley Chu: "Die Leben des Tao"
Broschiert, 430 Seiten, € 10,30, Fischer Tor 2016 (Original: "The Lives of Tao", 2013)
"Intruders" trifft die Trill von "Deep Space Nine", hatte ich mir notiert. Kinofilme statt TV-Serien zog ein anderer Leser heran und schrieb: "Kung Fu Panda vs. Bodysnatchers". Auch nicht schlecht getroffen, dachte ich mir – wenn auch ein bisschen gemein. Treffen wir uns in der Mitte und sagen: "Die Leben des Tao", das preisgekrönte Romandebüt des taiwanesischen Autors Wesley Chu, ist der kleine Bruder von Claire Norths "Die vielen Leben des Harry August".
In vergnügter Form treffen hier ein paar altbewährte Plotmuster der Phantastik aufeinander: Secret History, also die nachträgliche Uminterpretation von Ereignissen der Weltgeschichte (von den mongolischen Eroberungszügen über die Spanische Inquisition bis zum Großen Brand von Chicago 1871 wird hier so ziemlich alles in einen neuen Kontext gestellt). Außerirdische Infiltration der Menschheit. Und vor allem die gute alte Formel: "Einer von uns", ein Stinknormalo, wird unversehens in Ereignisse, die die Geschicke der Welt bestimmen, hineingezogen.
Zur Ausgangslage
Irgendwann im Dinosaurierzeitalter (bei Chus Erklärungen hierzu blättert man besser schnell weiter) sind die außerirdischen Quasing auf der Erde notgelandet. Als gasförmige Wesen können sie in unserer Atmosphäre nicht überleben. Aber sie können in irdische Organismen einsickern und als Symbionten/Parasiten weiterexistieren. Stirbt der Wirt, wechselt der Quasing zum nächsten, behält aber die Erinnerungen an sein früheres Leben – wie gesagt: ganz ähnlich den Trill.
Über die Jahrmillionen haben sie sich von Tierart zu Tierart weitergeschleppt, bis sie mit der Intelligentwerdung des Menschen einen neuen bevorzugten Wirt gefunden haben. Seitdem lenken sie die Geschicke der Menschheit kräftig mit – nicht zuletzt deshalb, weil sie sich erhoffen, dass unsere Zivilisation irgendwann einen technologischen Stand erreicht, der ihnen die Heimkehr ermöglicht. Unter den vielen Beispielen von Geheimgesellschaften und außerirdischen Infiltratoren, die man hier aus der SF-Geschichte anführen könnte, sollte man daher auf eines ganz besonders hinweisen: Isaac Asimovs "Does a Bee Care?" aus dem Jahr 1957, in dem ein einzelnes Wesen die Menschheit in vergleichbarer Weise für sich nutzt (in dem Fall mit besorgniserregenden Implikationen am Ende).
Zwei Parteien
Und weil ein süffiges Romanszenario auch einen Konflikt braucht, haben sich die Quasing im Lauf der Zeit in zwei Fraktionen aufgespalten: Die Genjix, die analog zu den Schatten von "Babylon 5" der Meinung sind, Fortschritt gebe es nur durch Krieg, und die etwas humaneren Prophus. Wobei "human" relativ ist, allzuviele Skrupel haben nämlich auch die Prophus nicht. Überhaupt ist den quasi-unsterblichen Wesen kein Hauch von millionenjähriger Weisheit anzumerken.
Stattdessen wirken sie erstaunlich kindisch, wenn sie wechselseitig ihre Projekte sabotieren, als würden sie einander Streiche spielen ... Streiche, die halt gelegentlich in Massenmord ausarten. Die mitunter groteske Konstellation bringt ein "Dezennalien" genanntes Treffen der beiden Parteien auf den Punkt, das wie jede normale Convention in einem Hotel stattfindet, neben den üblichen Panels, Meet-and-Greet-Zeremonien und geselligen Besäufnissen aber auch Mord und Totschlag auf dem Programm hat, wann immer sich eine Gelegenheit auftut.
Im Wirt von nebenan
Ein solcher Sabotageeinsatz steht am Beginn des Romans, und in dessen Verlauf verliert Titelfigur Tao, ein Prophus, seinen Wirt. In höchster Not bleibt keine Gelegenheit, auf einen der üblichen Ersatzwirte zurückzugreifen, die für diese "Ehre" über Jahre hinweg ausgebildet oder sogar gezüchtet werden. Stattdessen – unglamouröser geht es nicht – schlüpft Tao in den fetten Nerd Roen Tan, als sich dieser nach einer durchzechten Nacht grade zum Kotzen aus dem Auto beugt. Noch absurder wird sich übrigens die Situation gestalten, in der sich Tao dann seinem neuen "Gefäß" zum ersten Mal offenbart.
Armer Roen. Kaum hat er sich an eine zweite Stimme in seinem Kopf gewöhnt, erklärt ihm diese auch schon, dass er nun eine wichtige Aufgabe in einem globalen Konflikt spielen soll. Es folgt – ausführlich beschrieben – Roens Umkrempelung vom Couch-Potato mit dem Bewegungsgeschick einer schwangeren Kuh zum kampftauglichen Agenten (siehe obige "Kung Fu Panda"-Assoziation). Trainerin Sonya kennt kein Erbarmen und bläut Roen Martial-Arts und Waffengebrauch ebenso ein wie den übrigen supergeheimen Agentenkram.
Unterhaltungsfaktor
Derlei flapsige Formulierungen sind übrigens typisch für den Roman, der sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Roen und Tao kabbeln sich das ganze Buch hindurch wie ein altes Ehepaar, als Running Gag führt Chu zudem immer wieder die Finanzlage der Quasing ins Treffen. Anders als es das Klischee von Geheimgesellschaften mit unbegrenzten Mitteln will, müssen Genjix und Prophus nämlich stets kalkulieren. Was für Roen unter anderem bedeutet, dass sich das "Agentenauto", auf das er sich schon so gefreut hatte, als Fiat entpuppt.
Action, Humor und Jugendtauglichkeit lautet die Devise für "Die Leben des Tao". Grundlegende Fragen klingen erst zaghaft an – vor allem die eine, ob möglicherweise nicht die Genjix das Übel der Welt sind, sondern die Anwesenheit beider Gruppen an sich. Wir dürfen gespannt sein, ob Roen seine Loyalität gegenüber den "Guten" noch überdenken wird. Teil 2, "Die Tode des Tao", erscheint bereits in wenigen Wochen.
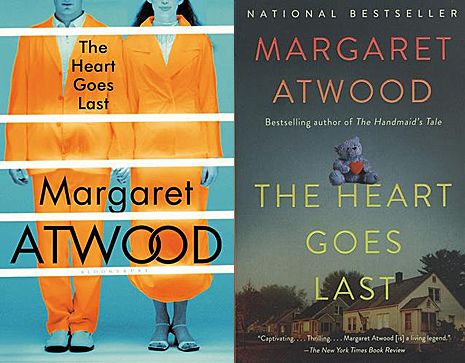
Margaret Atwood: "The Heart Goes Last"
Gebundene Ausgabe, 308 Seiten, Bloomsbury 2015 bzw.
Broschiert, 400 Seiten, Anchor 2016
Im Oktober hat die große Margaret Atwood ihren jüngsten Roman "Hag-Seed" veröffentlicht, eine Bearbeitung von Shakespeares "Sturm". Ein wichtiger Schauplatz darin ist ein Gefängnis – wie es auch in ihrem 2015 veröffentlichten formidablen SF-Roman "The Heart Goes Last" der Fall war. Den möchte ich an dieser Stelle endlich nachtragen; er ist übrigens vor Kurzem in der Paperback-Ausgabe erschienen, bislang aber nur auf Englisch. Das Konzept dahinter dürfen wir uns wie eine Mischung aus dem berühmt-berüchtigten Stanford-Prison-Experiment, Philip José Farmers "Dayworld"-Reihe und der TV-Serie "Desperate Housewives" vorstellen. Also so einen Satz schreibt man auch nicht alle Tage ...
Zur Handlung
Eine Wirtschaftskrise in der nahen Zukunft hat insbesondere den Nordosten der USA getroffen. Die Reichen haben sich auf Offshore-Plattformen zurückgezogen, die weniger Begüterten mussten im neuen rust bucket zurückbleiben: ohne Jobs, ohne Geld, ohne Aussicht auf Verbesserung. Zu den vielen, die arbeits- und obdachlos wurden, gehört auch das junge Ehepaar Stan und Charmaine, die jetzt in ihrem Honda schlafen – stets auf der Hut vor Junkies und Kriminellen, die sie in diesem anarchisch gewordenen Land überfallen könnten. Mit Blick aufs Detail und galligem Humor beschreibt Atwood die Tristesse der Armut: Wie Stan und Charmaine nur noch dunkle Kleidung tragen, weil man es der nicht so schnell ansieht, dass sie nur noch selten gewaschen wird. Oder wie der eheliche Sex im beengten und übelriechenden Wageninneren alles andere als "inspirierend" ist.
Da sieht Charmaine, die als Kellnerin in einer versifften Bar ein paar Dollar verdient, eines Tages einen Werbespot des Positron Project: Ein gesellschaftliches Experiment zur Errichtung einer funktionellen, selbsterhaltenden Wirtschaftseinheit, die zum Vorbild für das ganze Land werden soll. Das Konzept sieht so aus: In dem zur Gated Community umgebauten Consilience – einer Kleinstadt so blitzsauber, als wäre sie an der Wisteria Lane gelegen – lebt man einen Monat lang ein normales Berufsleben und den Monat darauf als gratis arbeitender Häftling im stadteigenen Gefängnis. Haus und Fahrzeug teilt man sich wie in Farmers "Dayworld" mit seinen Alternates – also denjenigen, die das Gleiche um einen Monat zeitversetzt tun. "Do time now, buy time for our future!"
Drinnen und draußen
Stan und Charmaine werden für das Projekt akzeptiert und finden sich – dankbar, dass sie wieder ein Zuhause haben – mit den örtlichen Regeln ab. Und die sind gar nicht so ohne. Kontakte zur Außenwelt sind verboten, das interne Netz und TV zeigen nichts, das subversiver wäre als ein Doris-Day-Film. Zudem hat Consilience seine eigene Währung; mit den erarbeiteten Posidollars kann man daher nur das kaufen, was der unternehmenseigene Shop anbietet. Das "innovative" gesellschaftliche Konzept ist also nichts anderes als eine Neuauflage des Manchesterkapitalismus aus dem 19. Jahrhundert, in dem ArbeiterInnen den FabrikseigentümerInnen vollkommen ausgeliefert waren.
Passend zu einem Szenario, das zum Heulen ist, liegen hier die Schichten der Ironie ineinander wie in einer Zwiebel. Atwoods Kommentare zu Alltagsphänomenen dieser schönen neuen Welt sind schon fies genug. Um diesen Kern legt sich als zweite Schicht der Umstand, dass zwischen dem Monat in Haft und dem in "Freiheit" im Grunde nicht wirklich ein Unterschied besteht. Man sollte aber auch die Ironie auf einer noch größeren Ebene nicht übersehen: Nämlich dass hier Kriminelle frei durchs verwahrloste Land ziehen können, während man gesetzestreue BürgerInnen einsperrt.
Das ist aber nur der Anfang. Rasch erweist sich, dass hinter den pastellfarbenen Fassaden von Consilience ein ähnlich gnadenloses Regime herrscht wie in "Wayward Pines". Was ist zum Beispiel mit den "richtigen" Häftlingen geschehen, die im örtlichen Gefängnis einsaßen, ehe das Positron Project es übernahm? Und spätestens wenn Stadtoberhaupt Ed seine Schäflein auf Wachsamkeit gegenüber Infiltratoren und äußeren Feinden einschwört, fühlen wir uns wie in Little North Korea. Der Roman, der von einigen als E-Books veröffentlichten "Positron"-Episoden begleitet wird, stellt sich damit in die Tradition Orwell'scher Dystopien, auf die in versteckten Bemerkungen auch angespielt wird.
Humor ist Trumpf
Atwood hatte aber offensichtlich nicht vor, ein Werk zu schreiben, das ähnlich düster wäre wie "1984" – oder wie ihr eigener legendärer Roman "The Handmaid’s Tale". Genauso wichtig wie die politische Seite des Romans sind nämlich die ganz normalen Suburbia-Probleme der Hauptfiguren – in anderen Worten: die eheliche Langeweile. Stan findet eines Tages eine schlüpfrige Zettelbotschaft der Alternates Jasmine und Max, mit denen sich er und Charmaine das Haus teilen. Immer ausführlicher beginnt er sich auszumalen, wie wild es die beiden wohl treiben, und ist allmählich vom Gedanken besessen, Jasmine zu treffen und ihr zu zeigen, was für ein Hengst auch er sein könnte. Er ahnt nicht, dass der Zettel von seiner eigenen Frau stammt, die unter einem Decknamen eine Affäre hat.
Wir haben es also auch mit Verwicklungen zu tun, die einer typischen Dramedy entsprungen sein könnten. Zugegeben allerdings, hier sind die Herausforderungen, vor denen die ProtagonistInnen stehen, um einige Schraubenwindungen pikanter: etwa sich mit Sexrobotern ("prostibots") herumzuschlagen oder gegebenenfalls auch den eigenen Ehepartner zu euthanasieren ... In der zweiten Hälfte des Romans wird es zunehmend absurder und der Humor damit auch leichter. Spätestens wenn Stan in Sexpuppentarnung in einer Gruppe von Elvis-Lookalikes (dem Elvisorium) ankommt, überwiegt der Satire-Faktor des Romans die Dystopie bei weitem.
Sehr empfehlenswert!
Mit seiner Mischung aus schwarzem Humor und schonungsloser Betrachtung liest sich "The Heart Goes Last" so, wie es eben klingt, wenn sich eine gebildete ältere Dame kein Blatt vor den Mund nimmt und daran ihren Spaß hat. In einem Wort: großartig. Margaret Atwood ist eine begnadete Erzählerin. Mit Hingabe und größtem Vergnügen lauscht man ihrer Stimme – selbst wenn diese von schlimmen, schlimmen Dingen erzählt. Wirklich bemerkenswert, wie viel Boshaftigkeit man zwischen zwei Buchdeckel pressen kann.
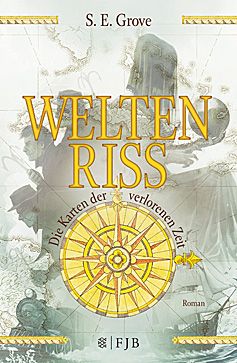
S. E. Grove: "Weltenriss"
Gebundene Ausgabe, 576 Seiten, € 19,60, Fischer FJB 2016 (Original: "The Glass Sentence", 2015)
Eine interessante philosophische Frage wirft die US-amerikanische Autorin S. E. Grove in ihrem Debütroman, Start einer Fantasy-Trilogie, auf: Wenn plötzlich ein Ereignis eintritt, das dazu führt, dass sich verschiedene Zeitebenen bzw. Epochen bunt miteinander vermischen, bis die ganze Welt schließlich wie ein Chrono-Mosaik aussieht ... wann ist dann besagtes Ereignis nun wirklich eingetreten?
In der Zeitlinie der Hauptfiguren von "Weltenriss" war es jedenfalls das Jahr 1799, als die Große Disruption geschah. Seitdem – Handlungszeit des Romans ist das Jahr 1891 – hat sich der Osten der USA, hier Neu-Okzident genannt, in etwa zu dem technologischen Stand entwickelt, den er auch in unserer Geschichte hatte. Westlich davon gehören jedoch wieder weite Gebiete den Ureinwohnern, während sich im Norden Eiszeitsteppen erstrecken. Und Mittelamerika ist sowieso ein einziger Fleckerlteppich aus Zeitinseln, die sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Zukunft stammen. Europa wird in diesem Roman kaum gestreift, hier winken ominöse Bezeichnungen wie Verbotenes Empire oder Päpstliche Staaten. Sehr hübsche Karten am Beginn des Buchs übrigens, das generell ansprechend gestaltet ist.
Die Hauptfigur muss ran
Im Mittelpunkt steht die erst 13-jährige Sophia Tims aus Boston. Ihre Eltern sind auf einer Expedition verschollen, aufgewachsen ist sie bei ihrem Onkel Shadrack Elli, einem renommierten "Kartologen". Das Kartenmachen war in ihren Augen zwar ein nobler und gelehrter, aber auch ziemlich unordentlicher Beruf – war das Haus in der East Ending Street doch von oben bis unten mit Karten tapeziert. Sophia bewegte sich wie eine winzige Insel der Ordnung und Sauberkeit durch das Haus, indem sie Bücher ordentlich einordnete, Karten zusammenrollte und Stifte sammelte, alles im Bestreben, die sie umgebende kartologische Flut einzudämmen.
Karten sind nämlich das Um und Auf in dieser unübersichtlich gewordenen Fantasywelt. Es gibt sie nicht nur in klassischer Papierform, sondern auch aus Glas, Lehm oder sogar Wasser. Und sie geben nicht einfach nur die Geographie wieder, sondern können auch Erinnerungen abspeichern. Man munkelt zudem von der legendären Carta Major, die die Welt interaktiv abbildet – wer die Karte verändert, verändert auch die Wirklichkeit.
Vermutlich wegen seines umfangreichen kartologischen Wissens wird Shadrack eines Tages entführt. Sophia konnte er gerade noch eine kryptische Botschaft hinterlassen, und mit der im Gepäck muss sie nun ins Abenteuer ziehen. Begleitet wird sie vom jungen Theo, den sie in einer Freakshow gesehen hat und der später ganz unerwartet ein zweites Mal in ihrer Nähe auftaucht. Interessant, dass sie da nicht nachbohrt – zu Theos Motiven wird uns Grove in den späteren Bänden wohl noch mehr erzählen.
Auf Entdeckungsfahrt
Die Große Disruption hat die Welt wieder fremd gemacht, was es Grove ermöglicht, das "Zeitalter der Entdeckungen", das ja im 18. Jahrhundert auslief, eine Ehrenrunde drehen zu lassen. Plots dieser Art sollten in der Fantasy viel öfter verwendet werden, muss ja nicht immer gleich ein Dunkler Lord wiederauferstehen! Aufgrund des historischen und "chrononautischen" Settings fühlt sich die Romanprämisse ein bisschen wie eine jugendtaugliche Schnittmenge aus Robert Charles Wilsons "Darwinia" und David Waltons "Quintessence" an.
Unterwegs bekommen es Sophia und Theo unter anderem mit den enterhakenbewehrten Schergen von Shadracks Entführer zu tun, mit freundlichen Piratenzwillingen, mit lebenden Segelschiffen, die über Land rollen, mit einer riesigen Gartenstadt und mit Menschen, denen Dornen und Blätter aus dem Körper wachsen. Insgesamt hat Grove hier eine erfreulich eigenständige Mythologie geschaffen – siehe auch die magischen Karten oder die geheimnisvollen Lachrimas: Menschenartige Wesen ohne Gesicht, deren bansheeartiges Weinen jeden Zuhörer mit in ihre unendliche Traurigkeit zieht.
Was ist Zeit? Was ist Zeeeeiiiiit?
Abgesehen von der Epochenvermischung spielt Zeit hier mehrfach eine entscheidende Rolle. So hat Sophia keinerlei Zeitgefühl – kann passieren, dass sie in Gedanken abschweift und anschließend feststellt, dass sie sich ein paar Stunden nicht von der Stelle gerührt hat. Dabei sind in Neu-Okzident Uhren omnipräsent, jeder muss stets wie einen Ausweis seine "Lebensuhr" mit eingeprägtem Geburtsdatum mit sich tragen. Und im Parlament ist die Redezeit nach Sekunden zu bezahlen (und teurer als TV-Werbespots zur Prime Time): Netter Kommentar der Autorin zur Politik unserer Tage, die Reiche bevorzugt – wie auch die grade in Neu-Okzident hochkochende Debatte, ob sich das Land vom Rest der Welt abschotten soll. Ein bisschen viel Zeit-Motivik insgesamt, denkt man zunächst, da schaut fast "Momo" ums Eck. Aber Grove kratzt die Kurve, und für Sophias fehlendes Zeitgefühl wird es noch eine Erklärung geben.
Mitunter schwächelt die Logik allerdings auch: Dass hier Vergangenheits- und Zukunftsmenschen als direkte Nachbarn leben, hat seltsamerweise nicht dazu geführt, dass die technologisch Überlegenen eine Vormachtstellung erringen konnten. Überhaupt ist von solchen Unterschieden wenig zu spüren, Groves Welt wirkt eigentlich einheitlicher als die von "Trigan". Und wenn sich als Plot-Driver eine neue Eiszeit von Süden her auf unsere ProtagonistInnen zuschiebt, dann geht aus Groves Beschreibungen nicht wirklich klar hervor, ob sich die Gletscher jetzt einfach über alles drüber legen ... oder quasi "schon immer da waren".
Ich hab's gern gelesen
Groves eigenständige Ideen gleichen das aber locker aus, dazu kommt ihre Erzählweise, die vergessen lässt, dass man es hier eigentlich mit einem Jugendbuch zu tun hat: Die Hauptfiguren sind zwar Teenager, von simpel erzählt kann man aber keineswegs reden (wer weiß, ob die Autorin, eine Historikerin, das überhaupt könnte).
A pleasant read, würde man auf Englisch sagen.
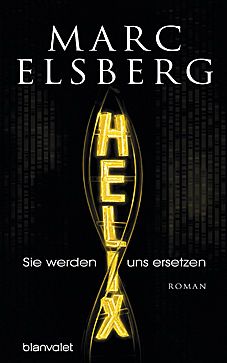
Marc Elsberg: "Helix"
Gebundene Ausgabe, 648 Seiten, € 23,70, Blanvalet 2016
Dann stand nur mehr das Rednerpult auf der Bühne des voll besetzten Hotelsaals, und der US-Außenminister lag reglos daneben. Jawoll, so geht das! Für das Attentat, mit dem Marc Elsberg seinen jüngsten Thriller "Helix" beginnen lässt, verschwendet er keinerlei Zeit auf die Vorgeschichte und nicht einmal auf die Durchführung der Tat selbst, sondern eröffnet den Roman gleich mit dem Resultat. Das ist in seiner erzählerischen Ökonomie so bestechend, dass es vollkommen den Umstand überstrahlt, dass dieses Attentat im Grunde überhaupt keinen Sinn ergibt – auch nicht nach abgeschlossener Lektüre übrigens. Aber geschenkt.
Es kann nur einen geben
Wissenschaft und Technologie werfen neue Probleme auf, Wissenschafts- und Technologiethriller denken sie weiter und schlachten sie aus. Diese Zweierbeziehung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten derart gut eingespielt – es war nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Nische, die im englischsprachigen Raum jahrzehntelang von Michael Crichton dominiert wurde, auch einen deutschsprachigen Platzhirsch finden würde.
Zu Anfang des Jahrtausends schien dies kurz Frank Schätzing zu werden. Den dürfte nach dem Überraschungsmegaerfolg von "Der Schwarm" aber die Ambition übermannt haben, nur noch GANZ GROSSE WERKE zu veröffentlichen; es wurden zumindest ganz schön lange daraus. An seiner Stelle hat der Wiener Marcus Rafelsberger alias Marc Elsberg die Nische nun endgültig für sich erobert. Nach einigen Krimis – auch Schätzing hatte so begonnen – veröffentlichte Elsberg 2012 den apokalyptischen Thriller "Blackout" über die Risiken des europäischen Stromnetzes. 2014 folgte "Zero" zum Thema Datenschutz. Und nun ist, der Titel "Helix" deutet es schon an, die Gentechnik dran.
... Romanfiguren allerdings gibt's viele
Getragen wird der Roman von einem vielköpfigen Figurenensemble. Allen voran Dr. Jessica Roberts, die zum Stab des ermordeten Ministers gehörte und nun die Taskforce leiten soll, die das Attentat untersucht. Spätestens als sich bei der Obduktion zeigt, dass genmanipulierte Viren am Herzen des Opfers ein Totenkopfmuster hinterlassen haben, dämmert allen, dass hier etwas Größeres im Busch ist. Am Rande sei hier angemerkt, dass wir uns in der nahen Zukunft befinden (der Zahl der Weltbevölkerung nach irgendwann in den 2020er Jahren). Daher ist der Stand der Gentechnik zwar schon ein bisschen weiter fortgeschritten als in der Realität – dieser makabre "Gruß" ist dem technischen Können seiner Zeit aber dennoch voraus.
Derweil stößt man in Tansania auf "das Wunder": das Feld einer armen Bäuerin, auf dem alles blüht und gedeiht, während ringsherum die Ernten Schädlingen zum Opfer fallen. Auch hier kam offensichtlich Gentechnik zum Einsatz ... und was besonders erschreckend ist: Es geschah gratis. Das scheucht Helge Jacobsen, den Vorsitzenden des Biotechkonzerns Santira, schneller auf als Bomben und Granaten.
Dann hätten wir noch die hochbegabte Teenagerin Jill, die am MIT arbeitet, nach dem Attentat aber unter Hinterlassung einer ominösen Warnung verschwindet. Und schließlich das junge Ehepaar Helen und Greg, die eine künstliche Befruchtung versuchen wollen. Der Arzt bietet ihnen überraschend eine genetische Optimierung des Embryos mit einer offiziell nicht existierenden Methode an. Ehe sie sich's versehen, werden sie zusammen mit anderen Paaren unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen an einen geheimen Ort geflogen, wo ihnen der Genetiker Stanley Winthrope die Resultate seiner Methode anpreist. Greg kommt sich vor wie auf einer Kaffeefahrt.
Verankerung in der Realität
Bis auf das nur mühsam gerechtfertigte Attentat werden sich all die divergierenden Handlungszweige letztlich zu einem stimmigen Ganzen fügen. Und soll keiner glauben, hier wäre zufällig ausgewählt worden: Biowaffen, gentechnisch veränderte Pflanzen und Designerbabys, das sind genau die drei Themen, über die Gentechnik am häufigsten in den Schlagzeilen auftaucht. Da steckt ein klares Kalkül dahinter – man kann "Helix" also mit Fug und Recht als Elsbergs literarisches Designerbaby bezeichnen.
Neben der "Genschere" CRISPR/Cas finden sich hier viele Themen aus der Wissenschaftsberichterstattung der vergangenen Jahre wieder. Dazu kommen durch die Handlungszeit in der nahen Zukunft einige Aspekte, die (vorerst) zum Glück noch keine Rolle spielen; es fallen ominöse Stichwörter wie "Biohacker" oder "Garagengenetiker".
Es fließt
An Kleinigkeiten merkt man, wenn jemand sein Handwerk beherrscht: Etwa am Wechsel von kurzen und langen Sätzen – je nachdem, was die Dynamik der Situation verlangt. Das klingt eigentlich selbstverständlich, ja geradezu banal. Aber man sollte nicht für möglich halten, wie viele Erzählungen einem unter die Augen kommen, in denen beispielsweise mitten in einem Handgemenge unglaubliche Gliedsatzkonstruktionen zusammengezimmert werden. Von Dialogen ähnlichen Holzgehalts ganz zu schweigen.
Und in eine weitere Falle, die Elsberg vermutlich nicht einmal bemerkt hat, ist er auch nicht getappt: Wie schon in "Blackout" – bei dem das allerdings sinnvoller war – sind auch in "Helix" die Romanabschnitte als Chronologie von Tagen ausgewiesen. Da durchfuhr mich kurz der Schreck, dass das hier "passend" zum Romanthema auf bedeutungsschwangeren Symbolismus Marke *ächz* hinauslaufen könnte. – Aber nein, es sind neun Tage. Nicht sieben respektive sechs plus Ruhetag ...
Der beruhigende Eindruck, der sich bereits beim eingangs zitierten Eröffnungssatz des Romans eingestellt hat, trügt daher nicht: Man kann sich im Gefühl der Sicherheit zurücklehnen, hier in souveräner Weise unterhalten zu werden.
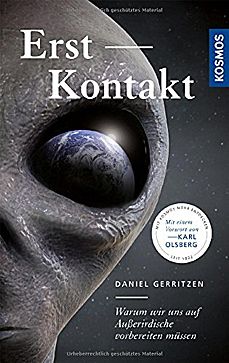
Daniel Gerritzen: "Erstkontakt"
Gebundene Ausgabe, 368 Seiten, € 25,70, Franckh Kosmos Verlag 2016
... nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Kurzroman von Wolfgang Hohlbein, den übrigens ebenfalls ein Grey am Cover ziert. Dabei scheinen den deutschen Journalisten Daniel Gerritzen beim Gedanken an Aliens eher arachnophobe Visionen zu plagen, geht man nach der Häufigkeit, in der er in seinem Sachbuch Spinnen als potenzielle optische Vorlage für Außerirdische heranzieht. Sehen wir uns mal an, wie er von dieser Ausgangslage zum bemerkenswerten Satz "Blutrünstige Spinnen-Aliens beten Satan an!" kam.
Beginnen wir mit dem Positiven: Gerritzen denkt – zumindest mal zeitlich – weiter, als es der durchschnittliche SETI-Fan tun dürfte. Der ist ganz darauf fokussiert, dass sich irgendein aufgefangenes Signal mal tatsächlich als eindeutig künstlichen Ursprungs entpuppt. Angenommen, wir empfangen eine lange Reihe von Primzahlen: Hurra, der Beweis ist erbracht! Es gibt außerirdische Intelligenz! Die jahrzehntelangen Kontaktversuche haben gefruchtet! – Schön und gut (oder bei Gerritzen eher: grausig und schlecht) – aber wie geht es nach dem erbrachten Beweis weiter? Denkt daran auch wer? Meine persönliche Vermutung übrigens: Nach einigen Tagen oder vielleicht Wochen der Aufgeregtheit zuckt die Menschheit die Achseln, wendet sich anderen Schlagzeilen zu und macht weiter wie bisher.
Angst!
Das sieht Gerritzen ganz anders. Nicht von ungefähr startet er sein Buch mit ausführlichem Eingehen auf Orson Welles' berühmt-berüchtigte Hörspieladaption von "Krieg der Welten", die 1938 in den USA eine mittelgroße Invasionspanik auslöste. Das damalige Medien-Desaster wertet er als durchaus geeignetes Modell für die Hysterie, die bei einem echten Erstkontakt entfacht würde. Faktoren wie die Bedeutung des ersten Eindrucks, Salienz und unser reges Angstzentrum in der Amygdala würden dafür sorgen, dass uns schon beim Gedanken an Aliens unweigerlich der Grusel packen würde (zumindest wenn wir sie uns wie Spinnen vorstellen, was hier seltsamerweise ständig in den Raum gestellt wird).
Medien würden die Außerirdischen zudem zwangsläufig "verbösen", weil sie im Drang zur Bebilderung auf Archivmaterial zurückgreifen würden, und das sei eben überwiegend negativ besetzt. (Hier wäre allerdings eine Studie interessant, ob das tatsächlich so ist – alleine in "Star Trek" und "Star Wars" haben sich schließlich auch massenhaft positiv besetzte Außerirdische ins kulturelle Gedächtnis eingegraben.) Verknüpft man das mit mangelnder Bildung – die Gerritzen weiten Teilen der Bevölkerung unterstellt – und mit ideologisch geprägten Wahrnehmungsfiltern und Erwartungshaltungen, zum Beispiel religiöser Art, ... ja, dann kann man sich vielleicht wirklich vorstellen, dass irgendwann irgendwer mit "Satan-Spinnen" schlagzeilt.
SETI und SETA
Im Mittelteil geht es um bekannte und vieldiskutierte Themen wie SETI und die Drake-Formel, das berühmte Wow!-Signal von 1977 und andere – insgesamt gar nicht so wenige – Radiosignale, die in der SETI-Geschichte schon registriert wurden und deren Ursprung immer noch ungeklärt ist; allesamt freilich Einzelereignisse, die sich nicht wiederholt haben.
Spannend, weil ein deutlich weniger bekanntes Thema behandelnd, ist das Kapitel über Ronald N. Bracewells SETA-Projekt ("Search for Extraterrestrial Artifacts"), in dem es um mögliche Alien-Hinterlassenschaften im Sonnensystem oder sogar auf der Erde selbst geht. Da darf natürlich das Tunguska-Ereignis von 1908 nicht fehlen, zu dessen Ursache es vom Asteroideneinschlag bis zur Gasexplosion die unterschiedlichsten Spekulationen gibt. Witzig, wenn Gerritzen beklagt, dass es dazu keine hinreichend neutrale Untersuchung gebe, weil jeder nur seine eigene Hypothese verifizieren wolle. Er tut nämlich im Anschluss exakt dasselbe: Aufgrund der Faktenlage vermuten wir zwar, dass das Objekt, das über der Steinigen Tunguska explodierte, sehr wahrscheinlich ein weit fortgeschrittenes technisches Objekt war ... Wer auch immer "wir" ist.
Behauptungen, Behauptungen
Und da sind wir schon bei einem zentralen Problem von "Erstkontakt". Auf der einen Seite beeindruckt das Buch mit einem gewaltigen Zitationsapparat und Bezügen auf unzählige Quellen. Und es ist auch auf einem aktuellen Stand – beispielsweise wird auf den unter Dysonsphärenverdacht stehenden Stern KIC 8462852 ("Tabbys Stern") eingegangen, der 2015 für Schlagzeilen sorgte und erst diesen Monat wieder zum Gegenstand astronomischen Rätselratens wurde.
Auf der anderen Seite stellt Gerritzen leider permanent Behauptungen in den Raum, als wären es Fakten. Fremde Erreger, die zur Erde gelangen, würden eine ähnliche biologische Struktur aufweisen wie irdische Viren, Bakterien oder Pilze. (Sagt wer?) Sie wären aber so unheimlich wie der in den Tropen und Subtropen vorkommende Parasitenpilz Ophiocordyceps unilateralis, der Holzameisen befällt (Und woher kommt diese Gewissheit nun wieder?). Oder mal so ganz locker als unumstößliche Wahrheit eingestreut: Ein physischer Kontakt mit einer außerirdischen Robotsonde würde die Auflösung unserer gegenwärtigen Gesellschaftsordnung und ihrer Werte nach sich ziehen.
Ein immer wiederkehrendes Muster im Buch ist, dass eine Behauptung aufgestellt wird, aus der Gerritzen dann eine weitere Behauptung ableitet (die sich noch dazu aus der ersten keineswegs zwangsläufig ergeben muss) und immer so weiter, bis am Ende der Kette von willkürlichen Annahmen plötzlich ein Beleg stehen soll. Erinnern wir uns an die Spinnen: Acht Glieder und Augen sind wirkungsvoller als zwei. (When last I looked, war das Sehvermögen von Menschen dem von Spinnen weit überlegen.) Besäßen Spinnen kein Exoskelett, hätten sie bessere Augen (Zusammenhang? Die besten Augen haben Fangschreckenkrebse, trotz Exoskelett.) sowie Finger und Füße und wären so groß und intelligent wie Menschen (interessante "Zwangsläufigkeit" der Evolution) – sie wären uns gegenüber definitiv im Vorteil. Jaja, oder so. Das ist einfach nur schwach argumentiert.
Und noch einmal: Angst!!!
Derart einfach in Frage zu stellende Behauptungen führen natürlich zum Gedanken, wie es mit Gerritzens Ansichten zu den Folgen eines Erstkontakts bestellt sein mag. Mit Fug und Recht verweist der Autor darauf, dass interkulturelle Kontakte in der Geschichte der Menschheit durchwegs zu Ungunsten der technologisch Unterlegenen ausgegangen sind. Nicht umsonst hat selbst Stephen Hawking vor ein paar Jahren gewarnt, dass man etwaige Aliens nicht durch Kontaktversuche auf uns aufmerksam machen solle. (Was ihn im Frühling diesen Jahres aber nicht davon abhielt, öffentlich eine Initiative zu unterstützen, die Robotersonden nach Alpha Centauri schicken will.)
Aber derart schwarzmalen wie Gerritzen? Antimaterieexplosion hier, Epidemie da – auf Dauer werden all die hier angeführten Worst-Case-Szenarien ein wenig ermüdend. Selbst positive Folgen eines Kulturkontakts würden laut Gerritzen gewiss ins Gegenteil umschlagen. Brächten uns die Aliens beispielsweise eine unerschöpfliche saubere Energiequelle, würden die heutigen Energiekonzerne pleitegehen (hui, was für ein Verlust für die Menschheit ...), und dieses Szenario wird dann auch gleich unter "Krisen und Kriege" subsumiert. Befremdlich. Weitergedacht und etwaige Aliens mal kurz ausgeklammert, sagt Gerritzen damit nämlich nichts anderes, als dass jede technologische oder kulturelle Innovation, jeder Fortschritt, kurz: jede Veränderung des Status quo die Zivilisation unweigerlich ins Chaos stürzen würde. Das kann's ja wohl nicht sein.
Einladung zur Diskussion
Zur Rechtfertigung führt Gerritzen an, dass er sich in seinem Buch deshalb nur mit Worst-Case-Szenarien beschäftigt, weil es ihm um die "Possibilität", nicht um die "Probabilität" geht. Dagegen lässt sich schwer etwas sagen – außer dass eine Möglichkeit ohne den Kontext ihrer Wahrscheinlichkeit nur unvollständig abgehandelt werden kann. Später sagt er allerdings auch schlicht: Es gibt kein Best-Case-Szenario. Und falls irgendjemand glauben sollte, am Schluss käme noch irgendeine Abschwächung oder sonstwas Versöhnliches – weit gefehlt. Wie heißt es doch am Ende der Danksagung, nachdem aber auch wirklich jedes denkbare Katastrophenszenario lustvoll durchgekaut wurde? Mein Buch kratzt nur an der Oberfläche. Die möglichen negativen Folgen eines Erstkontakts könnten sehr viel schlimmer sein.
Aber soll einem nichts Schlimmeres unterkommen als ein Buch, das zum Widerspruch einlädt!
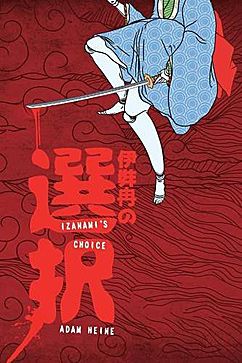
Adam Heine: "Izanami's Choice"
Broschiert, 98 Seiten, Broken Eye Books 2016
Wieder ein neues Wort für Roboter, KIs & Co im Topf: jinzou (heißt wohl so etwas wie "künstlich"). Damit werden in Adam Heines Debüt-Novelle "Izanami's Choice" einerseits die großen zentralen Denkmaschinen bezeichnet, über die die fortgeschrittenen Nationen der Welt verfügen: Izanami etwa in Japan, benannt nach einer Göttin ... das deutsche Pendant heißt etwas weniger glamourös Johann. Das Wort gilt aber auch für die Unzahl an Robotern, die hier das Straßenbild von Tokio prägen, und wird synonym für droids gebraucht. Zu Abwechslung ist es übrigens ein Steampunk-, kein Cyberpunk-Tokio: Der junge US-amerikanische Autor hat seine Geschichte nämlich am Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedelt.
Hauptfigur der Novelle ist Itaru, ein Privatdetektiv in mittleren Jahren, der zuvor Polizist und davor Samurai war. Die gesellschaftlichen und technologischen Umbrüche der Meiji-Restauration – in Heines Welt noch massiver ausgefallen als in unserer – haben Itaru in die Rolle eines Relikts gedrängt. Speziell mit den jinzou kommt er nicht zurecht: Er misstraut ihnen, seit sein Sohn gleichsam als Kollateralschaden einem Einsatz von Polizei-Droiden zum Opfer gefallen ist, und hält die betreffende Technologie generell für den "Krebs von Japan". Wem das bekannt vorkommt: Es ist kurzgefasst fast die gleiche Ausgangslage wie in "I, Robot" (dem Will-Smith-Film, nicht Asimov).
Die Dinge kommen ins Rollen
Und ausgerechnet an den grummelnden Itaru wendet sich nun ein Roboter mit der Bitte um Hilfe. Gojusan ist nicht nur ein State-of-the-art-Modell mit synthetischer Gesichtshaut. Für Itaru viel entsetzlicher – und offiziell eigentlich unmöglich – ist der Umstand, dass Gojusan behauptet, über ein Bewusstsein zu verfügen: "I am alive, and I do not wish to be made unalive."
Gojusans Besitzer wurde ermordet und die kritischen Minuten wurden aus dem Gedächtnis des Droiden gelöscht. Es stellt sich also die gute alte Whodunnit-Frage, und rasch findet sich Itaru nicht nur mit seinem verhassten "Partner" auf der Flucht wieder, sondern muss auch noch feststellen, dass er selbst polizeilich gesucht wird. Der Kriminalfall erhält zudem gesellschaftspolitische Bedeutung, da Okubo, der zweitmächtigste Mann im Staat, bereits argwöhnt, dass es jinzou mit Bewusstsein geben könnte, und dem wild entschlossen ein Ende machen möchte. Ehe sich's Itaru versieht, steckt er also mitten in einem möglichen gesellschaftlichen und technologischen Umsturz.
Unterhaltsame Lektüre
"Izanami's Choice" ist nicht die Art von Novelle, die wie eine verlängerte Kurzgeschichte auf Verdichtung und Atmosphäre setzen würde. Eher macht sie den Eindruck eines Romans, der auf eine Fastenkur gesetzt wurde. Was auch mal ganz nett ist, weil sich die geraffte Form flott liest.
Anzumerken ist, dass auch hier wieder das auftritt, was ich seit Jens Lubbadehs Roman "Unsterblich" in der vergangenen Rundschau jetzt immer das Anwendungsvakuum nennen werde: In den Droiden steckt alle mögliche Hochtechnologie – verblüffender- und unwahrscheinlicherweise taucht die aber nirgendwo sonst im Alltag auf. Im Grunde müsste dieses alternativhistorische Japan ganz anders aussehen, als es das tut. Beispielsweise fragt man sich, warum nicht gleich Autos gebaut werden, anstatt Rikschas von Robotern ziehen zu lassen. Was aber andererseits ein geiles Bild gibt – wie etwa auch ein Angriff von klingenbewehrten Assassinen-Robotern auf Itarus Haus: "Izanami's Choice" ließe sich gut für eine Comic-Version adaptieren.
Positiv ist, dass der in Thailand lebende Autor sich Mühe gegeben hat, abseits vom Dekor auch einen Hauch fernöstlichen Geist einzubringen. So verhalten sich die Figuren mitunter durchaus anders als moderne Westler – beispielsweise was das als unhöflich empfundene Zeigen von Emotionen betrifft. Und auch der Schluss entspricht nicht unbedingt dem, was man sich nach unseren Konventionen erwarten würde. Als jemand, der Abwechslung mehr als alles andere schätzt, finde ich ihn passend und gut. Gut möglich aber auch, dass der eine oder die andere darüber nicht erfreut sein wird. Your choice!
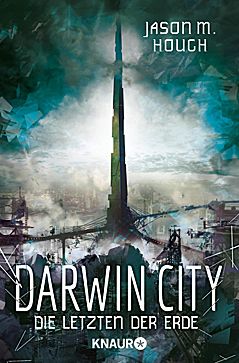
Jason M. Hough: "Darwin City"
Broschiert, 606 Seiten, € 10,30, Knaur 2016 (Original: "The Darwin Elevator", 2013)
Weltraumaufzüge sind grad wieder groß im Kommen, scheint's. Nach Lavie Tidhars "Central Station" in der vergangenen Rundschau und Alastair Reynolds' "Blue Remembered Earth" in dieser ist hier schon der nächste im Anrollen. Der große Unterschied zu den anderen Modellen: Dieses hier wurde von Aliens gebaut. Oder zumindest haben sie das Kabel verlegt, an das sich später die Menschen rangehängt haben wie Kletten. Leider war das aber nicht das Einzige, was die Außerirdischen hinterlassen haben ...
Das Szenario
Im Debütroman des kalifornischen Autors Jason M. Hough, dem Auftakt einer vielbeachteten Trilogie, sind 17 Jahre vergangen, seit Aliens überfallsartig das Kabel abgeworfen und in der Stadt Darwin verankert haben. Für das Werk eines US-Autors ist das Buch übrigens erstaunlich international angelegt: Der Hauptschauplatz liegt in Australien – gut, für Weltraumfahrstühle braucht man auch Äquatornähe – und die beiden positiv besetzten Hauptfiguren kommen aus Indien respektive den Niederlanden. Nordamerika selbst spielt hier überhaupt keine Rolle.
Für einige Zeit erlebte Darwin einen Boom – dann jedoch kam die Seuche. Und wie. Außer im direkten Umfeld des Lifts, der durch einen Aura genannten Effekt geschützt wird, hat eine Pandemie den gesamten Globus überrollt. Die Infizierten haben sich in aggressive Subhumane verwandelt. Wir dürfen sie uns wie eine Mischung aus den Tollwut-Zombies in "28 Days Later", den Abbies von "Wayward Pines" und aufgebrachter Landbevölkerung vorstellen.
Im Jahr 2283 leben die verbliebenen Menschen in den Habitaten, die entlang des 40.000 Kilometer hohen Weltraumfahrstuhls angelegt wurden, oder drängen sich an dessen Fuß in den Ghettos des übervölkerten Darwin zusammen. In der Danksagung entschuldigt sich Hough übrigens bei der realen Bevölkerung von Darwin dafür, dass er ihre schöne Stadt in ein postapokalyptisches Dreckloch verwandelt hat.
Die Hauptfiguren
Der Pilot Skyler Luiken gehört zu den wenigen Menschen, die gegen die Krankheit immun sind. Zusammen mit seinem kleinen Team klappert er das verwaiste Umland nach allem ab, was die Menschen daheim in Darwin brauchen könnten: Ganz ähnlich also wie Rileys Team in Romeros "Land of the Dead", nur mit bedeutend größerem Radius, weil sie statt eines Panzerwagens ein Flugzeug zur Verfügung haben.
Derweil arbeitet ganz oben in einer orbitalen Station die Wissenschafterin Tania Sharma an ihrer Theorie, dass die mysteriösen Aliens, die sich nie selbst blicken ließen, schon in naher Zukunft zurückkehren könnten. Sie glaubt zumindest, es wäre ihre eigene Theorie. In Wirklichkeit wird sie dabei von Neil Platz, der die gesamte Lift-Infrastruktur mit Ausnahme des Kabels geschaffen hat, sanft gelenkt. Überhaupt scheint der manipulative Tycoon mehr über die Pläne der Außerirdischen zu wissen als alle anderen.
Das Hauptfigurenquartett vervollständigt Russell Blackfield. Er ist für den Schutz der Bodenstation zuständig und hat seine Rolle dazu genutzt, sich zum Mini-Diktator eines korrupten Regimes aufzuschwingen. Blackfield ist nur auf seinen persönlichen Vorteil bedacht und geht dafür über Leichen – allerdings ist er auch, das muss man ihm lassen, so ziemlich der kompetenteste Akteur auf dem Spielfeld.
Da kommt noch was
Und die Regeln auf diesem Feld sind gerade dabei, sich zu ändern. Beim Lift fällt aus unbekannten Gründen der Strom aus, Infizierte tauchen innerhalb der Aura-Grenzen auf, zudem zeigen die Subs unerwartete neue Fähigkeiten. Und als wäre das nicht schon genug, bricht zwischen den verschiedenen Big Players auch noch ein Machtkampf aus, in den Skyler und Tania nun hineingezogen werden. Jede Menge Herausforderungen also: "Darwin City" ist ein buntes, actiongeladenes Abenteuer, das seine ProtagonistInnen von einer Kalamität in die nächste stürzt. Und kaum hat man gewitzt eine simple Lösung für ein kniffliges Problem gefunden – "Ja! Occams Rasiermesser!" –, steckt man gleich darauf in noch übleren Schwierigkeiten: "Occam, du Arsch ..."
Zugegeben, angesichts der vollkommen undurchsichtigen Pläne der außerirdischen Baumeister hätte ich persönlich einen anderen Handlungsmotor als das blutige Gekloppe der Menschen untereinander, das den größten Teil von "Darwin City" ausmacht, interessanter gefunden. Eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum hätte man sich allerdings nur erwarten dürfen, wenn es sich um einen Einzelroman handelte. "Darwin City" ist aber, das sei hier noch einmal ausdrücklich betont, der Auftakt einer Trilogie. Es endet zwar nicht direkt mit einem Cliffhanger, aber eben nur mit einem Etappenziel – und mit der Aussicht auf mehr.
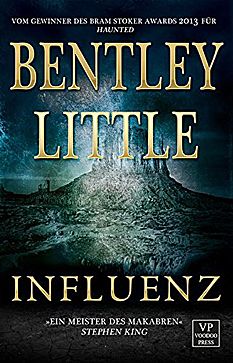
Bentley Little: "Influenz"
Broschiert, 402 Seiten, € 13,95, Voodoo Press 2016 (Original: "The Influence", 2013)
Hand hoch, wer beim Titel automatisch an ein Grippepandemie-Szenario dachte! Nix da, komplett daneben. Stattdessen handelt es sich um eine etwas exzentrische Adaptierung des Originaltitels "The Influence", der dem Inhalt recht gut entspricht. Unter besagtem Einfluss tun sich in diesem Roman des US-amerikanischen Horror-Autors Bentley Little nämlich die tollsten Dinge. Respektive die scheußlichsten.
Zur Ausgangslage
Seit einem Jahr ist der Ingenieur Ross Lowry nun schon arbeitslos, und so langsam geht ihm die Kohle aus. Also nimmt er das Angebot seiner Cousine Lita an, sich für einige Zeit bei ihr und ihrem Mann Dave auf ihrer kleinen Farm niederzulassen. Die liegt am Rande des Wüstenkaffs Magdalena – denn was Stephen King sein Maine ist, ist Bentley Little sein Heimatstaat Arizona. Dort hatte er schon seinen ersten Roman "The Revelation" handeln lassen, und auch später kehrte er immer wieder in sein bevorzugtes Setting zurück ("The Resort", "The Mailman").
Eine weitere Parallele zu King ist übrigens, dass auch Little sich bemüht, eine Art Gesamtschau zu bieten – wenn auch in deutlich geraffterer Form als sein berühmter Kollege. In einer Reihe individueller Mini-Dramen schildert Little in aller Kürze, wie sich der der Handlung zugrunde liegende Effekt auf diverse Neben- und Randfiguren auswirkt: Jedem seine Geschichte, egal wie kurz.
Seltsame Geschehnisse
Ross hat sich gerade einzuleben begonnen, als er eines Abends glaubt, einen schwarzen Schatten über den Himmel ziehen zu sehen: Ominöser Auftakt für eine Reihe von Ereignissen, die immer bizarrer werden. Tote Rinder liegen in geometrischen Formationen am Boden, aus den Kadavern quellen unbekannte Parasiten hervor – noch dazu ganz unterschiedlicher Art. Handy- und Internetempfang fallen aus. Menschen zeigen seltsame Verhaltensänderungen, Tiere verwandeln sich in Hybridwesen.
Und inmitten all des Übels kommen manche EinwohnerInnen Magdalenas plötzlich auf ebenso unerwartete wie unterschiedliche Weise zu Geld, anscheinend läuft auch noch die Glücksfee Amok. Angesichts der Vielzahl an höchst verschiedenen Phänomenen, die jedes für sich den Keim eines Romans abgeben könnten, fragt man sich: Was ist der gemeinsame Nenner?
Handelt es sich bei den Vorkommnissen möglicherweise um Manifestationen eines schlechten Gewissens? Immer wieder wird angedeutet, dass irgendetwas in der Silvesternacht geschehen ist, das der Stadt nun auf der Seele liegt. Unsere Hauptfiguren waren daran nicht beteiligt, und darum tappen sie ebenso im Dunkeln wie wir, was das bizarre Glücks- und Unglücksrad von Magdalena "influenziert". Ob das Ganze auf eine übernatürliche, sciencefictioneske oder psycho(patho)logische Erklärung hinauslaufen wird, darüber darf gerätselt werden – auch wenn Littles bisheriges Schaffen natürlich eine gewisse Richtung vorgibt.
Einmal glätten bitte
Dem Inhalt zum Trotz liest sich das Geschehen übrigens bemerkenswert nüchtern. Mangels Erfahrung mit Little auf Englisch kann ich allerdings nicht sagen, ob das am Autor selbst oder an der Übersetzung liegt. Die übrigens dringend noch einmal gegengelesen und geglättet werden sollte, es gibt einfach zu viele Fehler und Verschreiber – etwa wiederholt "Ranger" statt "Rancher". Was mich persönlich wahnsinnig macht, sind Komposita mit Leerzeichen: So werden sie im Englischen geschrieben, aber auf Deutsch geht das halt einfach nicht. Er nahm eine zwei Liter Cola Flasche ... Vielleicht lässt sich das wenigstens in der E-Book-Ausgabe noch richten.
Dessen ungeachtet funktioniert der Roman, weil er auf ein altbewährtes Muster setzt: Eskalation. Die Spirale des Irrsinns dreht sich nämlich munter weiter, und so kommen unter anderem noch intelligenter Kuchenteig, Kreaturen aus Schlamm und Müll und nicht zu vergessen der leichenstarre Penis eines Toten zu grausigem Einsatz. Also an Ekelideen mangelt es Bentley Little wahrlich nicht!
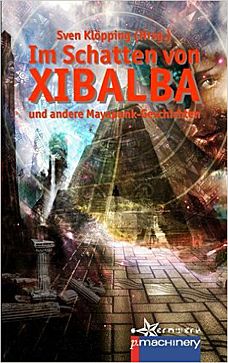
Sven Klöpping (Hrsg.): "Im Schatten von Xibalba und andere Mayapunk-Geschichten"
Broschiert, 252 Seiten, € 11,90, p.machinery 2016
"Mayapunk" ... Das ist jetzt für alle, die dachten, nach "Silkpunk" (für die aktuelle Miniwelle an chinesischen SF-AutorInnen, die ins Englische übersetzt werden) könnte sie nichts mehr überraschen. Das Neo-Wort steht als Emblem über einem alternativhistorischen Shared Universe, das der Verlag p.machinery eingerichtet hat. Abgesehen vom gemeinsamen Hintergrund haben die AutorInnen recht freie Hand, wie die hier versammelten 11 – in der E-Book-Version 14 – Geschichten zeigen. Mit Blick auf die Unterschiede in Stil, Herangehensweise und Qualität würde ich für "Mayapotpourri" plädieren.
Die Ausgangslage ähnelt der von Christopher Evans' Roman "Aztec Century" ("Der Sturm der Azteken"), allerdings in der Ära nach dem Untergang des Römischen Imperiums angesiedelt und eben mit Maya. Durch überlegene Technologie – in diesem Fall von außerirdischen Sponsoren zur Verfügung gestellt – haben die Eroberer aus Mittelamerika große Teile Europas unterworfen. Im Großraum Berlin leisten ihnen einige Stämme von Slawen und Germanen aber noch Widerstand. Einen noch wichtigeren Plotdriver als die Invasion selbst werden in den hier versammelten Erzählungen übrigens die gefürchteten Opferrituale der Maya abgeben. Nur ein Autor, Jens Hüsgen, lässt seine Protagonistin, eine Art Maya-68erin, das Massenschlachten in gezielt anachronistischer und dadurch herrlich komischer Sprechweise als archaisches Ritual des Mayamainstreams abtun. Mehr zu ihm später.
Die Highlights
Mit "Zähmer und Züchter" von Lydia Hermann alias Herr LÿÐmann legt die Anthologie einen quicklebendigen Start hin. Darin muss die aus einer Echsenzüchterfamilie stammende Nebosja eine gefährliche Mission für ihren Bruder übernehmen; "Echsen" steht hier übrigens für Drachen. Schön geschrieben und auf wenigen Seiten mit mehr familiären Verwicklungen ausgestattet als eine Staffel "Reich und Schön". – Auch Natalie Masche versteht es mit "Die Strahlen der Sonne" zu unterhalten. Darin erfährt der junge Priester/Seher Aak, dass bei der nächsten großen Opferung jemand aus seiner Familie dran ist – vermutlich er selbst. Vergnügt rätseln wir beim Lesen, ob und wie er es wohl schaffen wird, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen ... was eine drastischere Wendung als erwartet nehmen wird.
Highlight der ersten Hälfte des Bands ist aber das titelgebende "Im Schatten von Xibalba" von Sabrina Železný, die ihren Hang zu Magischem Realismus hier in ein Sportstück einfließen lässt. Darin muss der junge Slawe Jacza mit seinem Ballspielteam gegen eine Profimannschaft aus der Heimat der Maya antreten: ein hoffnungsloses Unterfangen, und am Ende droht der Opfertod. Jacza will das aber nicht kampflos hinnehmen. Er schleicht sich nachts heimlich in die Arena, um zu üben – und findet dort einen unerwarteten Mentor, der ihn nicht nur trainiert, sondern auch sein Bild von den Maya verändert. Eine mögliche Schlusspointe lässt sich schon vorab erahnen ... und darum wartet Železný kurzerhand mit einem doppelten Twist auf.
Wiederkehrende Muster
Daneben bzw. dahinter ist in der Anthologie viel Durchschnittliches, wenn auch nichts wirklich Schlechtes enthalten. Auffällig ist, dass kaum jemand auf Stimmung und sprachliche Verdichtung setzt, was sich im Format Kurzgeschichte durchaus anböte. Stattdessen wollen die meisten AutorInnen auf dem knappen Platz so viel Handlung unterbringen, dass sie fast für einen Roman reichen würde. Marc Shorts quasi-magischer Showdown zweier Maya-Prinzessinnen in "Yuca – Die dunkle Prinzessin" etwa wäre in längerer Form vermutlich etwas klarer rübergekommen. Und Antje Grüger versieht ihr "Spielball der Götter" sogar mit Exkursen zu den Aliens, mit denen sie den historischen Rahmen des gesamten Shared Universe absteckt: ganz schön viele Aufgaben, die knapp 30 Seiten hier zu bewältigen haben.
Immer wieder ist es übrigens eine interkulturelle Liebesgeschichte, die die Handlung vorantreibt. Und fast immer kommt der Mann darin von der ... Erobererseite (Freud, schau oba). Nur der schon eingangs erwähnte Jens Hüsgen dreht die Konstellation um. Aber in dessen "Der Götterstrahl" – meinem Lieblingsbeitrag zu dieser Anthologie – ist ohnehin alles ganz anders.
Save the best for last
Während andere mitunter in sprachliches Gealtertümel verfallen ("Es ging die Kunde ..."), schießt Hüsgen das historische Feeling vergnügt in den Wind und lässt seine ProtagonistInnen auf eine Weise sprechen, dass man sich in eine Loriot'sche Beamten- und Akademikersatire versetzt fühlt. So liest es sich, wenn Ludger, maya-kritischer Professor für Vergleichende Kulturwissenschaften, aus der Germanenzone in Chitzen Berlin einreist:
"Na, hören Sie mal, Sie sind ja gar kein Maya!", staunte der Grenzer. "Dann stellen Sie sich mal schön friedlich hinter die rote Linie in der Ecke da, machen bloß keinen Unsinn und warten, bitteschön." Der Beamte griff zum Votan-Phone und verlangte nach der Abteilung 3b/4k-2u des Innenministeriums, die für den Kontakt mit Havelländern zuständig war. "Ja", meinte der Beamte, "jaja, hier steht so ein Germane ... nee, bisher ist der ganz friedlich ... Jaja, kommen Sie mal lieber vorbei. So will es das Protokoll, nicht wahr?"
Nach all den vorangegangenen Dramen um Liebe und Krieg, Superwaffen und genmodifizierte Ungeheuer, tragische Schicksale und selbstgewählten Opfertod wirkt Hüsgens Text wie ein Schlag ins Gesicht. Und lässt die Anthologie im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Knalleffekt enden.
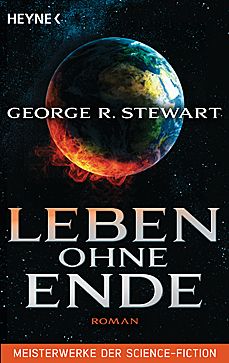
George R. Stewart: "Leben ohne Ende"
Broschiert, 528 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "Earth Abides", 1949)
Here comes sickness. Anders als bei "Influenz" diesmal wirklich. In "Earth Abides", dem berühmtesten Roman des US-amerikanischen Autors und Historikers George R. Stewart (1895–1980), fegt eine Art Supermasern-Epidemie um den Planeten und löscht in Rekordzeit fast die gesamte Menschheit aus. Doch wie der Originaltitel kühl verheißt: Die Erde hat Bestand – und findet rasch zu alter Form zurück, nachdem sie ihre Homo-sapiens-Plage zum allergrößten Teil losgeworden ist. Der 1949 erstveröffentlichte Roman zählt zwar nicht zu den Allerersten des Pandemie-Genres, aber zumindest zu den Altvorderen und genießt daher bis heute hohes Ansehen.
Der Protagonist
Hauptfigur des Romans ist Isherwood "Ish" Williams, ein egozentrisch veranlagter Doktorand der Ökologie. Die Seuche hat er als forschender Eremit im kalifornischen Hinterland verbracht. Ein Klapperschlangenbiss wirft ihn für einige Zeit aufs Lager – es bleibt offen, ob sein wochenlanges Leiden nicht doch an einer Infektion lag. Er überlebt aber, kehrt in die Zivilisation zurück und findet sich mitten im klassischen "He, außer mir ist ja gar keiner mehr da"-Szenario wieder. Seine erste Reaktion ist, sich in einem Haus niederzulassen, in dem der Strom noch läuft und der Vorratsschrank noch voll ist, und eine Zwischenbilanz zu ziehen: Bis jetzt, so überlegte er, zog das Ende der Zivilisation keinerlei Schwierigkeiten nach sich – nach einem guten Frühstück eine Zigarette zu rauchen, war nicht das Schlechteste, was einem passieren konnte.
Wer hier einen Hauch von Selbstgefälligkeit zu spüren meint, wird bald merken, dass er sich nicht getäuscht hat. Ish fasst den ehrgeizigen Plan, die Zivilisation wiederaufzubauen, es fehlen ihm bloß noch adäquate Projektpartner. Erste Begegnungen mit anderen Menschen verlaufen für den wählerischen Ish unbefriedigend, und so bricht er mit dem Auto gen Osten auf. Diese Reise nach New York und wieder zurück zum Ausgangspunkt hat keinerlei Konsequenzen für die Handlung, sie bietet lediglich einen Panoramablick auf das von Menschen geleerte Land. Der eigentliche Grund für diese Kapitel dürfte aber sein, dass der Autor selbst mehrfach solche Transkontinentaltrips unternommen und einige Bücher über die US-amerikanischen Highways verfasst hat.
Die ökologische Seite
Zurück in Kalifornien, findet Ish in Emma ("Em") eine halbwegs angemessene Frau – er sieht sich als Geistesmensch, während sie auf einer "tieferen Ebene" empfindet und ihm durch ihre Körperlichkeit und ihr patentes Wesen Trost spendet – und sammelt eine kleine Schar um sich. Anders als in heutigen Postapokalypsen muss sich diese Gemeinschaft übrigens weder mit den scheinbar unvermeidlichen Warlords und marodierenden Banditen noch mit Kannibalen herumschlagen. Probleme gibt es allenfalls mit Tieren, die sich nach dem Verschwinden der Menschen unkontrolliert vermehren und in Wellen eintreffen: Ameisen, Hunde, Ratten, Rinder und sogar Pumas. Zumeist ist das Massenauftreten aber nur ein kurzfristiges Phänomen – die "natürliche Regulierung" durch Seuchen und Nahrungsmangel trifft diese Spezies ebenso wie zuvor den Menschen.
In der Tat kann man Stewarts Roman hoch anrechnen, dass hier sehr früh – lange vor dem Aufkommen der Umweltbewegung – ökologische Aspekte eingebracht wurden. In kursiv gesetzten Einschüben wechselt Stewart immer wieder von Ishs Perspektive zu einer auktorialen Erzählweise, in der er physikalische und biologische Prozesse nach der Pandemie schildert: Wie sich ehemalige Haustiere in der neuen und gefährlichen Freiheit schlagen, wie Kulturlandschaften wieder zu Wildnis werden, wie Gebäude, Wasserleitungen und sonstige Infrastruktur verfallen. In Ton und Inhalt weisen diese Exkurse übrigens eine verblüffende Ähnlichkeit zur Dokufiktion-Serie "Zukunft ohne Menschen" auf. (Wer sich nicht erinnert: Das war die, in der man jedes CGI-Gebäude mindestens sechsmal einstürzen sah – in der Hälfte der Fälle horizontal gespiegelt, damit's nicht immer gleich aussah.)
Eine willkommene Ergänzung dazu bietet das Nachwort, in dem sich Uwe Neuhold wieder mal als das wissenschaftliche Erdungskabel der Science Fiction erweist. Er geht unter Verweis auf historische Beispiele der Frage nach, wie realistisch das Szenario ist, dass eine Pandemie die Zivilisation hinwegfegt. – Nicht sehr, kommt er zu einem beruhigenden Schluss. Die mit Abstand verheerendste Auswirkung hatte bislang die Justinianische Pest des 6. Jahrhunderts, und selbst die tötete "nur" ein Achtel der Weltbevölkerung.
Würstchen mit verzerrter Selbstwahrnehmung
Am stärksten merkt man "Earth Abides" seine fast 70 Jahre an der Hauptfigur an. Ish ist nicht nur auf gönnerhaft-patriarchalische Weise sexistisch, sondern auch rassistisch. Beides muss man im Kontext der Entstehungszeit und dadurch abgemildert sehen. Allerdings war es auch damals schon für einen Akademiker (Autor wie Hauptfigur) kein Ruhmesblatt mehr, wenn ihm zu den Kulturen der amerikanischen Ureinwohner nicht mehr einfällt als: Als sie nicht länger auf Kopfjagd gehen oder hinausreiten konnten, um Pferde zu stehlen oder Skalpe zu erbeuten, hatten sie auch kein Bedürfnis mehr zu irgendetwas anderem. Darauf folgt gleich der nicht ironisch gemeinte Satz: Glücklicherweise konnte er auf einen großen Fundus an Philosophie und Geschichtskenntnissen zurückgreifen, um seiner Überzeugung treu zu bleiben.
Ish hat nicht nur einen ausgeprägten Hang zur Selbstbeweihräucherung, er beurteilt auch alle seine Mitmenschen als ihm unterlegen. Hier seine Bewertungen seiner angehenden Nachbarn: George war ein dicker, watschelnder Kerl, grau an den Schläfen, gutartig, etwas ungeschickt in seiner Ausdrucksweise, aber höchst geschickt in seinem Handwerk – er war Zimmermann. (Schade, dachte Ish. Ein Techniker oder ein Farmer wären besser für uns gewesen.) – Witziger Gedanke eines Mannes, der nicht in der Lage war, einen Zaun zu bauen, der umherziehende Kühe aus dem Gemüsegarten fernhält. Aus der nahen Bibliothek holt sich Ish nach dem Gartenfiasko aber keineswegs Bücher über Landwirtschaft, sondern studiert, was jetzt am meisten gebraucht wird: Geschichte und Philosophie.
Maurine war sein weibliches Gegenstück, nur war sie etwa zehn Jahre jünger, um die vierzig. Sie war so versessen auf ihre Hausarbeit wie George auf seine Zimmermannsarbeit. Was ihre geistigen Eigenschaften betraf, so war George etwas schwer von Begriff, aber Maurine war schlechthin dumm. – Und immer so weiter. – Es ist beinahe so, dachte Ish mit verzogenem Gesicht, als würde man überlegen, ob man jemand Bruderschaft anbieten soll oder nicht, und da die Auswahl nicht sonderlich groß war, durfte man nicht wählerisch sein. – Ja, der Satz könnte Ishs Mitmenschen auch gelegentlich durch die dumpfen Köpfe gegangen sein ...
Seht meine Werke, erbebt!
Kurzer Reality-Check: Über 20 Jahre nach der Pandemie ernährt sich die Gruppe immer noch fast ausschließlich aus Konserven, die man in den verlassenen Häusern findet. Beeindruckend, was der visionäre Leader da auf die Beine gestellt hat. Ish versagt als Farmer, als Arzt, als Lehrer (die Kinder sind einfach zu dumm ... er bleibt sich aber sicher, dass er einen fantastischen Professor abgegeben hätte) und schließlich auch in der eigentlich recht bequemen Rolle, die er sich vor allen anderen zugedacht hatte: als Planer und Überschauer. Als die Wasserleitung kaputtgeht, erinnert sich Ish zwar daran, öfters darüber sinniert zu haben, wo das Wasser eigentlich herkommt. Aber um nachschauen (und eventuell instand setzen) zu gehen, fand er dann irgendwie doch nie die Zeit.
Vielleicht war nur ein besonderer Mensch stark genug, der Welt seinen Stempel aufzudrücken. Über die Diskrepanz zwischen Ishs Selbstwahrnehmung und seinen tatsächlichen Leistungen musste ich mehrfach so herzlich lachen, dass das große Drama, das sich hier abspielt, fast an mir vorbeigeglitten wäre. Was dem Roman natürlich nicht gerecht würde – und tatsächlich folgt noch ein wunderschön-trauriger Schlussteil, der einen mit dem alt und hilflos gewordenen Ish wieder versöhnt.
"Leben ohne Ende" bleibt, alleine schon aufgrund seiner pionierhaft frühen ökologischen Ausrichtung, ein Klassiker. Ein Klassiker mit einer in jeder Beziehung aus der Zeit gefallenen Hauptfigur. Und mit einer Botschaft, die heutigen AutorInnen ans Herz zu legen wäre: Nämlich dass in einem postapokalyptischen Setting ruhig mal die Apokalypse selbst eine dauerhafte Hauptrolle spielen darf, anstatt nur dazu zu dienen, Governors und Negans als eigentlichen Spannungsbringern das Feld zu bereiten.

Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga 6"
Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 144 Seiten, € 22,70, Cross Cult 2016 (bzw. broschierte Originalausgabe, Image Comics 2016)
Eine kleine Verschnaufpause vom galaktischen Krieg gönnt uns der sechste Sammelband der beliebten SF-Familiensaga von Autor Brian K. Vaughan und Illustratorin Fiona Staples. Der Band, der die Hefte 31 bis 36 zusammenfasst und erneut einen großen Handlungsbogen bildet, ist gerade erst auf Deutsch erschienen. Nicht wundern, wenn hier trotzdem englische Textzitate aus der im Juli veröffentlichten Originalausgabe auftauchen: Man wechselt halt ungern mitten in einer Serie die Sprache, selbst wenn beide Varianten annähernd parallel "ausgestrahlt" werden.
Kindermund
Was bisher geschah: In der letzten Folge ist unsere sympathische Interspezies-Kernfamilie auseinandergerissen worden. Baby Hazel, je zur Hälfte den beiden bis aufs Blut verfeindeten Völkern von Wreath und Landfall entstammend, wurde entführt und in eine Erziehungsanstalt für außerlandfallische Kinder gesteckt. Wegen ihrer kleinen Hörner hält man sie dort für eine ganz normale Wreath, die Landfall-typischen Flügel hält sie unter dem Kleid versteckt. Als Hazels insektoide Kindergartentante die Flügel dann doch zu Gesicht bekommt, fällt sie in Ohnmacht und bricht sich fast das zarte Genick. Dass die beiden Spezies gemeinsame Nachkommen zeugen können, ist eine Wahrheit, für die die Galaxis noch nicht bereit ist.
"Most kids are still glorified props carefully shuttled from one secure location to the next. We're not children, we're eggs", sinniert Hazel an einer Stelle über die Rolle von Kindern in herkömmlichen Actionserien. Das ist hier natürlich ganz anders. Hazel fungiert nicht nur als im Rückblick allwissende Erzählerin der gesamten Saga. Sie ist es auch, die durch ihre bloße Existenz dem ewigen Krieg eine neue Wendung bescheren könnte. Und vielleicht sogar ein Ende.
Duos unter Dampf
Hazels Eltern Marko und Alana haben indes ihre Beziehungsturbulenzen überwunden und bilden ein dynamischeres – und sexyeres – Duo denn je. Während sie sich in Agentenmanier auf die Spur ihrer entführten Tochter setzen, werden andernorts auch Upsher und Droff wieder aktiv, jenes schwule Reporterpaar mit Meermannflossen, das hinter den Gerüchten von einem Mischlingskind die Story des Jahrhunderts wittert. Die beiden Duos werden es unterwegs mit alten Bekannten zu tun bekommen: "Saga" hat längst den Punkt überschritten, an dem NeueinsteigerInnen den Figurenkonstellationen noch folgen können.
Als neue Figur kommt nun Petrichor hinzu, ein Hermaphrodit aus dem Volk der Wreath, womit "Saga" seinem Ruf der Gender-Diversität treu bleibt. Hazel dazu: "I mean, I know diversity is an overused word these days, but without it, what would we be?" Die Antwort auf diese Frage wird gleich im anschließenden Panel folgen, und weil "Saga" auch seiner ironischen Grundausrichtung treu bleibt, wird sie im Rahmen einer Lesung aus einer schwülstigen Schmonzette gegeben werden. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass die Schnulzen von Dr. Heist einst Marko und Alana zusammengebracht haben. Und dass in ihnen echtes revolutionäres Potenzial schlummert: Vaughan deutet an, dass diese Rolle noch lange nicht ausgespielt ist.
Liebesgeschichten und Kopfgeldjagden
Da dieser Band hauptsächlich auf die Interaktionen der Hauptfiguren fokussiert, gibt es diesmal kaum Breitwandspektakel – Gesichtsausdrücke sind hier wichtiger als Weltraumgefechte. Für die optische Umsetzung der Actionsequenzen hat Fiona Staples aber wieder in Brehms Tierleben geblättert und wartet unter anderem mit sporenförmigen Weltraumminen auf, die riesige Bärtierchen ausspucken.
Im Vergleich zu früheren Bänden bietet "Saga 6" weniger Blut und mehr nackte Haut – die aber dafür in allen Farben, Musterungen, Beschuppungs-, Panzerungs- und Behaarungsvarianten, die man sich nur vorstellen kann. Insgesamt betrachtet ist der Band auffällig positiv gestimmt – wozu auch die Überraschung am Ende passt. Und schon wartet man gespannt auf Band 7. Wenn ich nur aufhören könnt!
The saga continues ...
Vor Weihnachten kommt noch einmal eine dicke, fette Rundschau. Und das eine oder andere Buch habe ich auch schon für das beliebte Jahres-Best-of zurückgelegt, das wie immer im Jänner folgt. Books galore! (Josefson, 5.11.2016)