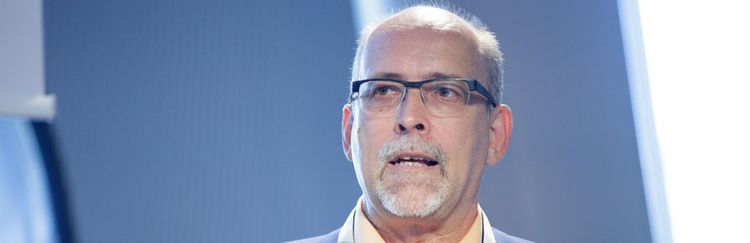
"Die unabhängige Justiz wird auch aus dem Budget finanziert, kein Mensch stellt deshalb ihre Unabhängigkeit infrage": Kronehit- und Privatsenderverbandschef Ernst Swoboda sähe die ORF-Gebühr und die GIS lieber abgeschafft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wäre am besten aus dem Bundesbudget zu finanzieren, sagt er.
STANDARD: Sie haben sich als Vorsitzender des Privatsenderverbands VÖP noch vor ein paar Wochen für eine Rundfunkabgabe für alle Haushalte ausgesprochen. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert?
Swoboda: Beginnen wir beim Grundproblem: Wir brauchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und den muss man finanzieren ...
STANDARD: Warum brauchen wir eigentlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Swoboda: Man braucht ihn wahrscheinlich weniger dringend als vor einigen Jahrzehnten. Damals sollte er die eine, unabhängige Informationsquelle sein. Davon gibt es heute viele. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat aber jedenfalls einen Wert: Er kann Angebote machen, die ein rein kommerzieller, wegen der Werbung auf Quote orientierter Privater nicht machen kann oder will. Ich wäre sehr traurig, wenn es Angebote wie Ö1 nicht gäbe.
STANDARD: Aber die Rundfunkgebühren in heutiger Form finden Sie ungerecht.
Swoboda: Vor 50 Jahren war es sicher richtig, die Rundfunkgebühren an den Besitz von Empfangsgeräten zu knüpfen. Der Besitz des Gerätes deckte sich mit der Nutzung von ORF-Programmen – anders konnte man sie nicht empfangen, und was anderes konnte man auch nicht empfangen. Heute hat sich das massiv geändert. Jeder kann auf irgendeinem Weg ORF-Programme nutzen. Und nur ein Teil dieser Nutzung wird verrechnet. Wer ein Badezimmer-Radio hat, zahlt Gebühren, der Nachbar streamt zwar mit seinem Smartphone den ganzen Tag Ö3, zahlt aber keine. Also zahlt der mit dem Badezimmer-Radio für den Nachbarn mit. Das ist nicht gerecht. Und Sie haben zudem das strukturelle Problem der Schwarzseher – wer nicht zugibt, dass er oder sie ein Empfangsgerät hat, zahlt nicht.
STANDARD: Laut GIS gibt es nur drei bis vier Prozent Schwarzseher.
Swoboda: Das dachte man in Deutschland auch und entdeckte bei Einführung der Haushaltsabgabe: Es sind rund 15 Prozent.
STANDARD: Womit wir bei der Haushaltsabgabe wären – die Sie nun nicht mehr so gut finden.
Swoboda: Viele Länder gehen in die Richtung, und auch mein Reflex war: Alle Haushalte sollen zahlen, mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass die Gebühr dann pro Haushalt zehn bis 15 Prozent geringer ausfällt – bei gleichem Gesamtaufkommen.
STANDARD: Also: Warum doch nicht Haushaltsabgabe?
Swoboda: Bei genauerem Nachdenken, auch in vielen Gesprächen, zeigt sich: Wir sind ein Land mit einer riesigen Abgabenquote. Eigentlich sollte man die reduzieren und nicht neue Abgaben einführen, und das wäre eine Haushaltsabgabe für jene, die den ORF nur online nutzen. Und, grundsätzlicher: Was ist der Sinn von speziellen Abgaben? Sie differenzieren zwischen Menschen, die nutzen und dafür zahlen – oder eben nicht. Wer Auto fährt, zahlt Kfz-Abgabe, wer Rad fährt, der nicht. Oder man differenziert nach Ausmaß der Nutzung – etwa bei Wasser- und Kanalabgaben. Dort hat das auch Lenkungseffekte. All das gibt es beim Rundfunk nicht.
STANDARD: Weniger Fernsehen liegt eher nicht an der Rundfunkgebühr.
Swoboda: Schaut möglichst wenig öffentlich-rechtliches Fernsehen!, das wäre als Lenkungseffekt eher widersinnig. Also gibt es keinen Grund für eine eigene Abgabe. Und die Rundfunkgebühr ist eine eigene Abgabe, die einen gewaltigen Apparat für die Einhebung erfordert – die GIS hat 190 Angestellte und 130 freie Mitarbeiter.
STANDARD: Also: keine Abgabe, keine GIS – was dann?
Swoboda: Wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Infrastruktur begreift, wie Justiz, Wissenschaft, Straßen, reine Luft, dann kann man ihn aus den allgemeinen Abgaben, also aus dem Budget finanzieren.
STANDARD: Irgendwo muss man die 600 Millionen für den ORF – mit Bund und Ländern sind es 870 Millionen – aber auch im Budget hernehmen, wenn man die GIS-Gebühr streicht.
Swoboda: Wenn man will, findet man solche Beträge in der Größenordnung von nicht einmal einem Prozent der Budgetsumme. Ich brauche nur die Subventionen durchleuchten, Doppelt- und Dreifach- und nicht notwendige Förderungen streichen, die x-mal angekündigte Transparenz durchsetzen. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch die viel strapazierte Verwaltungsreform. Es gab gerade in der jüngeren Vergangenheit viel höhere Belastungen für das Budget, die angeblich nicht so gravierend waren.
STANDARD: Und wenn man das Geld nicht im Budget "findet"?
Swoboda: Dann ist die Haushaltsabgabe die zweitbeste Lösung. Ich finde sie nicht absurd oder schlecht, aber sie ist nicht notwendig. Die heutige Gebührenregelung ist absurd.
STANDARD: Klassisches ORF-Argument gegen Finanzierung aus dem Budget: Das erhöht die politische Abhängigkeit, mit jedem Jahresbudget hat die Regierungsmehrheit ein Drohpotenzial.
Swoboda: Ich halte das Argument für völlig daneben. Ich tu' mir schon sehr schwer, ernst zu bleiben, wenn mir jemand erklärt, der ORF müsse politisch unabhängig bleiben. Das ist er auch heute nicht.
STANDARD: Es könnte noch schlimmer kommen.
Swoboda: Es könnte immer noch schlimmer kommen, aber das hängt nicht an der Budgetfrage. Es gibt in unserem Staat Aufgaben, die ich für noch wichtiger halte als den Rundfunk: insbesondere die unabhängige Justiz, und die wird auch aus dem Budget finanziert. Kein Mensch stellt deshalb die Unabhängigkeit der Justiz infrage. Die Wissenschaft wird aus dem Budget finanziert. Und die privaten Medien bekommen ihre Förderungen auch aus dem Budget.
STANDARD: Bleibt das jährliche Drohpotenzial für den ORF mit jedem Bundesbudget.
Swoboda: Da greife ich gern einen Vorschlag von ORF-Generaldirektor Wrabetz auf: Wenn man ein System neu baut, kann man mit einer Reihe von Mechanismen vorsorgen, dass es keine so konkreten Abhängigkeiten von wechselnden Regierungen gibt.
STANDARD: Zum Beispiel?
Swoboda: Das Programmentgelt des ORF kann in einem genau definierten Verfahren von einer unabhängigen Behörde wie der KommAustria festgelegt werden. Da kann eine Regierung nicht sagen, er kriegt weniger oder mehr. Sie können eine Verfassungsbestimmung schaffen, dass der ORF dieses so festgelegte Programmentgelt auch zu bekommen hat. Das kann eine neue Regierung mit 51 Prozent nicht verändern. Aber mit Verfassungsmehrheiten ist natürlich alles veränderbar – auch die jetzige Regelung.
STANDARD: Ich nehme an, etwa bei ÖVP-Mediensprecher Werner Amon stoßen Sie mit ihrem Vorschlag auf offene Ohren.
Swoboda: Praktisch bei allen. Die Neos plakatieren gerade die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Die FPÖ hat ähnliche Vorstellungen. Es gibt nicht ganz so radikale Ideen auch bei anderen Parteien.
STANDARD: Ist es nicht verschämt oder verlogen, wenn ein Staat sagt: Wir streichen die Rundfunkgebühren – und zahlt dasselbe aus dem Budget?
Swoboda: Man muss ehrlich kommunizieren – und man kann dazusagen, dass man die Schieflage des bisherigen Systems bereinigt und sich einen teuren Apparat für die Einhebung spart. Die Botschaft kann durchaus ankommen.
STANDARD: Wofür bezahlt die Republik dann – und wie viel?
Swoboda: Man sollte dann auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag definieren. Der ORF macht relativ viel, was mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag relativ wenig zu tun hat – oder was nur dazu dient, seine dominante Marktstellung auszubauen und zu festigen und den Weg zum dualen Rundfunk zu verbauen. Er kauft um viel, viel Geld praktisch alle internationalen Rechte von Fiction bis Sport ein. Da könnte er wahnsinnig viel Geld einsparen, wenn er beim Rechtekauf wie die BBC, die ARD oder das ZDF oder viele andere Stationen agieren würde. Und im Radiomarkt könnte er sich zum Beispiel eine Million Euro netto im Jahr für Imagewerbung für einen Sender namens Ö3 ersparen, den 99,7 Prozent der Österreicher kennen. Die da beworbene "Musik, Musik, Musik" ist eher kein genuin öffentlich-rechtlicher Inhalt.
STANDARD: Fragt sich: Wie nagelt man den Pudding "öffentlich-rechtlicher Auftrag" an die Wand, wie fasst man diesen Auftrag?
Swoboda: Man muss natürlich darauf achten, dass man den Auftrag nicht zu eng definiert, der ORF ist ein Medium und muss sich als solches frei bewegen können. Aber wenn man einen Blick auf die Privatradioveranstalter wirft: Das sind auch Medien, für die gilt auch Medienfreiheit, aber die haben in ihren Zulassungsbescheiden sehr konkrete Vorgaben, was sie dürfen, welche Klangfarbe das Programm hat, welche Zielgruppe anvisiert wird, welche Nachrichten- und Serviceelemente es gibt, wie groß der Wortanteil ist und so weiter. Das alles haben Sie beim ORF nicht.
STANDARD: Wobei die Privatsender mit ihren Bewerbungen selbst diese Angebote definieren, die Behörde sucht sie danach aus und verpflichtet sie per Bescheid zur Einhaltung ihrer Versprechen.
Swoboda: Aber um diese Parameter zu ändern, müssen sie zwei Jahre auf Sendung sein, und sie brauchen die Zustimmung der Behörde aufgrund einer Marktanalyse. Die Privaten sind damit relativ genau definiert, der ORF aber nicht. Etwas Ähnliches kann ich auch dem ORF vorgeben.
STANDARD: Das ORF-Gesetz definiert schon jetzt einen recht umfangreichen Programmauftrag.
Swoboda: Der heutige Programmauftrag des ORF erweckt den Anschein, dass viel geregelt wäre. In Wahrheit sagt er aber fast nichts aus, weil er keine Quantitäten enthält. Nehmen Sie zum Beispiel die Vorgabe ausgewogener, "angemessener" Anteile von Information, Sport, Kultur und Unterhaltung im Gesamtprogramm: Der ist so für Radio nicht anwendbar, schon weil dort Sport keine wesentliche Rolle spielt. Für Radio ist aber auch nicht definiert, ob Musik dazuzählt. Und das Hauptproblem: Es gibt keinen definierten Wortanteil, und ohne Wortanteil gibt es de facto keinen Programmauftrag im Radio. Und weil die Anteile nur über alle Programme gemeinsam betrachtet "angemessen" sein müssen, kann der ORF dank Ö1 in Ö3, FM4 und den Regionalsendern machen, was er will. Das ist kein Programmauftrag. Und dafür braucht man keine öffentliche Finanzierung.
STANDARD: Sie haben doch sicher eine Vorstellung dafür.
Swoboda: Wenn ich mich in die Nutzer und Gebührenzahler hineinversetze: Sie sollen in jedem Programm des ORF den öffentlich-rechtliche Mehrwert in irgendeiner adäquaten Weise erkennen. Das meint nicht zwei Stunden Talkrunde zur Priesterehe auf Ö3 oder zwei Stunden Sportübertragung. Soll's eine Stunde über Hintergründe von Popsongs sein, durchaus mit Musik hinterlegt.
STANDARD: Der ORF würde hier wohl argumentieren, Ö3 ist wegen seiner Information, seines aufwendigen Verkehrsfunks und seiner vielen karitativen Aktionen zutiefst öffentlich-rechtlich.
Swoboda: Ein bisschen wird schon da sein, aber es ist nicht viel – und nicht viel mehr als bei Privatsendern. Ö3 hat etwa einen geringeren Wortanteil als Privatsender. Es wird im Radio jedenfalls eine Vorgabe über den Wortanteil brauchen wie bei den Privatsendern.
STANDARD: Welchen Wert wünschen Sie dem ORF da?
Swoboda: 25 Prozent, gesetzlich verankert, wären schon ausreichend. Für jedes Radioprogramm des ORF müsste zudem ein bestimmter Mindestprozentsatz von Information, Kultur und Unterhaltung festgelegt werden. Und: ORF-Sender dürfen ihr Programm nicht einfach verändern können, wie sie wollen. Die Privaten dürfen ihre Programme nur nach behördlicher Genehmigung und unter bestimmten Auflagen verändern – der ORF kann das ziemlich frei tun. Und er tut es auch, um in Nischen halbwegs erfolgreichen Privatsendern umgehend Konkurrenz zu machen. Der Privatsender ist aber per Bescheid auf diese Programmierung festgelegt.
STANDARD: Und was tun Sie jetzt mit diesen Ideen?
Swoboda: Wir reden mit Vertretern aller politischen Parteien und stoßen eigentlich überall auf Verständnis. Aber damit es nicht bei dem Verständnis bleibt, müssen wir uns aufraffen und, im Gespräch mit politischen Repräsentanten, ein Konzept erarbeiten, das bis hinein in die Formulierung von Gesetzesvorschlägen geht.
STANDARD: Wann werden Sie die vorlegen?
Swoboda: Spätestens eine Woche vor der ORF-Enquete, die Medienminister Thomas Drozda für kommendes Frühjahr angekündigt hat. (Harald Fidler, 16.11.2016)