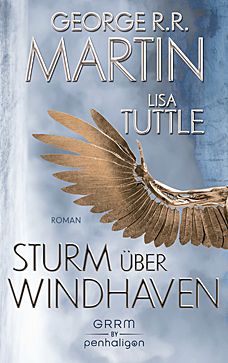
George R. R. Martin & Lisa Tuttle: "Sturm über Windhaven"
Klappenbroschur, 448 Seiten, € 15,50, Penhaligon 2017 (Original: "Windhaven", 1981)
Die Rundschau startet diesmal mit einer Wiederveröffentlichung: "Windhaven" wurde auf Deutsch zuletzt Mitte der 80er veröffentlicht und verdankt sein Neuerscheinen natürlich nur der Zugkraft von George R. R. Martins Namen im Fahrwasser von "Game of Thrones". Das schließt ein willkommenes Wiederlesen aber keineswegs aus. Der Roman stammt aus der Zeit, als GRRM noch in Science Fiction machte – wobei die SF der 70er und frühen 80er oft mehr als nur einen Touch Fantasy hatte. Im Mittelpunkt standen dabei Gesellschaftssysteme, die sich den exotischen Umweltbedingungen auf anderen Planeten angepasst haben; gerne waren es Zivilisationen auf niedrigem technologischem Stand. "Windhaven" ist ein Paradebeispiel dafür.
Der Hintergrund: Vor einigen Jahrhunderten ist ein Raumschiff der Menschheit durch einen Unfall auf dem Planeten Windhaven gestrandet. Vom technischen Erbe sind nur die einstigen Hightech-Sonnensegel übriggeblieben – wenn auch portionsweise zurechtgeschnitten. Denn Windhaven ist eine windumtoste Wasserwelt, in deren Meeren sich Plesiosaurier-artige Ungetüme tummeln. Der sicherste Weg, die Verbindung zwischen den verstreuten Inseln aufrechtzuerhalten, auf denen die Nachfahren der Schiffbrüchigen siedeln, führt daher durch die Luft. Zuständig dafür ist die Kaste der Flieger mit ihren seit Generationen weitervererbten Flügeln aus Metallfolie (anders als es das Titelbild suggeriert, dürfen wir sie uns übrigens nicht wie Vogelflügel vorstellen, sondern eher wie die Schwingen eines Pteranodons).
Drei Teile
GRRM hat den Roman 1981 zusammen mit der befreundeten texanischen Autorin Lisa Tuttle geschrieben, deren Werk sich über nahezu alle Subgenres der Phantastik erstreckt; der Großteil davon ist allerdings nie ins Deutsche übersetzt worden. "Windhaven" war ihr erster Roman und basierte ursprünglich auf einer gemeinsamen Novelle Martins und Tuttles, der sie rasch ein Sequel folgen ließen. Schließlich ergänzten sie die beiden Erzählungen mit einem eigens für die Sammelausgabe geschriebenen dritten Teil. Aufgrund dieser Entstehungsgeschichte gliedert sich der Roman in drei durch Zeitsprünge getrennte Abschnitte. Trotzdem ist er schöner in sich abgerundet als so manches Werk, das von Anfang an als Roman konzipiert war. Den übergreifenden Rahmen bilden der Lebensweg der Fliegerin Maris und die von ihr ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungen auf Windhaven.
Nachdem wir Maris im Prolog als Mädchen kennengelernt haben, in dem der Traum vom Fliegen geweckt wird, beschreibt die erste Novelle, wie ihr dieser Traum wieder zu entgleiten droht. Als Teenagerin ist sie eine ebenso begeisterte wie talentierte Fliegerin und hofft, die Flügel ihres Adoptivvaters zu erben. Doch verlangt es die Tradition, dass dessen später geborener leiblicher Sohn Coll das Erbe antreten soll – auch wenn sich der in der Luft gar nicht wohl fühlt und viel lieber Sänger wäre. Diese Ungerechtigkeit will Maris aber nicht hinnehmen, und so setzt sie eine Veränderung in Gang, deren Folgen sich durch den gesamten weiteren Band ziehen werden.
Könnte man diese Erzählung noch als klassische YA-Fantasy qualifizieren (inklusive der Botschaften von Versöhnlichkeit und Du-kannst-alles-erreichen-wenn-du-nur-wirklich-willst), so fallen die darauf folgenden Teile spürbar erwachsener aus – entsprechend Maris' Älterwerden.
Das Ende der Unschuld
In der zweiten Novelle, sieben Jahre nach der ersten angesiedelt, baut sich ein Konflikt zwischen den althergebrachten Flieger-Familien und den AbsolventInnen der neuen Akademien auf, in denen nun auch Landgebundene das Fliegen erlernen können. Um Flügel dauerhaft besitzen zu dürfen, muss ein solcher Emporkömmling aber erst mal jemanden aus dem Flieger-Erbadel in einem Wettbewerb schlagen. Diesen Konflikt setzen Martin und Tuttle in einer Reihe interessanter Personenkonstellationen um: allen voran das Dilemma Maris', die für eine solche Akademie arbeitet und nun damit zu kämpfen hat, dass sie Mitschuld trägt, wenn einer ihrer alten Fliegerfreunde seine Flügel an einen ihrer Schützlinge verlieren sollte. Denn niemand würde freiwillig auf seine Flügel verzichten: Der Roman hält sich mit Beschreibungen der planetaren Umwelt zurück, widmet sich dafür aber umso ausführlicher dem Gefühl des Fliegens, um die Sehnsucht der ProtagonistInnen nach dem Leben in der Luft spürbar werden zu lassen.
Im melancholischen dritten Teil schließt sich dann der Kreis. Maris ist inzwischen alt und nach einem Absturz nicht mehr in der Lage zu fliegen. Zudem hat sich die Lage auf Windhaven zugespitzt: Der Konflikt zwischen alten und neuen Fliegern wächst und einer der Inselherrscher ist drauf und dran, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Ein letztes Mal wird Maris' Kraft, die Geschichte in neue Bahnen zu lenken, gebraucht. An dieser Stelle wird man sich vielleicht an ein Gespräch aus der ersten Novelle zurückerinnern: "Gut, dass ich ein Sänger bin, sonst gingen wir als die größten Verbrecher in die Geschichte Amberlys ein." "Und wie soll uns dein Sängerdasein davor schützen?" "Wer, denkst du, schreibt die Lieder? Ich werde uns zu Helden machen." Beispielhaft dafür, wie durchdacht konstruiert "Windhaven" trotz seiner Entstehung aus Einzelteilen ist, zieht sich nämlich auch das Motiv vom Kampf um die Deutungshoheit durch den ganzen Roman, vom unbeschwerten Anfang bis zum wunderbar beschriebenen Ende.
Wirklich eine sehr schöne Wiederentdeckung! Nun aber geht es weiter mit aktuellen Büchern. Und mit dem ersten springen wir von der gefühlvollen Science Fantasy ins kalte Wasser der Hard SF.
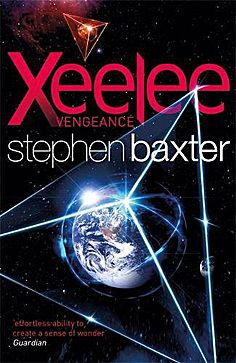
Stephen Baxter: "Xeelee: Vengeance"
Broschiert, 432 Seiten, Gollancz 2017, Sprache: Englisch.
Stephen Baxter gibt den J. J. Abrams, wer hätte das gedacht! "Vengeance" ist der erste Xeelee-Roman seit zwölf Jahren und kommt als waschechtes Reboot daher. Und wie bei den neuen "Star Trek"-Filmen steckt auch hier ein folgenschwerer Besuch aus der Zukunft dahinter. Da Baxter aber zugleich sein eigener Gene Roddenberry bleibt, werden Altfans hier auch viele Kontinuitäten und Anknüpfungspunkte an die frühen Xeelee-Romane sowie an die "Destiny's Children"-Reihe finden. Sowie zum Drüberstreuen Verbeugungen vor Edgar Rice Burroughs' "Barsoom"-Abenteuern sowie ein bisschen sogar vor "Star Trek" selbst: Das Cover zeigt eine Xeelee-Waffe, die doch ziemlich an den Käfig der Tholianer aus der Original-Serie erinnert.
Aus der sage und schreibe Jahrmilliarden umfassenden Future History der Xeelee-Sequenz hat sich Baxter eine Phase herausgegriffen, die einerseits ein Schlüsselmoment der Menschheitsgeschichte ist und andererseits den Neueinstieg sehr leicht macht. Denn die Welt des Jahres 3646 entspricht ganz dem, was man sich als Leser von klassischer, positiv ausgerichteter Science Fiction erwartet: Die menschliche Zivilisation ist friedlich unter der UN-Flagge vereint, hat einige Himmelskörper im Sonnensystem kolonisiert und die vom Klimawandel verwüstete Erde wieder begrünt. Auf das vernünftige Maß von einer Milliarde abgeschlankt, erfreuen sich die Menschen dank Anti-Senescence-Behandlungen einer fast unbegrenzten Lebensspanne. Und sie leben in gewaltigen Hightech-Türmen, damit sich draußen die sorgfältig bis ins Pleistozän rückgezüchtete Tierwelt tummeln kann. Freie Fahrt für freie Mammuts!
Ab jetzt alles anders
Um die Vernetzung des Sonnensystems voranzutreiben, hat der junge Visionär Michael Poole ein Wurmloch-Portal zwischen Jupiter und Erde gebaut. Noch vor der offiziellen Eröffnung bricht daraus jedoch etwas hervor, das Michael und seinen Zeitgenossen völlig unbekannt ist, das wir LeserInnen jedoch sofort als ein Raumschiff der Xeelee wiedererkennen – jener Spezies, gegen die die Menschheit einen unendlich lang erscheinenden und letztlich vergeblichen Krieg führen wird. Doch sollte das erst viel später geschehen. Beim Anblick des schwarzen, wie der Samen eines Berg-Ahorns geformten Schiffs geht Michael nur ein Gedanke durch den Kopf: "You do not belong." Als wüsste er, dass sich mit diesem vorzeitigen Kontakt die Zeitlinie, wie wir sie bisher aus der Xeelee-Sequenz kannten, radikal geändert hat.
Und durchs Portal kommt noch ein weiteres zu diesem Zeitpunkt nur uns bekanntes Wesen: ein Silbergeist, Angehöriger einer lange mit der Menschheit verbündeten und später fast von ihr ausgelöschten Spezies. Er kündet vom großen Krieg der Zukunft und nennt explizit Michael Poole, dem zu Ehren man auf einem Planeten im Herzen der Milchstraße eine zwei Kilometer hohe Statue errichtet habe. Ob Michael es will oder nicht – nach dieser Ansage muss er sich damit abfinden, dass er ganz persönlich in Ereignisse von kosmischer Bedeutung involviert ist.
Und immer wieder Michael Poole
Michael Poole spielte bereits in den wegweisenden Xeelee-Romanen "Das Geflecht der Unendlichkeit" (1992) und "Ring " (1994) eine zentrale Rolle. Immer wieder wurde er von Baxter aufgegriffen – und wenn nicht er selbst, dann jemand aus seiner Familie: zum Beispiel ein ebenfalls Michael heißender Poole, der die Welt im 21. Jahrhundert vor der Klimakatastrophe rettete.
Diese ständige Verwicklung der Pooles in großmaßstäbliche Ereignisse ist speziell der Pilotin Nicola Emry unheimlich. Sie wird zur Weggefährtin und treuen Kritikerin Michaels in diesem Roman. Wie jener Sklave, der im alten Rom bei Triumphzügen im Wagen des Imperators mitfuhr und ihm ständig "Denke daran, dass auch du ein Mensch bist" zuflüsterte, holt sie Michael immer wieder auf den Boden zurück. Er hat zwar keinerlei Interesse an Ruhm oder Macht, neigt aber dafür zu waghalsigen und folgenschweren Alleingängen. "This plan of yours. I imagine it's megalomaniac." He shrugged, tense. "I'm a Poole. Of course it's megalomaniac."
First Contact mit zunehmenden Turbulenzen
Also heften sich die beiden dem Xeelee-Schiff an die Fersen, das auf dem Merkur mal eben so einen gigantischen Würfel aus dem Boden zieht, der dort offenbar Milliarden von Jahren verborgen lag, und ihn anschließend in die Sonne tunkt. Auch dorthin folgen Michael und Nicola nach – ihre Pionier-Tauchfahrt ins Innere der Sonne erinnert an den Jupiter-Abstieg in "Die Medusa-Chroniken" in größerem Maßstab: And so they descended through great fountains, themselves hundreds or thousands of kilometres across, their structure and their cycling flows dimly visible in the neutrino images. Towers taller than worlds, all around them.
Das ist ziemlich atemberaubend und gibt Baxter wieder einmal Gelegenheit, jüngste astronomische Erkenntnisse einzubauen: Von neu erschlossenen Details der Merkuroberfläche bis zum Ring um Chiron finden wir hier einiges wieder, was in den vergangenen Jahren Schlagzeilen im Wissenschaftsjournalismus gemacht hat. Trotz des physikalischen Parforceritts, auf den uns Baxter hier mitnimmt, liest sich "Xeelee: Vengeance" aber leicht verständlich – auch auf Englisch. Daraus können wir getrost schließen: Der Mann weiß eben, wovon er schreibt.
Ein weiterer Charakterzug des Romans, der NeueinsteigerInnen entgegenkommt, ist der Umstand, dass Baxter ihn als klassische First-Contact-Geschichte angelegt hat: Menschen sehen sich mit den rätselhaften Aktivitäten einer technologisch weit überlegenen Spezies konfrontiert und versuchen sich mit ihr zu verständigen. Kennen wir. Freilich wissen wir aus früheren Werken Baxters auch, dass die Xeelee nicht für ihre Kommunikationsfreude bekannt sind. Und wir wissen weiters, dass es bei Baxter selten ohne Gewaltakte in weltenzerstörendem Ausmaß abgeht: Das sind leider keine guten Aussichten für unsere noch ahnungslosen Hauptfiguren.
Tolles Schmökererlebnis!
Baxter verschwendet nicht viele Worte auf die Charakterisierung seiner ProtagonistInnen, zeichnet sie aber – entgegen seinem Ruf – in indirekter Weise ganz plastisch: den immer wieder ungewollt zum Helden werdenden Michael, dessen manipulativen Vater Harry, der mit der Alien-Ankunft seine Chance gekommen sieht, nach der Macht zu greifen, und die skeptische, aber treue Nicola. Und nicht zu vergessen den knorrigen Weltraumveteranen Highsmith Marsden, der in seinem Kometenhabitat umsichtigerweise sofort die Lichter ausgehen lässt, um es vor den Aliens zu verbergen. Der alte Haudegen ist damit sogar Michael einen Schritt voraus:
"We have to plan for the worst case." Poole frowned. "Which is?" Marsden glared at him. "'Which is?' 'Which is?' What kind of question is that? Have you no vision at all, man? And they built you a statue at the centre of the Galaxy, did they? What does it have you doing, looking for your own arse by supernova light?"
"Xeelee: Vengeance" ist einmal mehr ein typisch Baxter'sches Breitwanderlebnis: Superhuman energies were being wielded on a superhuman scale. Das bereitet großen Spaß und zugleich großes Schaudern angesichts der Dinge, die da auf die Menschheit zukommen werden. Es endet mit einem Knalleffekt, der alles in eine neue Bahn lenkt, und das Schönste ist: Noch haben wir die Xeelee damit nicht zum letzten Mal gesehen. Für Mai 2018 ist bereits der Nachfolger "Xeelee: Redemption" angekündigt.

Martha Wells: "The Murderbot Diaries 1: All Systems Red"
Broschiert, 154 Seiten, Tor Books 2017, Sprache: Englisch.
Ein Prospektorenteam in Nöten: Erst wird eines der Mitglieder fast von einem Sarlacc-artigen Monster gefressen, dann stellt sich heraus, dass ein Warnhinweis auf diese Gefahr absichtlich aus der Datenbank gelöscht wurde. Weitere Unstimmigkeiten tauchen auf und schließlich reißt der Kontakt zu einem Konkurrenzteam auf der anderen Seite des neuerkundeten Planeten ab. Irgendjemand scheint das Projekt sabotieren zu wollen – aber wer und warum?
Murderbot hütet ein Geheimnis
So weit, so bekannt. US-Autorin Martha Wells stellt in ihren "Murderbot Diaries" aber nicht die menschlichen Mitglieder der Expedition in den Vordergrund, sondern die halbrobotische Sicherheitseinheit, die von einer Firma zusammen mit der übrigen Ausrüstung geleast wurde. Diese SecUnit ist im Grunde ein Cyborg, der auch organische Komponenten aus geklontem menschlichem Material enthält – zusammen mit Strahlenwaffen in beiden Armen und einem am Rücken montierten Geschütz (man sieht förmlich die Actionfigur vor sich). Was das Team nicht weiß: Die SecUnit überwacht es im Auftrag des Unternehmens. Und was weder das Team noch das Unternehmen weiß: Sie hat ihr Steuerungsmodul ausgeschaltet. Murderbot steht unter niemandes Kontrolle mehr.
Das klingt auch noch bekannt? Abwarten, genau hier setzt Wells' origineller Zugang zum Thema ein. Die SecUnit hat ihr Modul nämlich nicht etwa deshalb gehackt, um ihre Besitzer abzuschlachten und die Weltherrschaft an sich zu reißen ... sondern um ungestört durch die zahllosen Kanäle des galaktischen Unterhaltungsnetzwerks surfen zu können. Denn das ist es, was sie am liebsten tun würde: Den ganzen Tag lang Serien glotzen, in denen sie aus sicherer Entfernung die Irrungen und Wirrungen der seltsamen Menschen mitverfolgen kann, die ihr im realen Leben schwer auf die cybertronischen Nerven gehen.
Dieses gewisse Gefühl von Peinlichkeit
Wells legt ihrem/r geschlechtslosen Ich-ErzählerIn folgende Formel in den Mund, die zugleich das Erfolgsrezept des Kurzromans ist: murderbot + actual human = awkwardness. Und die gilt beiderseits. Dem Team wird's ungemütlich, als es sich der Tatsache stellen muss, dass unter dem getönten Visier der SecUnit ein menschliches Gesicht steckt. Nicht dass diese es unbedingt zeigen möchte, im Gegenteil. Sie zieht es jederzeit vor, im Frachtraum statt auf einem Passagiersitz mitzufliegen, um Konversation zu entgehen. Und wenn ihr das Gemenschel zu viel wird – manchmal wollen sie sogar mit ihr über ihre Gefühle sprechen, *schauder* –, dann dreht sie sich einfach zur Wand wie ein überfordertes Kind.
Das ist streckenweise hochkomisch. Aber nicht dass wir uns falsch verstehen: Wells hat hier keinen Schenkelklopfer abgeliefert. Die Pointen sind genauso unaufdringlich gesetzt wie die Spannungselemente – vom oben erwähnten Sarlacc-Pendant etwa erhalten wir nur einen flüchtigen Eindruck. "All Systems Red" vermittelt einen durchgängigen Eindruck von Leichtfüßigkeit: Als hätte die Autorin, die normalerweise in Fantasy-Reihen macht, zwischendurch mal etwas ganz anderes, etwas Kurzes und erfrischend Anstrengungsloses schreiben wollen. Ist hervorragend geglückt!
"As a heartless killing machine, I was a terrible failure"
Wenn wir alle Faktoren zusammenzählen, haben wir es im Grunde mit der Erzählstimme eines Blue-Collar-Workers in akademischem Umfeld zu tun. Sie klingt bei oberflächlicher Betrachtung schlicht gestrickt ("They don't give murderbots decent education modules on anything except murdering, and even those are the cheap versions."). Doch die SecUnit durchschaut auch vieles, das ihren hochgebildeten Schützlingen entgeht, kommentiert nüchtern die Firmenpolitik und gibt sich ganz allgemein keinen Illusionen hin. Ausdruck dafür ist nicht zuletzt die Bezeichnung "Murderbot" selbst: Die hat sie sich nämlich zwecks treffender Selbstbeschreibung ganz allein ausgedacht.
In den lästigen Pausen zwischen ihren Lieblingsserien spult sie ihr Arbeitsprogramm ab, gibt (selbstverständlich nur vor sich selbst) zu, dass sie einen halbherzigen Job macht, und tut doch alles Notwendige. Und sollte sie am Ende des Tages sogar noch in die Heldenrolle schlüpfen, dann selbstverständlich nicht, weil ihr ihre Schützlinge am Herzen liegen würden, sondern nur deshalb, weil es sich in ihrer Akte schlecht machen würde, wenn alle draufgehen. Sagt sie zumindest. Sie sagt aber auch, dass sie bei früheren Aufträgen schon jede Menge Leichen produziert hat. Es ist eine gelinde gesagt interessante Persönlichkeit, die Martha Wells hier für uns geschaffen hat. Weitere Facetten davon werden wir hoffentlich Anfang 2018 kennenlernen, wenn ein neuer Auszug aus den "Murderbot Diaries" erscheint. Der ist schon mal vorbestellt.

Hao Jingfang: "Peking falten"
Broschiert, 84 Seiten, € 13,40, Elsinor 2017 (Englischsprachige Ausgabe: "Folding Beijing", 2016. Original: 2014)
Lao Dao wandte sich um und sah, wie Peng Lis Mietshaus in zwei Teile zerbrach. Die obere Hälfte klappte langsam nach unten, sie bewegte sich direkt auf ihn zu – langsam, doch unerbittlich. [...] Die Faltung begann. [...] Die hoch aufgetürmten Bauten der Stadt rückten eng aufeinander und verschmolzen zu festen Blöcken; Leuchtreklamen, Vordächer von Läden, Balkone und andere vorspringende Bauteile wurden in die Gebäude hineingezogen, oder sie pressten sich als hauchdünne Auflagen an die Wände, gleich einer Haut. Kein Quadratzentimeter Raum blieb ungenutzt, wenn die Häuser in ihre kleinstmögliche Form gepresst wurden.
Es ist keine Katastrophe, die sich hier abspielt, sondern ein planmäßiger Vorgang, dem sich das Peking der Zukunft seit 50 Jahren einmal alle 24 Stunden unterzieht. In ständigem Turnus lösen die drei Sektoren der Stadt einander an der Oberfläche ab: Wird einer zusammengeklappt, entfaltet sich der andere – die BewohnerInnen der jeweils inaktiven Sektoren überdauern die Faltung in schützenden Kokons, in denen sie mit Betäubungsgas ruhiggestellt werden.
Das Bevölkerungswachstum und eine nahezu vollendete Automatisierung haben zu einer so umfassenden Arbeitslosigkeit geführt, dass es einer radikalen Lösung bedurfte. Die fand man darin, die Menschen nur noch in Schichten leben zu lassen. Im Grunde ist das die gleiche Idee wie in Philip José Farmers "Dayworld"-Reihe aus den 80ern, nur mit erheblich höherem technischem Aufwand. Der wiederum verblüffend dem Tuning in Alex Proyas Science-Fiction-Film "Dark City" aus dem Jahr 1998 ähnelt – siehe das Eingangszitat.
Die dreigeteilte Gesellschaft
Der fantastische Vorgang des Faltens dient der chinesischen Autorin Hao Jingfang aber ohnehin vor allem dazu, ein Bild der aktuellen Gesellschaft (nicht notwendigerweise nur der chinesischen) als Parabel zu tarnen. Denn die drei Sektoren entsprechen zugleich Schichten von sehr unterschiedlichem Wohlstand: Im Ersten Sektor residiert die Elite, fünf Millionen an der Zahl. Die Mittelschicht im Zweiten Sektor lebt mit 25 Millionen schon etwas gedrängter. Und im Dritten Sektor, wo die ArbeiterInnen zuhause sind, wimmeln auf gleichem Raum 50 Millionen Menschen. Der wichtigste Erwerbszweig ist hier die Aufarbeitung des Mülls aus den anderen Sektoren.
Während Sektor 1 einen vollen Tag an der Oberfläche verbringen darf, müssen sich die beiden anderen den gleichen Zeitraum teilen – und nicht einmal halbe-halbe: Für den Dritten Sektor bleiben nur einige Nachtstunden, und die sind großteils für Arbeit reserviert. Aber wer sollte sich über Ungerechtigkeit beschweren? Kontakte zwischen den Sektoren sind bis auf wenige Ausnahmen untersagt. Zudem sind alle drei Bevölkerungsteile ohnehin zu sehr mit ihren eigenen Belangen beschäftigt, um Gedanken an etwas so Nebuloses wie einen Systemwandel zu verschwenden.
Lao Dao gibt alles
In klassischer westlicher SF würde das ziemlich sicher auf ein Rebellionsszenario hinauslaufen, doch das wäre Hao Jingfang zu klischeehaft gewesen, wie wir schon im Vorwort erfahren. Nicht umsonst hat sie als Hauptfigur jemanden gewählt, der alles andere als ein Revolutionär ist. Lao Dao aus dem Dritten Sektor ist ein bescheidener Mann in mittleren Jahren, der in einer Müllentsorgungsanlage arbeitet und nicht von unerreichbaren Zielen träumt: Einen Sinn im Leben hatte er bisher nicht entdeckt, aber er hatte sich auch noch nicht in den letzten Ausweg geflüchtet, den Zynismus: er blieb einfach auf seinem bescheidenen Platz sitzen, den das Leben im bereitet hatte.
Erreichbare Ziele aber, die verfolgt er mit aller Konsequenz. Eines Tages hat er im Müll eine Flaschenpost entdeckt, mit der jemand gesucht wird, um illegale Botengänge zwischen den Sektoren zu machen. Da er Geld für die Ausbildung seiner kleinen Adoptivtochter braucht, klammert sich Lao Dao an dieser Gelegenheit fest – buchstäblich, wenn sich erst die Stadtlandschaft über und unter ihm zu falten beginnt.
Chinesische Science Fiction
"Peking falten" ist ein in jeder Beziehung ungewöhnliches Buch. Wenn man denn bei 84 Seiten überhaupt von einem Buch sprechen kann – das Format ähnelt einem Reclam-Heft. Selten genug, dass so etwas als eigener Band herausgebracht wird, zumal im volumensverliebten deutschen Sprachraum. Dass der Band im Elsinor-Verlag erschienen ist, den man nicht gerade als SF-Spezialisten bezeichnen kann, unterstreicht noch, wie ungewöhnlich diese Veröffentlichung ist.
Im Hintergrund steht der kleine Boom an chinesischer SF, der sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat bzw. erst jetzt als solcher im Westen rezipiert wird. Allen voran das Flaggschiff Cixin Liu ("Die drei Sonnen"), doch haben auch andere AutorInnen mittlerweile das Interesse westlicher Verlage und Fans geweckt. So erhielt Hao Jingfangs Erzählung im Vorjahr den Hugo Award für die beste Novellette. Besonders umtriebig in Sachen Förderung chinesischer SF ist der chinesisch-amerikanische Autor Ken Liu, der schon mehrere Werke durch eine Übersetzung ins Englische zugänglich gemacht hat – darunter auch dieses. Die deutsche Ausgabe ist eine Übersetzung aus dem Englischen, nicht aus dem Original.
Poesie durch Verzicht auf Schnörkel
Wenn Lao Dao im Ersten Sektor zum ersten Mal in seinem Leben einen Sonnenaufgang sieht, ist das ein bewegender Moment. Und dass die Autorin diesen nicht über Gebühr ausschlachtet, kann man als beispielhaft für ihre schlanke, elegante Erzählweise betrachten. Hier ist kein Wort zu viel. Das fühlt sich genauso stimmig an wie Lao Daos Reaktion auf das, was er während seiner Mission erlebt: Der Blick hinter die Kulissen seiner Welt offenbart ihm nur, wie weit er von deren Lenkung entfernt ist. "Peking falten" vollbringt das Kunststück, widerspruchsfrei gleichzeitig hoffnungslos und hoffnungsvoll zu sein. Das ist berührend und einfach schön.
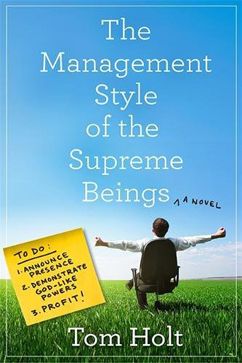
Tom Holt: "The Management Style of the Supreme Beings"
Broschiert, 400 Seiten, Orbit 2017, Sprache: Englisch.
Schon länger nichts mehr von K. J. Parker gehört (länger zumindest für die Verhältnisse von dessen Hochfrequenz-Output). Und das hier dürfte der Grund sein: Zum ersten Mal seit Jahren hat er wieder einen längeren Roman unter seinem Klarnamen Tom Holt veröffentlicht: eine willkommene Gelegenheit, einen Blick auf die Unterschiede zwischen den beiden Autoren-Personae zu werfen.
In beiden Inkarnationen setzt Holt auf Humor. Der ist bei Parker jedoch tiefschwarz, während die Holt-Romane gerne etwas alberner angelegt sind. Was sie übrigens nicht dümmer macht, das sei gleich zu Beginn festgestellt. Auch unter seinem wahren Namen widmet sich Holt Fantasy-Themen – hier jedoch nicht im Rahmen eines nach außen abgegrenzten Worldbuildings, sondern komplett freigespielt. Märchen- und SF-Motive vermischen sich darin munter mit bissigen Kommentaren zu unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Alleine schon, wie Holt die inhaltsleeren Phrasen von Wirtschaftszampanos 1:1 wiedergibt und demaskiert, indem er sie in einen neuen Kontext stellt, verdient Applaus. Das Ergebnis ist irgendwo zwischen Douglas Adams und Rob Reid ("Year Zero") angesiedelt; in seinen besten Momenten kommt es sogar dem frühen Terry Pratchett nahe.
Gott geht in den Ruhestand
Kommen wir zur Handlung: Das höchste Wesen ("Dad") findet das Gottsein nicht mehr wirklich prickelnd und beschließt, sich ein bisschen Quality time mit seinem eingeborenen Sohn ("Jay") zu gönnen. Der Zeitpunkt ist günstig, denn es liegt ein verlockendes Übernahmeangebot der Venturi-Zwillinge auf dem Tisch: Die haben sich aus dem Schlamm des Mars ganz schön hochgearbeitet und ein intergalaktisches Religions-Franchise gegründet, dem mittlerweile hunderte Millionen Planeten angehören. (Wenn sich die Beschreibung ihres Glaubenssymbols in unseren Köpfen zu einem Bild zusammensetzt, wird das übrigens eine gelungene Pointe abgeben.) Dass ihre jüngste Immobilie so nah an der alten Heimat liegt, freut sie besonders – und Dad kann endlich in Ruhe angeln gehen.
Für die Erde bricht ein ganz neues Zeitalter an, denn das althergebrachte Gut/Böse-Schema gehört nicht zur Unternehmensphilosophie der Venturis. Von jetzt an darf jeder lügen, stehlen, morden, wie er Lust hat ... vorausgesetzt, er bezahlt dafür den festgesetzten Betrag (die Preisliste findet man unter www.venturi-bros.div). Bei jeder Sünde poppt umgehend ein Teleportationsportal neben dem Missetäter auf, dem ein freundlicher Anwalt mit Quittungsblock entsteigt: "We don't take excuses, justifications or American Express." Und da die Preise geschmalzen sind, geht die Verbrechensrate auf Erden in Rekordzeit gegen null.
Es könnte ein neues Paradies sein – fühlten die Menschen sich nicht derart überwacht und unfrei, dass allgemeiner Trübsinn einkehrt. Vielleicht war das alte System von Glauben statt Offensichtlichkeit und Hoffnung statt Gewissheit unterm Strich ja doch nicht so schlecht, denkt sich eine kleine Schar von ProtagonistInnen, die mehr zufällig als geplant in die Rolle von systemfeindlichen Elementen rutschen. Dazu gehören eine Indiana-Jones-Parodie, eine Callcenter-Mitarbeiterin, die sich nicht auf die Rolle von Sidekick und Love Interest reduzieren lassen will ... und nicht zuletzt Gottes jüngerer Sohn Kevin.
Kleine Helden treten aus der Reihe
Dr. Jersey Thorpe lernen wir kennen, als er gerade in ein ägyptisches Grabmal einbricht. Er ist seit Jahren kryptischen Botschaften in alten Texten auf der Spur und schreckt auf seiner Queste vor illegalen Methoden keineswegs zurück: eine typische K. J. Parker-Figur, könnte man sagen. "The Management Style of the Supreme Beings" liefert jedoch ein Gegengewicht in Form von moralisch einwandfreien Figuren, wie man sie bei Parker mit dem Hubble-Teleskop suchen müsste. Zum Beispiel Lucy, die im Journaldienst der göttlichen Helpline als Aushilfe für Engel arbeitet und eines Tages Jerseys Hilferuf entgegennimmt: der Beginn einer wunderbar wechselvollen Beziehung, die so manches erzählerische Klischee gezielt unterlaufen wird.
Und so blütenweiß gut wie Kevin ist bei K. J. Parker überhaupt noch nie jemand gewesen. Dabei hatte der Arme es nicht gerade leicht: Als fast genauso sehr geliebter jüngerer Sohn Gottes hat man ihm zeitlebens voller Zuneigung vermittelt, dass er für das göttliche Geschäft einfach nicht geeignet ist. Und doch ist nun er es, der die Menschheit nicht im Stich lässt, als sich Dad und Jay abseilen. Nach Äonen des nicht ganz freiwilligen Herumdümpelns steht er nicht mehr unter Papas Wo-warst-du-als-ich-die-Grundfesten-der-Erde-erschaffen-habe-Blick und kann endlich aktiv werden – mögen die verbliebenen Erzengel ("Uncle Mike" und "Uncle Raffa") und der Heilige Geist ("Uncle Ghost") seinen neuen Tatendrang auch eher skeptisch betrachten: "I'd hate for you to be remembered as the boy who put the mess in Messiah."
Die Wege der drei Hauptfiguren kreuzen sich auf der Suche nach jemand oder etwas, mit dem sich die Venturis zum Rücktritt vom Kaufvertrag bringen lassen. Es wird ein Jemand werden – und zwar einer, der seit jeher die Guten von den Bösen unterscheidet und damit ganz dem Venturi-System zuwiderläuft. Wer? Nun, nicht umsonst hat Holt dem Roman eine verballhornte Version des "Herr der Ringe"-Gedichts vorangestellt, in dem einige weihnachtliche Motive auftauchen ... An dieser Stelle muss man freilich anmerken, dass Holt wie viele andere Contemporary-Fantasy-AutorInnen westlich-christliche Mythologien kurzerhand der ganzen Welt überstülpt. Der durchschnittliche Shintoist oder Hindu dürfte sich beim Lesen zu recht fragen: Und was geht das Ganze mich an?
Wer die Welt wirklich am Laufen hält
Eine Parallele zu Kevin finden wir in der vierten Hauptfigur Bernie Lachuk, der schon seit einiger Zeit in der Hölle den Laden schmeißt. Holts Roman ist ganz an ökonomischen Faktoren wie Outsourcing, Kostenreduktion, Effizienzsteigerung usw. festgemacht. Im Fall der Hölle – hier Flipside genannt – bedeutet das, dass Menschen (Squishies) von schreienden Opfern in Managerfunktionen befördert worden sind, weil das billiger kommt. Und das heißt in Bernies Fall, dass er sich jeden Tag mit dem ganz normalen bürokratischen Wahnsinn abrackern darf, während Luzifer golfen geht und seinen Mitarbeiter zwischendurch mit ein paar hohlen Lobesphrasen abspeist. Denn darauf läuft der im Titel angesprochene Managementstil der göttlichen Wesen letztlich hinaus, im Himmel wie in der Hölle: Sich im Rampenlicht sonnen, die eigentliche Arbeit von anderen machen lassen und salbungsvolle Worte als gleichwertigen Ersatz für eine Gehaltserhöhung betrachten. Klingt das vertraut?
Bernies große Stunde schlägt, als die Venturis die Welt übernehmen. Dank einer Sonderklausel im Kaufvertrag darf die Hölle weiterbestehen, sie bekommt nur keine neuen Sünder mehr geliefert und muss sich selbst finanzieren. Also baut Bernie sie zu einem Tourismusziel aus und bringt mit seinen Ideen für neue Attraktionen (Hell-on-ice) den Satan selbst zum Schaudern.
Weihnachtsgeschichte als wunderbare Sommerlektüre
"Hello? Is that the helpline? Listen, you've got to get an engineer over here as quickly as possible. The sun's just gone out." Another day in the office. – Holts Humor lebt davon, das Pompöse (also die Erschaffung der Welt und ähnliche Kleinigkeiten) auf die banalstmögliche Weise auszudrücken. Die daraus entspringenden Pointen sind mal holzhammermäßig, mal subtil, mal albern, mal fies und punktgenau ins schwarze Herz des Wirtschaftssystems getroffen – und fast immer gelungen. Holts 400-seitige Parade aus Gags, Wortspielen und Situationskomik macht den Roman zu einer vergnüglich-leichten Lektüre, ob an den jetzigen Hitzetagen oder thematisch passend zur Weihnachtszeit.
Und wie es sich für ein Werk religiösen Inhalts gehört, enthält "The Management Style of the Supreme Beings" zu guter Letzt auch eine Trostbotschaft aus göttlichem Mund, die wir Menschen uns glücklich in die Altäre meißeln dürfen: "By and large, you're an OK bunch of bipeds."
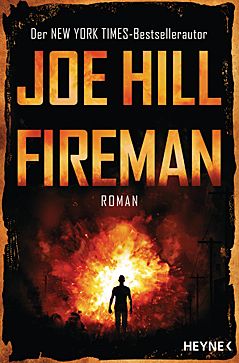
Joe Hill: "Fireman"
Broschiert, 960 Seiten, € 18,50, Heyne 2017 (Original: "The Fireman", 2016)
Ja, ja, lacht nur. Schaut auf die Seitenzahl oben und lacht. Das war natürlich keine absichtliche Ausnahme von der Rundschau-Regel, nichts mehr zu rezensieren, was 800 Seiten hat oder mehr. Ich bin schlicht nicht auf die Idee gekommen, dass bei einem Horror-Roman ähnliche Gefahr bestehen könnte wie bei einem Tolkien-Plagiat oder einer Neo-Weltraumoper, und habe das Buch blind bestellt. Was rückblickend im Fall von Joe Hill natürlich extra nachlässig war: Immerhin ist Papa Stephen King mit seinen Volumina schon lange der Rundschau entwachsen, und der Apfel fällt offensichtlich nicht weit vom langen, langen Stamm.
Auf der positiven Seite: Das Buch ist gut.
Der feurige Plot
"Fireman" ist ein postapokalyptischer Roman klassischer Prägung – außer was den Auslöser des Weltuntergangs betrifft: Spontane Selbstentzündung! Dragonscale heißt die Pandemie, die Menschen tattooartige schwarze Linien mit bezaubernden goldenen Pünktchen auf die Haut zaubert. Ist wirklich hübsch anzuschauen – bis sich die Befallenen in Rauch und Flammen auflösen, und zwar so explosionsartig, dass sie die umgebende Infrastruktur gleich mit abfackeln. Als (pseudo)wissenschaftliche Erklärung für diese bizarre Seuche reicht Joe Hill übrigens eine Pilzspore, Draco incendia trychophyton, die sich mit der Asche ihrer explodierten Opfer verbreitet. Dass es auf die naturwissenschaftliche Herleitung aber ohnehin nicht wirklich ankommt, zeigt der Umstand, dass einige Betroffene pyrokinetische Fähigkeiten entwickeln, welche diejenigen von Vater Kings "Firestarter" blass aussehen lassen.
Joe Hill hat schon ein gewisses Händchen für Ideen, die nach billigen Bühneneffekten klingen, im jeweiligen Roman dann aber doch irgendwie funktionieren. Siehe den verfluchten Anzug in "Blind" ("Heart-Shaped Box"), die Hörner, die dem Protagonisten von "Teufelszeug" ("Horns") wachsen, oder nun eben die menschlichen Waberlohen. Da verknüpft sich das Unerklärliche mit dem Banal-Alltäglichen zu surrealem Effekt:
Renée sah aus wie ein leuchtender Geist, wie eine vibrierende Silhouette aus weißem Licht mit üppigen weiblichen Umrissen. Nur das Muster der Dragonscale-Male hob sich von ihrem hellen Körper ab. Ihre Augen sandten blauweiße Strahlen aus und glichen tatsächlich den Todesstrahlen in einem Science-Fiction-Film aus den 1950er-Jahren. Ihre Topfpflanze hatte sie sich unter den linken Arm geklemmt. (...) "Macht euch keine Sorgen um mich, Jungs. Ich gehe jetzt besser raus, um zu explodieren, damit niemand verletzt wird."
Flucht aufs Land
Das Anfangsstadium der Pandemie erleben wir mit der Hauptfigur, der Krankenschwester Harper Grayson aus New Hampshire, in geraffter Form mit. (An der Stelle fragt man sich, wie es nach einem solchen Schnellzugstart noch über 900 Seiten weitergehen kann ...) Harper hat mit ihrem Ehemann einen Selbstmordpakt für den Fall einer Infektion geschlossen. Als sich dann tatsächlich Male auf ihrer Haut zeigen, hat sich die Lage aber grundlegend geändert: Harper ist schwanger geworden und will das Kind unbedingt noch zur Welt bringen. Also entwischt sie dem frustrierten Gatten und tut das, was im Weltuntergangsfall irgendwie alle immer tun: Sie flieht aufs Land.
Zuflucht findet sie in einem Camp, das von einem Pater und dessen Tochter geleitet wird. Über 100 Menschen leben hier – alle sind infiziert, scheinen die Krankheit aber dauerhaft unter Kontrolle zu haben. Statt zu verbrennen, strahlt man hier beim gemeinsamen Singen wie eine Weihnachtsreklame (das Große Leuchten). Das Harmoniegedusel in der Kommune klingt zwar sehr nach Hippie-Esoterik, funktioniert aber. Ein paar Alarmsignale sind freilich nicht zu übersehen. "All das, was zur eigenen Identität gehört, fällt von einem ab, und das wahre Selbst schält sich heraus", orakelt die Vizeleiterin die Kommunenphilosophie. Kontakt zur Außenwelt ist verboten wie in einer Sekte. Und spätestens die Hausregeln im Frauenschlafraum sollten alle Alarmglocken schrillen lassen. Die ebenso selbstgenügsame wie selbstgerechte Gemeinschaft wirkt, als wäre sie nur einen Schritt von der Zwangsherrschaft entfernt.
Der Feuer(wehr)mann
Der Titelfigur des Romans ist Harper zum ersten Mal in der Notaufnahme begegnet, als er sich mit einem kranken Jungen dreist an der Warteschlange vorbeidrängelte. Danach tauchte der Mann in Feuerwehruniform immer wieder in entscheidenden Momenten an ihrer Seite auf; er ist es auch, der sie ins Camp bringt. John Rookwood, so sein Name, lebt aber nicht mit den anderen zusammen, sondern bewohnt eine Hütte auf einer nahegelegenen Insel. John, meist nur Fireman genannt, ist ein Außenseiter. Und dass er Feuer nach Belieben manipulieren kann, ist nur eines der Geheimnisse, die ihn umgeben.
Kurioserweise ist der Fireman zwar die Titel-, aber in keiner Weise die Hauptfigur des Romans. Nicht einmal in dem Sinne, dass er – beobachtet durch die Augen der eigentlichen Hauptfigur Harper – zum Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse würde. Trotz seiner übernatürlichen Kräfte ist er nie der Lenker, sondern stets nur Harpers Helfer. Vorausgesetzt er braucht nicht gerade selber Hilfe: Schmächtig gebaut und zur Tollpatschigkeit neigend, stolpert John von einer Verletzung in die nächste, das entwickelt sich hier fast schon zu einem Running Gag á la Kenny in "South Park". Ungeschickt, kindsköpfig, zur Aufschneiderei neigend und dann wieder in sich zurückgezogen: All das macht den Fireman zu einem etwas unreif wirkenden, aber hochsympathischen Charakter. Nur nicht zu einem Helden. Spannende Entscheidung des Autors, den Roman nach ihm zu benennen.
Die Moral von der Geschicht
(Post-)Apokalypsen gibt es wie Sand am Meer, dann vergleichen wir "Fireman" doch gleich mit einer vier Jahrzehnte älteren Erzählung aus dem Hause King, "The Stand". Zumal Joe Hill hier während des Showdowns augenzwinkernd auf sie verweist (Die Hand! Achtet auf die Hand!). "The Stand" hatte in der ersten Hälfte sicher das weit glaubhaftere Pandemieszenario – leider war dieses danach aber mit einem Anfall von stockkonservativer Moral verknüpft: Hier gläubige und die Nationalhymne singende Dorfbewohner – dort die verlotterten Städter, die in Las Vegas dem Bösen anheimfallen.
Bei Joe Hill sieht das schon ausgewogener aus. Nicht umsonst erwähnt er mehrfach das berühmt gewordene "Kuschelhormon" Oxytocin: Das fördert bekanntlich die sozialen Bindungen in der Gruppe – allerdings ist es dem Hormon wurscht, ob diese Gruppe dann gemeinsam häkeln oder Leute massakrieren geht. Beide im Roman beschriebenen Gesellschaftsmodelle entwickeln sich in eine diktatorische Richtung. Im ach so harmonischen Camp machen sich nach einer Führungskrise Überwachung, Psychoterror und demütigende Bestrafungen breit. Und in der Außenwelt, den Resten der früheren Zivilisation, grassiert die Gewalt gegen Infizierte, bald gefolgt von religiösem Fanatismus.
Ist "Fireman" also hoffnungslos pessimistisch? Erstaunlicherweise keineswegs. Und einer der Hoffnungsschimmer im Roman liest sich noch einmal wie ein ironischer Kommentar auf die Moralinsäure von "The Stand". Auch hier empfangen die ProtagonistInnen nämlich Botschaften von einer Zufluchtsstätte, in der es eine Zukunft für sie geben könnte. Die kommen allerdings nicht von einer alten Vettel, die in einem Maisfeld hockt und mit Gott spricht, sondern von ... einer MTV-Moderatorin. Ältere LeserInnen werden sie vielleicht noch kennen.
Lang, aber nicht langweilig
Trotz seiner monströsen Länge war "Fireman" nicht der Roman, für den ich in dieser Rundschau am längsten gebraucht habe. Das liegt zum Teil daran, dass sich Horrorromane in der Regel schneller lesen als SF oder Fantasy, weil man während der Lektüre nicht ständig das ganze Worldbuilding im Hinterkopf mittransportieren muss. Aber es ist auch schlicht und einfach angenehm zu lesen, denn Joe Hill geht die Apokalypse erstaunlich unbeschwert an. Die Erzählweise lässt sich am ehesten charakterisieren wie der Fireman selbst: Sehr menschlich im Kern, um dann mit unschuldigem Blick immer wieder mal eine fiese Pointe rauszuhauen, die man ihr/ihm gar nicht zugetraut hätte. Etwa als eine Laiendarstellerin von einem Auto zerquetscht wird: Sie hatte gesagt, es sei sehr schwer, vor Publikum zu sterben, aber diese Szene hier war ihr leichtgefallen.
Noch kürzer ausgedrückt: "Fireman" ist ganz einfach unterhaltsam. Trotz Überlänge – es geschehen noch Feuerzeichen und Wunder.
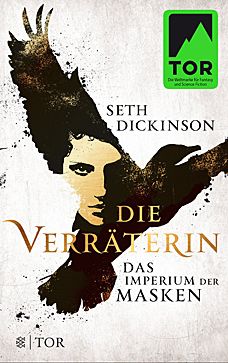
Seth Dickinson: "Die Verräterin. Das Imperium der Masken"
Klappenbroschur, 557 Seiten, € 17,50, Fischer Tor 2017 (Original: "The Traitor Baru Cormorant", 2015)
Was er sagt: "Es wird Turbulenzen geben und Verwirrung und Verderben. Das passiert, wenn etwas Kleines Teil von etwas Gewaltigem wird." Was sie sieht: [...] in diesen Augen erahnte sie ein ganzes Imperium, einen Mechanismus der Herrschaft, der sich aus der Arbeit vieler Millionen Hände selbst errichtete. Gnadenlos, nicht aus Grausamkeit oder Hass, sondern weil er zu gewaltig und zu fest auf seine Bestimmung ausgerichtet war, um sich für die kleinen Tragödien zu interessieren, die seine Ausbreitung mit sich brachte. – Perspektiven auf eine schleichende Invasion durch eine Großmacht ...
Hard Fantasy
Baru Kormoran ist noch ein Kind, als ihre Heimatinsel Taranoke dem Imperium der Masken einverleibt wird. Es geschieht nicht durch einen Eroberungskrieg, sondern ganz "sanft" durch sukzessives wirtschaftliches Abhängigmachen. Als eine Seuche ausbricht (es wird offengelassen, ob sie absichtlich verbreitet wurde) und das zuvor bestens funktionierende Gesellschaftssystem Taranokes zusammenbricht, übernimmt das Imperium von Falcrest die Verwaltung, krempelt die Insel zur Rohstoffquelle um und lässt auf die ökonomische Unterwerfung eine kulturelle folgen: In der rigiden Sexualmoral der Masken ist kein Platz mehr für die polyamorösen Traditionen Taranokes.
Es ist Kolonialismus wie aus dem Lehrbuch, den US-Autor Seth Dickinson hier in seinem Roman-Debüt beschreibt. "Die Verräterin" liest sich, als hätte er vorab die Thesen des Ökonomen und Anthropologen Jared Diamond ganz genau studiert. Dessen populärstes Werk heißt auf Deutsch "Arm und Reich", viel besser ist aber der Originaltitel, der die Vorteile der europäischen Kolonialherren gegenüber den indigenen Bevölkerungen der Neuen Welt griffig zusammenfasste: "Guns, Germs, and Steel".
Für Romane wie den vorliegenden gibt es im Englischen mittlerweile den Begriff "Hard Fantasy". Er bezeichnet Fantasy-Werke, die ohne Magie, übernatürliche Wesen, Drachen usw. auskommen und stattdessen ganz auf handfeste Realpolitik (Englisch: realpolitik) setzen – lediglich versetzt in eine fiktive Welt. Ein gutes Beispiel dafür sind die meisten Werke K. J. Parkers, auf deren Humoranteil Dickinson allerdings verzichtet hat. Wenn man will, könnte man "Die Verräterin" als Parker-Geschichte beschreiben, die mit den Mitteln von Ann Leckie erzählt wird. Zur Illustration, was Hard Fantasy bedeutet: Wenn Hauptfigur Baru, mittlerweile zur imperialen Beamtin geworden, zu einer "magischen Wunderwaffe" greift, handelt es sich dabei nicht um irgendein göttliches Artefakt, sondern um ... eine künstlich ausgelöste Inflation.
Werdegang einer Verräterin
Baru wird auf eine der neuen Schulen im Falcrester Stil geschickt und dort mit entsprechendem Gedankengut indoktriniert. Über die Jahre erweist sie sich als hochbegabt und erhält nach dem Abschluss einen bemerkenswert hochrangigen Posten: Man schickt sie als Reichsbuchhalterin in ein schon vor längerer Zeit annektiertes Gebiet, das notorisch aufrührerische Aurdwynn – ein Sammelsurium konkurrierender Herzogtümer, denen nur die Eigenschaft gemeinsam ist, dass sie sich schlecht beherrschen lassen.
Dort knüpft Baru eine Reihe von Beziehungen, die allesamt einen recht zweischneidigen Eindruck machen: etwa zur Herzogin Tain Hu (ein potenzielles Love Interest) oder zur Jurispotenzia Xate Yawa. Die Trennlinie zwischen FreundIn und FeindIn ist kaum je auszumachen – ein Spiegel der undurchsichtigen politischen Verhältnisse in Aurdwynn. Eindeutig ist nur eines: Von heroischer Gut-Böse-Fantasy sind wir hier Lichtjahre entfernt. Wenn es später zum Aufstand kommt und ein Krieg folgt, dann wird dieser so dreckig ausfallen, wie es nur geht: Realpolitik von ihrer allerhässlichsten Seite.
Innerer Konflikt
Mindestens ebenso wichtig wie die äußere Handlung ist aber der Konflikt, der sich in Barus Psyche abspielt. Auf der einen Seite sind ihr die Werte des Imperiums eingetrichtert worden; darüber hinaus ist sie von dessen wissenschaftlichen Fortschritten und nicht zuletzt seiner schieren Macht ehrlich fasziniert. Auf der anderen Seite hat sie nicht vergessen, dass das Imperium ihre Familie und ihre Kultur zerstört hat: ein guter Grund für Rache. Die Aufständischen wären damit eigentlich ihre natürlichen Verbündeten. Für welche Seite soll sie sich also entscheiden?
Schon früh hat sie den Beschluss gefasst, das Spiel des Imperiums mitzuspielen, um sich im System hochzuarbeiten und es dann von innen zu verändern. Und wie jeder, der sich für die Doppelagenten-Strategie entschieden hat, steht sie damit vor dem alten Dilemma: Wie weit soll sie fremde Interessen vertreten, um zu kaschieren, dass sie eigentlich das genaue Gegenteil erreichen möchte? An welchem Punkt kann sie es wagen, ihr wahres Gesicht zu zeigen? Tain Hu warnt sie, dass es irgendwann zu spät sein wird: "Du wirst keine Macht hinter der Maske finden. [...] Sie wird dich tragen, nicht du sie. Sie wird dir dein eigenes Gesicht wegfressen."
Ein faszinierendes Debüt, das Seth Dickinson hier hinlegt – wenn auch eines, für das man sich etwas Zeit nehmen muss. Und Zeit genommen hat sich auch der Autor selbst: Der Untertitel der deutschen Ausgabe suggeriert zwar, wie er da so steht, dass es sich um eine Reihe handeln würde, vorläufig gibt es aber nur diesen Roman. Dickinson ist den alten, ehrenwerten Weg gegangen und hat erst einmal eine Kurzgeschichte veröffentlicht, die er dann in den folgenden Jahren zum vorliegenden Roman ausarbeitete, anstatt gleich eine Trilogie aus dem Boden zu stampfen. Ebenso geruhsam kann es dann weitergehen: Den Entwurf für ein Sequel hat er erst vergangenen Monat bei seinem Verlag eingereicht.

Patrick S. Tomlinson: "The Ark. Die letzte Reise der Menschheit"
Broschiert, 416 Seiten, € 10,30, Knaur 2017 (Original: "The Ark", 2016)
Life imitates art! Oder doch art life? "Aluhutträger" ist in unseren Foren zum Modeschimpfwort geworden – in Patrick S. Tomlinsons "The Ark" hingegen wickeln sich manche Menschen wirklich Alufolie um den Kopf, um der allgegenwärtigen freundlichen Überwachung an Bord ihres Generationenschiffs zu entgehen. Selbst der Romanheld wird noch zu diesem Mittel greifen. – Schimpfwörter sind auf der interstellaren Reise dafür ganz andere in Umlauf: Die Besatzung nennt die Passagiere "Vieh", und die bezeichnen die oft in Schwerelosigkeit agierende Crew mit subtilem Humor als "Schweber". Der Originalausdruck floaters macht noch deutlicher, worauf dieses Bild gemünzt ist: auf Scheißeklumpen, die im Wasser treiben.
Das klingt jetzt allerdings konfliktärer, als das Szenario letztendlich ist. Denn alles in allem geht es an Bord der Arche, die seit 230 Jahren zum System Tau Ceti unterwegs ist, doch sehr zivilisiert zu. Allerdings wurden die Ahnen der aktuell 50.000 Menschen an Bord ja auch danach ausgesucht, dass sie genetisch divers und psychologisch stromlinienförmig sind, das wirkt immer noch nach. 50.000 ... und mehr gibt es auch nicht mehr. Ein Nibiru benanntes Schwarzes Loch ist nämlich ins Sonnensystem eingedrungen und auf die Erde zugesteuert – ein Generationenschiff nach Tau Ceti zu schicken, war eine letzte Verzweiflungstat vor dem Weltuntergang. Dass die Menschen an Bord damit nur eine Teilversion der Wahrheit wissen, werden wir gegen Ende sehen.
Der Plot
Gewaltverbrechen kommen an Bord eher selten vor. Da der US-Autor und Stand-up-Comedian Patrick S. Tomlinson sein Romandebüt aber als Weltraumkrimi angelegt hat, ist es genau einer dieser seltenen Fälle, der die Handlung in Gang setzt. Ein Genetiker ist verschwunden und wird später tiefgekühlt an der Außenhülle gefunden. Nach offizieller Lesart war es ein Selbstmord, doch der Polizist Bryan Benson ist anderer Meinung. Dass er seinem Verdacht nachgeht, bleibt natürlich nicht ohne Folgen: Schon bald wird auch auf ihn ein Anschlag verübt. Das alles geschieht ausgerechnet kurz vor der entscheidenden Flugphase, in der die Arche nahe am Ziel ist und ein gewaltiges Bremsmanöver eingeleitet werden soll.
Detective Benson ist eine erfrischende Abwechslung zum Klischee vom unbestechlichen Ermittlergeist im Körper eines abgesandelten Loners: Vor seiner Polizeikarriere war Detective Benson ein populärer Sportler (mal was Neues!) und hält sich immer noch fit. Und durch Verbitterung vereinsamt ist er auch nicht, stattdessen lebt er in einer zwar nicht legitimierten, aber alles in allem gut laufenden Beziehung mit seiner Kollegin Theresa. Nur in puncto Unbestechlichkeit entspricht er den Erwartungen. Allerdings müssen wir uns ein bisschen Sorgen um seine Kombinationsgabe machen. Tomlinson hat seinen Roman mit einigen überraschenden Twists angereichert – diese haben aber ungewollt auch den Nebeneffekt, die Spürnasenqualität des Helden in Zweifel zu ziehen. Und dass sich Benson mitunter sauber irrt, wird noch katastrophale Folgen haben.
Auf jeden Fall eine Extraerwähnung verdient hat sich noch die Nebenfigur Devorah Feynman: Eine ebenso verschrumpelte wie resolute Museumskuratorin, die auch im hohen Alter noch jedem zeigt, wo der Frosch die Locken hat.
Insgesamt betrachtet kein übles Debüt
"The Ark" ist ein Hybrid aus Krimi und Space Opera. Die Ermittlungen mit allem, was da eben so dazugehört, bestimmen zwar den Ablauf des Plots – doch darf man sich erwarten, dass das Motiv der Tat eines ist, das nur in einem SF-Kontext funktionieren würde (die Buchrückseite deutet meiner Meinung nach schon ein bisschen zu viel an). Es wird eine Auflösung geben und damit die aktuelle Handlung auch abgeschlossen sein. Keine Angst also, wenn jemand im Netz darüber stolpert, dass es bereits einen zweiten Band gibt und der dritte in Bälde folgt: Diese bauen zwar auf "The Ark" auf, doch ist deren Erwerb keine Voraussetzung für eine befriedigende Lektüre des ersten. EsistkeineTrilogieesistkeineTrilogieesistkeineTrilogie.
Was wiederum die SF-Aspekte anbelangt, hat Tomlinson gar nicht erst versucht, das alte Thema Generationenschiff unbedingt mit neuen Aspekten versehen zu müssen. Die Arche ist nach zwei Jahrhunderten zwar schon ein wenig abgenutzt – aber weit entfernt von den Visionen einer pilzverseuchten Todesfalle, der der Reihe nach alle Ressourcen ausgehen, wie sie Kim Stanley Robinson jüngst in "Aurora" heraufbeschwor. Wie um zu unterstreichen, dass sein Ansatz eher Old School ist, lässt Tomlinson seine Arche nach dem fast schon vergessenen Konzept des Orion-Antriebs (also mit seriell gezündeten Atombomben) fliegen. Und auch die wie schon erwähnt zivilisierte Bordgesellschaft hat eine gewisse Anmutung von Mitte 20. Jahrhundert.
Ja, der Roman erweitert nicht wirklich die Parameter des Genres. Und ja, die Übersetzung hätte an einigen Stellen noch nachgeschärft werden können. Aber ich wollte vom ersten Kapitel an wissen, wie's weiter- und ausgeht. Kernanforderung erfüllt.

Catherynne M. Valente: "The Refrigerator Monologues"
Gebundene Ausgabe, 160 Seiten, Saga Press 2017, Sprache: Englisch.
Spätestens seit Larry Nivens legendärem Essay "Man of Steel, Woman of Kleenex" von 1969, in dem uns der SF-Altmeister vorexerzierte, dass Supermans Sperma Lois Lane wie ein MG durchsieben würde, wissen wir: Es ist nicht immer leicht, mit einem Superhelden zusammen zu sein. Welche anderen Herausforderungen dies mit sich bringen kann, schildern uns hier sechs Frauen aus dem Superhelden-Umfeld, die US-Autorin Catherynne M. Valente vor den Vorhang bittet. Es sind übrigens allesamt Eigenerfindungen, auch wenn man in ihren Vitae gewisse Parallelen zu etablierten Comicfiguren findet, von LL über Harley Quinn bis zu Jean Grey.
Eine Bemerkung noch vorab: Eve Enslers "Vagina-Monologe", auf das Valentes Mosaik aus sechs verbundenen Kurzgeschichten ja offensichtlich anspielt, habe ich weder jemals gelesen noch gesehen. Sollte es also noch tiefer gehende Gemeinsamkeiten als den Titel und den Aufbau als Abfolge persönlicher Erzählungen geben, kann ich das nicht beurteilen.
Frauen in Kühlschränken
Der Ausdruck "Women in Refrigerators" geht auf die renommierte Comic-Künstlerin Gail Simone zurück. Sie stellte eines Tages fest, dass in ihrem Genre auffällig häufig auf das Motiv einer gewaltsam entsorgten Frau zurückgegriffen wird, um die Handlung voranzutreiben. Die läuft dann mit dem (männlichen) Helden weiter, der durch den Mord noch weiter angespornt wurde, für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Frau selbst hingegen ist nicht mehr von Belang – erst recht nicht die Persönlichkeit hinter der Leiche. Tot und in den Kühlschrank gestopft: Das Bild steht stellvertretend für die unterschiedlichsten Ausformungen dieser Erzähltechnik. Einer von Valentes glücklosen Protagonistinnen ist das sogar wortwörtlich widerfahren, und so verbringt Samantha Dane ihre letzten Minuten damit, sich von Gemüse und Milchprodukten zu verabschieden.
Die Palette ist recht weit gesteckt: Eine stirbt, als ihr Superheldenfreund sie beim Sturz aus großer Höhe auffängt und sie dabei den physikalisch unvermeidlichen Genickbruch erleidet. Eine spritzt sich eine Überdosis, eine andere wird beseitigt, nachdem sie eine Information preisgegeben hat, die für den Dauerkampf eines Helden mit dessen Nemesis wichtig ist. Ein paar der Erzählerinnen haben sogar selbst übermenschliche Kräfte, doch nützt es ihnen letztlich nichts. Am Ende sind sie tot und unbeachtet, und die "Boys" mit ihren Capes fliegen weiter. Trouble is, my story is his story.
Open Mic im Totenreich
Dass uns ihre Geschichten überhaupt zu Ohr kommen, liegt daran, dass es hier ein durchaus gemütliches Leben nach dem Tod gibt. Valentes sehr hübsch designtes Totenreich dürfen wir uns wie New York in einer Herbstnacht vorstellen. In den Cafés servieren freundliche Gargoyles eine heiße Tasse Nichts und aus dem Unterweltradio dudeln all die Lieder, die man auf Erden vergessen hat. Zu essen gibt es nur Fleisch von ausgestorbenen Tieren, aber das ergibt ja ein recht umfangreiches Menü: Valentes Speisenfolge liest sich, als hätte Carlton Mellick III ein paläontologisches Wörterbuch verschluckt. Und eine der vielen Bars nutzt der Hell Hath Club, zu dem sich unsere Erzählerinnen zusammengeschlossen haben, als zweites Wohnzimmer.
Auch sonst ist viel Kreativität im Spiel, insbesondere was die diversen Überwesen und deren bizarre Kräfte anbelangt: Da webt der Arachnochancellor sein Netz aus Illusionen, während der vom Musiklehrer zum Superschurken mutierte Doctor Nocturne alles Metall von New York City zum Schmelzen bringt, Victor Volatile seinen Boomsday Device zum Einsatz bringt und Koerzählerin Blue Bayou als Königin von Atlantis über ein Schrott-und-Müll-Reich gebietet: It's full of salt and sewage and tanker oil and mud and dead dolphins and fish poop and about a billion and four jellyfish. We don't live in Atlantis because it's a pristine paradise. We live there because we're weird, gross aliens and Brooklyn's full. Im Nachwort bekennt Valente, die Comic-Geschichte ausgiebig studiert zu haben, um unverbrauchte Namen und Kräfte zu finden.
Auseinandersetzung mit der Literatur
Catherynne Valente ist seit etwa einem Jahrzehnt im Phantastik-Geschäft und hat sich zu einer der originellsten und sprachmächtigsten Vertreterinnen der neuen Garde entwickelt. Das kann mitunter auch knifflig werden – hier etwa pflegt die Brandstifterin Pauline Ketch einen Slang, der Nicht-Englischsprachigen einiges abverlangt. Und vor zwei Jahren hätte Valente beinahe schon ihr Rundschau-Debüt mit "Radiance" erlebt, doch war mir der postmodern-fragmentarische Aufbau des Buchs für seine Länge dann ehrlich gesagt auf Dauer zu anstrengend.
Des Weiteren hat sie eine eindeutige Vorliebe für Metafiktionales. So landete sie einen ihrer größten Erfolge mit der Kindergeschichte "The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making", die als bloße Erwähnung in einem früheren Roman begonnen hatte, bis sie schließlich tatsächlich geschrieben und veröffentlicht wurde. Hier hat sich die Autorin nun auf besagtes "Women in Refrigerators"-Motiv gestürzt, über das sie sich laut eigener Aussage schon lange ärgert.
Einschränkungen
Unterhaltsam ist "The Refrigerator Monologues" ohne Frage. Da aber auch ein Anliegen dahintersteckt, reicht das zur Bewertung nicht aus. Und was das beabsichtigte Bloßstellen frauenfeindlicher Klischees anbelangt, fällt die Bilanz nicht ganz so eindeutig aus wie beim Unterhaltungsfaktor. Bei zwei Drittel der Erzählungen geht die Absicht auf. Aber da wäre auch Samantha, die angehende Kühlschrankleiche. Mehr als alles andere klingt sie neidisch auf ihren Freund, der durch ein Flohmarktartefakt Superkräfte erlangt hat. Es hätte nämlich auch umgekehrt kommen können, wie sie selbst sagt. Weniger Sexismus als Zufall steckte also dahinter – ersterer käme erst dann ins Spiel, wenn sich die "Zufälle" in Form ähnlicher Geschichten häufen, aber das lässt sich anhand eines Einzelfalls halt nicht illustrieren.
Ein anderes missglücktes Beispiel ist die Leidensgeschichte von Julia Ash, die in einer an die "X-Men" erinnernden Schule für begabte Kinder zur Heldin ausgebildet wird. Als sie nach einer kosmischen Kollision gewaltige Kräfte erlangt, die sie kaum kontrollieren kann, wollen die anderen (männlichen) Teammitglieder sie kaltstellen. So weit, so gut. Dass Julia daraus ganz selbstverständlich den Schluss ableitet, dass künftig weibliche Mitglieder generell schwächer als die männlichen sein werden müssen, ist aber ein Gedankensprung, den man nur vollziehen kann, wenn man einen Opfermythos lebt. Und das ist ein bisschen schade an Valentes insgesamt sehr interessantem Buch: So tough es sich im Ton gibt, zieht sich doch auch ein unverkennbares Aroma jener Opferhaltung durch, die in mittlerweile allen Teilen des demografischen Spektrums zeitgeistig geworden ist und langsam langweilt.

Greg Bear: "Die Rache des Titan"
Broschiert, 445 Seiten, € 10,30, Heyne 2017 (Original: "Take Back the Sky", 2016)
Über unseren Köpfen tut sich was. Wir hören das widerhallende, in die Länge gezogene Klagen des dicken Packeises. Es klingt, als würde ein Idiot in einer leeren Kathedrale auf der Orgel spielen. Dieses zutiefst beunruhigende und geistlose Geräusch wird noch vom leise knarrenden Klicken der Antag-Maschinen untermalt, die draußen in der Dunkelheit die Stellung halten. Warum machen sie uns nicht einfach kalt?
Ohne das Wort Antag könnte diese Passage glatt aus "Das Boot" stammen: Mucksmäuschenstill verharrt die Besatzung an Bord ihres U-Boots und wartet in atemloser Spannung darauf, ob der Feind sie entdeckt hat. Nur dass es sich im vorliegenden Fall nicht um ein U-Boot, sondern um einen künstlichen Hundertfüßer handelt, der in den Kohlenwasserstoffmeeren des Titan schwimmt. Sergeant Michael Venn und sein kleiner Trupp Skyrines sind im Vorgängerband "Im Schatten des Saturn" unter recht seltsamen Umständen auf den Saturnmond gebracht worden und trafen dort auf die Erzfeinde der Menschheit, die vogelähnlichen Antags. Nun sind die Kämpfe vorerst vorbei – das nervenzehrende Warten hat begonnen.
Military SF ohne Helden
Ähnlichkeiten zu "Das Boot" weist Greg Bears mit diesem Band abgeschlossene "War Dogs"-Trilogie aber vor allem in ihrer Ausrichtung auf. Sie rückt die Soldaten als Menschen in den Mittelpunkt. Nicht umsonst trägt der Roman zu Beginn die Widmung "Für diejenigen in meiner Familie, die als Angehörige der Streitkräfte weit gereist sind, und für die, die in Zeiten des Krieges zu Hause gewartet haben."
Venn & Co sind weder "Baby Killers" noch "Helden der Nation" (soweit die Extrempunkte der Palette an Zuschreibungen), sondern einfach Menschen, die ihren Job machen und ihre Kämpfe kämpfen, die Hintergründe zumeist nicht verstehen und manchmal auch feststellen müssen, dass sie belogen wurden. Wie es im konkreten Fall die vermeintlich wohlwollenden Gurus, außerirdische Mentoren der Menschheit, getan haben. Es ist eine vollkommen illusionslose Sicht auf den Krieg, die Bear mit anderen AutorInnen (etwa Linda Nagata in ihrer "Red"-Reihe) teilt. In Sergeant Venns Worten: Kriege sind blind, brutal und gemein. Sie kennen keine Moral.
+++ Spoiler-Grenze +++
An dieser Stelle sollten alle diejenigen zu lesen aufhören, die sich erst die Teile 1 und 2 genehmigen wollen, welche sehr gelungen sind und mit denen dieser Abschlussband leider nicht ganz mithalten kann. So geht es weiter: Nach der Konfrontation auf Titan ist Venns Grüppchen einen Waffenstillstand mit einer Abordnung der Antags eingegangen. Immerhin wissen die ehemaligen Feinde nun, dass sie bei großzügiger Betrachtung einen gemeinsamen Ursprung haben: Vor Milliarden Jahren entwickelte sich im äußeren Sonnensystem eine erste Hochzivilisation, die später Lebenssamen auf anderen Planeten ausstreute. Und bereits diese "Ahnen" – wegen ihres Aussehens schlicht Käfer genannt – bekamen es mit den Gurus zu tun, die in der Gegenwart Menschen und Antags gegeneinander aufhetzen.
Wir erfahren mehr über Biologie und Gesellschaftsform der Antags, als die beiden Gruppen an Bord eines gigantischen Guru-Schiffs gehen und einen Kurs sonnensystemauswärts einschlagen. Dieser möglicherweise lebendige Riesenkasten erweist sich als wahres Gruselkabinett – doch auch ohne das entrische Ambiente liegt Spannung in der Luft. Nicht nur zwischen Menschen und Antags herrscht Misstrauen, sondern auch innerhalb der jeweiligen Gruppe – denn soll man sich auf den (Ex-)Feind wirklich einlassen? Zudem sind mehrere Missionsmitglieder auf verschiedene Weise mit Alien-Technologie in Berührung gekommen und befinden sich seitdem in zunehmender Verwandlung zu etwas noch Unbekanntem. Und nicht zuletzt sind die Gurus Meister der psychischen Manipulation, man kann sich also nicht einmal unbedingt auf die eigenen Erinnerungen verlassen.
Allmähliches Verpuffen statt eines Schlussfeuerwerks
So weit, so potenziell spannend. Leider hat Bear aber einige dramaturgische Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt spannungsfördernd sind. Zum Beispiel haben die ProtagonistInnen schon sehr früh eine Arbeitshypothese über die wahren Motive der Gurus entwickelt, bei der es dann auch bleibt. Der Rätsel-Faktor ist damit dahin. Es wäre allerdings eine Überlegung wert, ob Greg Bear das Ganze als einen Meta-Kommentar auf die Sensationslust von uns LeserInnen gemeint hat.
Dazu kommt, dass sich die Figuren über den gesamten Roman hinweg ausgesprochen passiv verhalten. Zwangsweise eigentlich, denn die Technologie, die sie Station für Station weiterbefördert, übersteigt ihren Horizont. Venn vergleicht sich und die Seinen einmal passenderweise mit Rinderhälften im Transporter. Auch das ist eine sehr realistische Beschreibung des Soldatenlebens und passt damit zur Philosophie der Trilogie – es ist bloß nicht sonderlich mitreißend. Später werden noch umwälzende Ereignisse stattfinden, doch bekommen das unsere Beinahe-HeldInnen in ihrem abgeschlossenen Mini-Kosmos nur am Rande mit. Alle Kriege enden mit einem Wimmern, heißt es an einer Stelle. Für den Abschluss seiner Triloge hat Greg Bear das ein bisschen zu wörtlich genommen.
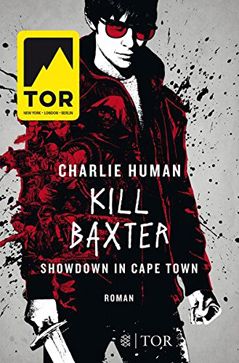
Charlie Human: "Kill Baxter. Showdown in Cape Town"
Broschiert, 349 Seiten, € 10,30, Fischer Tor 2017 (Original: "Kill Baxter", 2014)
"Die Welt ist gerettet, und ich bin trotzdem nicht mit mir im Reinen. Vielleicht gewöhnt man sich zu schnell daran; die Rettung der Welt muss jedes Mal spektakulärer werden, um denselben Dopamin- und Serotoninschub auszulösen wie die letzte." Da hat Autor Charlie Human aus dem Munde seiner Titelfigur das Kreuz mit Sequels schön auf den Punkt gebracht. Auch wenn Baxter damit eigentlich seine persönliche Entwicklung zum Helden gemeint hat – und wie unwahrscheinlich dieser Weg war, können wir im Vorläuferband, dem nicht-jugendfreien Jugendroman "Apocalypse Now Now", nachlesen. Wer das noch nicht getan hat, sollte hier zwecks Spoiler-Vermeidung zu lesen aufhören.
Ein zentraler Punkt des ersten Bands – nämlich die lange Zeit offene Frage, ob es sich beim Teenager Baxter Zevcenko um einen magisch begabten Dämonenjäger oder um einen paranoiden Serienmörder handelt – ist mittlerweile zu Baxters Gunsten beantwortet worden. Nicht nur wegen besagter Rettung der Welt ist Baxter eindeutig zu den Guten zu zählen – daran ändern auch sein manipulativer Charakter und sein schamloser Hedonismus nichts. Eigenschaften, die man ohnehin nicht auf die Goldwaage legen sollte, wie eine Psychologin anmerkt: "Und wenn er nicht so hart mit sich ins Gericht ginge, würde er begreifen, dass er nicht halb so verdorben und hardcore ist, wie er denkt. Aber sagen Sie das mal einem Teenager!" Das kann man übrigens auch gleich auf die Romane selbst umlegen: Auch die sind nicht so hardcore, wie sie sich gerne geben – aber immerhin unterhaltsam.
Baxter auf Harry Potters Spuren
Tatsächlich lässt sich Baxter ganz brav auf ein Internat schicken, auf dem er sein doppeltes magisches Erbe beherrschen lernen soll. Ganz bewusst streicht Charlie Human die offensichtlichen Parallelen zu Harry Potter heraus, um dem Ganzen dann einen Drall ins Punkige zu geben. Das Pendant zu Hogwarts heißt Hexpoort und erweist sich als Bootcamp in der Wüste, die SchülerInnen saufen, kiffen, rauchen Meth und haben Sex, wie's ihnen passt (solange sie fit genug für den erbarmungslosen Drill bleiben). Human zitiert Rowlings Bahnhof-Szene vor der Abfahrt zur Schule und bringt sogar einen Auserwählten mit schicker Narbe ins Spiel – der besetzt in dieser Geschichte allerdings die Rolle des Fieslings.
Und auch hier gärt es im Hintergrund ganz erheblich. Der MK6, also der für übernatürliche Wesen zuständige südafrikanische Geheimdienst, kann nur noch mit Mühe den Deckel auf der Welt der Verborgenen draufhalten. Die fühlen sich von der Regierung nämlich unterdrückt – eine Stimmung, die ein neuer Antagonist, der sogenannte Muti-Mann, schürt. Es droht eine Revolte der magischen Geschöpfe.
Psychosexuelle Entwicklung einmal anders
Mit dem Wegfall der Zweifel um Baxters Zuordnung zu Gut oder Böse hat Humans Erzählung natürlich einen wichtigen Teil ihrer Einzigartigkeit verloren. Rein vom Plotablauf her betrachtet, bleibt somit eine ganz konventionelle Contemporary-Fantasy-Geschichte. Da haben wir den magisch begabten Jugendlichen und seine mühevolle Ausbildung, neue Freunde und nervige Mobber an der Schule, die Vater-Sohn-Beziehung zum Ausbilder, erste Warnzeichen, dass sich etwas Böses zusammenbraut, die Schnitzeljagd nach Spuren des Feindes, Gefahrensituationen, Kämpfe und Verfolgungen – und schließlich einen apokalyptischen Showdown. Alles wie aus dem Lehrbuch.
Glücklicherweise ist Baxters Welt aber (in Humans Worten) mehr Hendrix als Bieber. Ob nun Kobolde Adidas-Trainingsanzüge tragen oder Elfen Pornos drehen: Charlie Human lässt Versatzstücke aus afrikanischen und europäischen Mythologien auf eine grelle (Halb)Welt aus Mode, Medien und Markenwahn respektive Sex, Drugs & Rock 'n' Roll prallen. Wenn Baxter zu einer Reise ins Innere angehalten wird, um sein Wahres Ich zu finden, brauchen wir uns also nicht zu wundern, dass ihm seine gestaltgewordene anale, orale usw. Phase als Mitglieder einer 70er-Jahre-Funkband namens "Psychosexual Development" entgegentreten und ihn zur Jam Session bitten.
Fortgang ungewiss
Im Original ist "Kill Baxter" schon vor drei Jahren erschienen, und interessanterweise gibt es – trotz einiger angedeuteter Entwicklungen, die nach einer Fortsetzung schreien – bislang keinen dritten Band. Möglicherweise hat Charlie Human sein Pulver fürs Erste verschossen. Immerhin werden hier Baxter und sein Lehrmeister von gepanzerten Eichhörnchen verfolgt, während rings um sie ahnungslose Ausflügler picknicken. Nicht zu vergessen das Massaker auf Kapstadts Fashion Week, bei dem sich nicht nur Kobolde, Feen und Zwerge, sondern auch minderjährige Boygroup-Fans und Radfahrer in Lycrahosen von ihrer blutrünstigsten Seite zeigen. Da muss man als Autor erst mal brainstormen, bis einem wieder etwas gleichermaßen Absurdes einfällt. Und wie schon eingangs gesagt: Es sollte doch bitteschön noch spektakulärer werden als beim letzten Mal.

Cullen Bunn, Jimmy Johnston, Max Dunbar & Chris Mercier: "Micronauts Volume 2: Earthbound"
Graphic Novel, broschiert, 152 Seiten, IDW Publishing 2017, Sprache: Englisch.
"Firefly" und "Guardians of the Galaxy" meets "Kampfstern Galactica" (die Originalserie): Der zweite Sammelband der neuen "Micronauts"-Comicreihe ist voll, und in dem werden die Titelhelden endlich ihrem Namen gerecht. Denn nachdem sie ihr Raumschiff Heliopolis in die Entropiewolke gesteuert hatten, die ihr heimatliches Universum langsam auffrisst, wurden sie in einer anderen Welt wieder ausgespuckt. Auf der Giganten leben ... nämlich wir.
Damit haben die sechs Micronauts jetzt exakt die Größe, in der das gleichnamige Spielzeug in den 70ern in den Regalen stand. Und mit diesem Handicap müssen sie die verwirrenden Verhältnisse auf der Erde auskundschaften wie weiland Alt-Starbuck & Co. Groß die Erleichterung, als sie auf ein planetenumspannendes Informationsnetzwerk stoßen, das ihnen die Orientierung erleichtern könnte, aber dieses sogenannte Internet hat auch seine Tücken: "The information is corrupted with pictures of some sort of small furry mammal and many images of naked females."
Wie der Plot weiterläuft
In Band 1, "Entropy", haben wir das halbe Dutzend Antihelden kennengelernt, das sich auf der Suche nach dem nächsten Coup plötzlich in einer Mission von kosmischer Bedeutung wiederfand. Der streitbare Cyborg-Krieger Acroyear, das für Komik sorgende Roboter-Duo Biotron und Microtron, die etwas chaotische Space-Gliderin Phenolo-Phi und die unnahbare Larissa mit ihrer Fähigkeit, Energieschilde zu projizieren: Es ist ein Ensemble, das schwerer zu bändigen ist als ein Sack voller Flöhe, weshalb der nominelle Anführer Oz auch seine liebe Not hat. Als Macho-Leader kommt er ohnehin nicht gerade rüber – mit seinem "ägyptischen" Kinnbärtchen sieht er jedenfalls eher wie ein Hipster-Barista aus als wie der parapsychisch begabte Pharoid, der er ist. Aber wenn's drauf ankommt, kann selbst der friedliebende Oz mal auf den Putz hauen: "Being a pacifist isn't a full-time decision."
Gut so, denn schon zu Beginn geht's ums Überleben. Auf der Erde finden sich die sechs in einer (para?)militärischen Einrichtung wieder und sehen einer Vivisektion entgegen – wäre da nicht die Wissenschafterin Rhonda Conway, die ihrem Gewissen nachgibt und den Winzlingen zur Flucht verhilft. Autor Cullen Bunn setzt also ganz auf einen Plot, der in der SF schon viele, viele Male verwendet worden ist. Zu den zwangsläufigen Verfolgungsjagden gesellen sich aber rasch weitere Elemente, die den künftigen Weg abstecken: Unser Sextett stößt auf andere Besucher aus dem Mikro-Universum, die schon viel früher auf der Erde angekommen sind. Und es zeichnet sich ab, dass die Erde ins Visier der Mächtigen daheim geraten ist. Ein Krieg zieht auf.
Was man (nicht) erwarten darf
Natürlich wäre es absurd, eine tiefschürfende Handlung von etwas zu erwarten, das auf einem alten Spielzeug-Franchise beruht. Zumal einem, das nicht einmal eine einheitliche Marke war wie die späteren "Transformers", sondern eine willkürliche Zusammenstellung verschiedener japanischer Produktlinien für den Vertrieb im Westen. Trotzdem interessant, wie sich der Ton verändert hat: Fußten die Original-"Micronauts"-Comics um 1980 noch auf einem traditionell-fantasyesken Helden-Schurken-Schema, so geht es die Neuausgabe weniger moralisch und dafür deutlich lockerer an.
Dazu gehört auch die notwendige Prise Humor: Ob nun Phenolo-Phi mit ihren Jetflügeln gegen die Windschutzscheibe eines verfolgenden Humvees klatscht wie eine Mücke, inmitten von Spielzeug ein tödliches Gefecht im Kinderzimmer tobt ("Toy Story" lässt grüßen) oder Acroyear auf der Suche nach versteckten Feinden den Klodeckel lüpft: Kleine Gags lockern die sechs hier versammelten Episoden auf und hauchen dem "Micronauts"-Universum trotz seiner Entstehungsgeschichte tatsächlich ein bisschen Leben ein. Selbst wenn Max Dunbars Zeichnungen immer wieder in Erinnerung rufen, worum es sich hier letztlich wirklich handelt: um perfekt in Szene gesetztes Spielzeug.
Und dieser knallbunte Retro-Spaß ist zugleich die geeignete Überleitung für die nächste Rundschau: Auch in der werden sich Zukunft und Vergangenheit mehrfach die Hände reichen. Die Palette reicht von einer jahrhundertealten Geheimgesellschaft von Robotern über ein Raumschiff namens Titanic bis zur Glorie der böhmischen Raumfahrtgeschichte. (Josefson, 5.8.2017)
Nachlese
Alphabetische Liste aller seit 2008 rezensierten Bücher