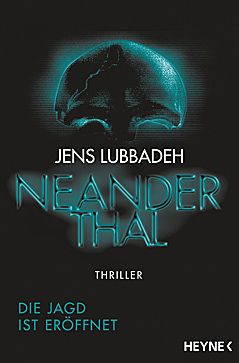
Jens Lubbadeh: "Neanderthal"
Klappenbroschur, 526 Seiten, € 15,50, Heyne 2017
Jens Lubbadehs ersten SF-Roman "Unsterblich" hatte ich seinerzeit unter "vielversprechend" abgelegt. Soll heißen: ansprechende Schreibe und viele gute Ideen – allerdings mangelnde Konsequenz beim Weiterdenken dieser Ideen und eine allzu simple Lösung am Schluss. "Neanderthal" ist da einen großen Schritt weiter, weil deutlich komplexer angelegt. Ein Indiz von mehreren: Die geklonten Mammuts, die hier in einem Kapitel auftauchen, spielen für die Handlung zwar eigentlich keine Rolle. Aber sie sind da – wie sie es in einer Welt mit weiterentwickelter Gentechnik mit ziemlicher Sicherheit wären. Und Gentechnik mit ihren vielfältigen Folgeerscheinungen ist das große Thema von "Neanderthal".
Orwell mit gesunden roten Bäckchen
Die augenscheinlichsten Auswirkungen hatte die Technologie aufs Gesundheitssystem: Mitte des 21. Jahrhunderts werden in Deutschland Präimplantationsdiagnostik und korrigierende Eingriffe in großem Stil angewandt, um Erbkrankheiten und andere unerwünschte Eigenschaften auszumerzen. Das steht im Kontext einer Gesundheitspolitik, die alle Züge einer eugenischen Diktatur angenommen hat. Tracker oder Körperimplantate messen, ob man brav sein tägliches Bewegungssoll erfüllt, den Rest erledigt die soziale Kontrolle: Wer Fleisch isst oder statt der Treppe den Fahrstuhl benutzt, wird schief angesehen und vielleicht auch gleich bei der Krankenkasse denunziert. Für Ehrenmorde – soll heißen die Tötung Behinderter – gelten vor Gericht mildernde Umstände.
Das hat Orwell'sche Züge – nicht von ungefähr gibt es hier ein Ministerium für Gesundheit und Glück. Dass Lubbadeh wie schon in "Unsterblich" seiner Romanwelt erneut einen Retro-Look verpasst hat, unterstreicht das noch. Mann trägt Hut, Frau eine Frisur wie aus "Babylon Berlin", und die versteckten Lokale, in denen man sich Burger und Pommes reinziehen kann, werden wie damals während der Prohibition in den USA "Speakeasys" genannt.
Ensemble und Plot
Vor diesem Hintergrund bringen ein aktueller Mord und mehrere länger zurückliegende ein Grüppchen sehr unterschiedlicher Figuren zusammen. Zunächst den Düsseldorfer Kommissar Philipp Nix, der sich herzlich wenig um die Einhaltung seines Gesundheits-Solls schert, seiner Arbeit aber mit vollem Einsatz nachgeht. Die dürfte ihn auch ein wenig von seinen familiären Problemen ablenken – unter anderem leidet sein Sohn an der Großen Depression, einer nicht behandelbaren psychischen Krankheit, die sich trotz des staatlichen Gesundheitsbombardements immer weiter auszubreiten scheint.
Max Stiller ist als einer der letzten Gehörlosen ebenfalls ein Sonderling im neuen System. Möglicherweise hat Lubbadeh persönliche Erfahrungen mit Gehörlosigkeit, jedenfalls gelingt ihm eine sehr glaubhafte Personenzeichnung. Max ist selbstbewusst, durchaus mal kratzbürstig (kein gönnerhafter Behindertenbonus, zu dem Autoren in solchen Fällen gerne neigen würden!) und blickt amüsiert auf das, was er das große Hörenden-Theater nennt: Also wenn Menschen in seiner Umgebung mit komischer Mimik auf etwas reagieren, das ihm natürlich entging.
Max ist Paläoanthropologe. Dass er zusammen mit seiner Kollegin Sarah Weiss dem Fall hinzugezogen wurde, liegt daran, dass der Ermordete genetisch zur Hälfte ein Neandertaler war. Die anderen, früheren Mordopfer, die man anschließend findet, waren es sogar zur Gänze. Und schon stecken unsere Protagonisten im Sumpf eines gentechnischen Geheimprojekts mit gesamtgesellschaftlichen Implikationen. Als ihre Gegenspielerin positioniert sich dabei Eva-Marie Mercure, eine graue Eminenz im Gesundheitsministerium, die gerne mal handgreiflich wird. So, wie sie sich bei einem Verhör präsentiert, kann man sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass Lubbadeh "Ilsa" und "Vampyros Lesbos" daheim im DVD-Schrank stehen hat.
Diskurs und Kontext
Meine erste Assoziation zu Lubbadehs Romanszenario war David Brins "Existenz". Darin wird die gentechnische Rückzüchtung von Neandertalern zwar nur kurz erwähnt, während sie hier den Dreh- und Angelpunkt der Handlung ausmacht. Spannenderweise zeichneten sich im Lauf der Lektüre aber noch andere Parallelen zu Brin ab. Auch Lubbadehs Roman bietet sich als Diskussionsbeitrag an – in diesem Fall geht es um die Frage, wann eine wohlwollend ratgebende in eine bevormundende Politik umschlägt. Spätestens wenn in einem Kapitel eine TV-Talkshow über bürgerliche Freiheit, Gleichheit und Gesundheit beschrieben wird, treten die diskursiven Elemente von "Neanderthal" offen zu Tage. Dazu gehört auch, dass man auf dem aktuellen Wissensstand ist. Ganz im Stil von Marc Elsberg baut Lubbadeh jüngere Erkenntnisse aus der Wissenschaft in seinen Roman ein – etwa was den prähistorischen Genfluss vom Neandertaler zum Homo sapiens betrifft.
Leider hat Lubbadeh aber auch den Umgang Brins mit den Protagonisten übernommen, der mitunter etwas herzlos ist. Sagen wir so: Zwischen Anfang und Ende wird es da zu einigen Verschiebungen kommen, und eine Figur verschwindet sogar sang- und klanglos. Das ist freilich weniger ein Fehler als eine strategische Entscheidung des Autors, die man zu akzeptieren hat. Wenn es überhaupt etwas zu bekritteln gibt, dann vielleicht, dass Kapitel 1 (mit Nix) und 2 (mit Max) besser die Reihenfolge getauscht hätten. Das Anfangskapitel trägt nämlich die ganze Last der Exposition und Nix muss bei jedem Lercherlschas sofort gedanklich zu den verschiedensten Ausprägungen des Gesundheitssystems abschweifen, damit wir möglichst schnell im Bilde sind. Das ergibt einen leicht holprigen Start, ab dem ersten Auftritt von Max segelt "Neanderthal" dann aber über glatte See. Und wie in Fußball-Talks so gerne gesagt wird: Das ist ohnehin Jammern auf hohem Niveau.
Insgesamt ist Lubbadehs Zweitling ein sehr guter Roman und eine klare Empfehlung. Ein Hinweis noch: Wer lieber die E-Book-Variante bestellen möchte und sich über einen vermeintlich abweichenden Titel wundert: "Das Neanderthal-Projekt" ist nicht der Roman, sondern eine begleitende Novellette, die die Vorgeschichte erzählt. Gibt's gratis, netter Service.
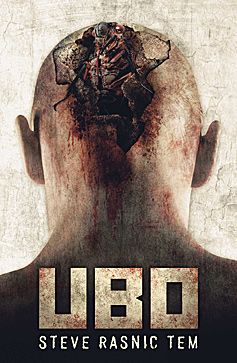
Steve Rasnic Tem: "Ubo"
Broschiert, 320 Seiten, Rebellion 2017, Sprache: Englisch
Das Düstere, Unheimliche und ganz allgemein Weirde zieht sich durchs Werk von US-Autor Steve Rasnic Tem, der in den vier Jahrzehnten seines Schaffens vor allem kürzere Erzählungen und nur gelegentlich mal einen Roman veröffentlicht hat. "Ubo" ist sein jüngster und weckt vage Assoziationen an so unterschiedliche Werke wie "Flusswelt", "Schlachthof 5" oder die TV-Serie "Lost". Betonung ganz stark auf "vage", denn Rasnic Tems Schaffen ist sehr eigenständig, eine Welt für sich.
Entführt
Hauptfigur des Romans ist Daniel, ein junger, recht durchschnittlicher Mann, dem allerdings etwas ganz und gar nicht Alltägliches widerfahren ist. Er wurde entführt; im Traum glaubt er sich daran zu erinnern, dass er von Insektenflügeln an den Ort seiner Gefangenschaft getragen wurde. Dieser Ort, den alle nur Ubo nennen, sieht nach aufgelassenen Fabrikhallen aus. Von den Fenstern aus blickt man auf eine apokalyptische Landschaft: Gebäude in unterschiedlichem Verfallszustand verschwimmen im Dunst, der Himmel ist rauchverhangen und von seltsamer Farbe, in der Ferne glosen Feuer.
Bewacht werden Daniel und seine Leidensgenossen – fast alle sind Männer – von riesigen, zikadenähnlichen Insekten, die sie schlicht roaches nennen. Und diese "Kakerlaken" stellen Experimente mit ihnen an: Tag für Tag verschmelzen sie die Bewusstseine der Insassen mit denen der größten Massenmörder der Geschichte und lassen sie deren Taten durchleben.
Der Massenmörder und Du
Diese virtuellen Trips können sich durchaus unterschiedlich gestalten: Mal ist der Betroffene nur beobachtender Gast im Bewusstsein seines "Wirts", mal verschmilzt er so stark mit ihm, dass er selbst glaubt, der Mörder zu sein. Zudem schleichen sich in die sogenannten scenarios immer wieder Elemente ein, die einer Traumlogik zu gehorchen scheinen: Es treten Doppelgänger auf, die die Tat gemeinsam begehen, zudem verfremden Erinnerungssplitter an die Existenz in Ubo die ansonsten realistisch wirkenden Szenarien.
Mit zum Verstörendsten gehört, wie gut Rasnic Tem die Verbrecher menschlich zeichnen kann – nicht im Sinne von sympathieweckend, sondern individuell. Denn ihre Taten finden in jeweils ganz unterschiedlichen Bezugsrahmen statt. Charles Whitman beispielsweise, der 1966 von einem Turm der University of Texas aus 17 Menschen erschoss, ist ganz und gar auf Effizienz, Leistung und den eigenen Ruf fixiert. Ein Soldat in Vietnam mutiert aufgrund der Umstände fast zwangsläufig vom Helden zum Verbrecher. Für Stalin ist willkürliche Gewaltausübung ein vollkommen rationales Mittel zum Machterhalt. Und bei Jack the Ripper vermischen sich Wahnsinn, Frauenverachtung und schlichte kindliche Neugier zu einem tödlichen Gebräu – wenn er im Körper eines Opfers etwas besonders Interessantes findet, nimmt er es begeistert mit nach Hause, als wäre es ein bunter Kiesel vom Wegesrand. Nur der später auftauchende "God of Mayhem" wird wie das pure, unverstehbare Böse erscheinen.
Das Rätsel Mensch
In den Pausen zwischen den scenarios unterhalten sich die Insassen über ihre Situation und den Sinn der Experimente. "If this were a science fiction movie, I'd think they were testing us to see if the human race was worth saving." Zwangsläufig entstehen daraus Diskussionen über die Natur des Bösen und die Conditio humana im Allgemeinen. "The roaches must think we're a terribly troubled people. We live in Hell but we aspire to Heaven – that's the drama of being human."
Und natürlich versuchen sie – und mit ihnen wir Leser – herauszufinden, was Ubo eigentlich ist. Ein anderer Planet? Die ferne Zukunft? Eine Simulation? Das Fegefeuer? Die Möglichkeiten für eine Auflösung scheinen begrenzt, doch erfreulicherweise wird Rasnic Tem diesbezüglich noch einen unerwarteten Twist aus dem Ärmel ziehen. Darum besser nicht vorab das Nachwort lesen! Aber selbst wer sich diese Überraschung durch unvorsichtiges Vorblättern verdirbt, hält immer noch einen ausgezeichneten Roman in Händen. Empfehlung!
Abschließend noch eine Randbemerkung, die ich mir nicht verkneifen kann. Ist doch immer wieder zum Schießen, wenn ein Autor glaubt, er müsse unbedingt Sätze aus anderen Sprachen einbauen, und dann das Google-Translate-Kauderwelsch nicht von einem Muttersprachler gegenchecken lässt. Wie sagte doch einst Adolf Hitler? "Ich lege das Schicksal."

Stephen Baxter & Terry Pratchett: "Der Lange Kosmos"
Klappenbroschur, 479 Seiten, € 18,50, Goldmann 2017 (Original: "The Long Cosmos", 2016)
Fünf Jahre lang hat uns die "Lange Erde"-Reihe von Stephen Baxter und Terry Pratchett jetzt schon begleitet. Und da seit Teil 1 bereits sechs Jahrzehnte Handlungszeit verstrichen sind, neigt sich auch die Lebensspanne der wichtigsten Protagonisten allmählich ihrem Ende entgegen. Die Zeichen wären also eigentlich auf Wehmut gestellt – das Famose an "Der lange Kosmos" ist aber, dass davon nicht die Rede sein kann: Stattdessen ist der Abschlussband der Reihe von Aufbruchsstimmung geprägt.
Was haben wir schon alles erlebt, seit mit der Langen Erde eine möglicherweise endlose Kette paralleler Welten mit unterschiedlichen Lebensbedingungen entdeckt wurde, zwischen denen sich ohne großen Aufwand wechseln lässt: Die Begegnung mit anderen, aber dennoch "irdischen" Intelligenzen, wo die Evolution einen anderen Verlauf genommen hat. Koloniegründungen und Unabhängigkeitskriege. Den Ausbruch des Yellowstone-Supervulkans. Eine außerirdische Invasion. Das Entstehen einer neuen Menschenart in Form der superintelligenten Next. Und die Erkundung des (ebenso Langen) Mars.
Der Ruf
Nun tut sich etwas ganz Neues: Aus dem Inneren der Milchstraße trifft eine Botschaft ein, die von Teleskopen ebenso wie von sensiblen Individuen "gehört" werden kann. Ihr simpler, aber aufrüttelnder Inhalt: MACH MIT. Eine solche Einladung in den Kosmos ist eine ziemlich tolle Prämisse für eine SF-Mystery und zugleich der Grund, warum die Stimmung des Abschlussbands unverhofft rührig ausgefallen ist.
Die Next sind diejenigen, die erkennen, dass sich in der Botschaft noch mehr versteckt, nämlich die Bauanleitung für eine gigantische Anlage unbekannten Zwecks. Sollte sich davon jetzt jemand an Carl Sagans "Contact" erinnert fühlen, hat er völlig recht – Baxter/Pratchett machen daraus auch keinerlei Geheimnis, sondern lassen ihre Figuren explizit über "Contact" diskutieren.
Die Next wissen auch, dass die Zeit drängt: Selbst gering an der Zahl, sind sie für die Umsetzung des Großprojekts auf die Hilfe der "Dumpfbirnen" (also uns normalen Menschen) angewiesen. Aufgrund der schier endlosen Möglichkeiten der Langen Erde hat sich die Menschheit aber über immer weitere Räume ausgebreitet und ausgedünnt. Staatliche Institutionen zerfallen, für Industrie besteht angesichts der unerschöpflichen Ressourcen kaum noch Notwendigkeit. Es droht die Gefahr, dass die Menschheit in eine zwar glückliche, aber technologisch schlichte Lebensweise zurückkehrt; das Zeitfenster für Weltraummissionen wird sich bald schließen. Das wäre ein weiterer Grund dafür, warum der Roman Melancholie verbreiten könnte – aber wie gesagt: Er tut's nicht.
Von Pratchett zu Baxter
"Der Lange Kosmos" bringt uns ein letztes Wiedersehen mit liebgewonnenen Figuren wie Joshua Valienté und Lobsang, Schwester Agnes, Maggie Kauffman und vielen anderen. Es kommen aber auch ein paar neue Gesichter dazu – etwa der junge Waise Jan Roderick, der Geschichten aus der Langen Erde sammelt und glaubt, darin ein Muster zu erkennen. Eine besonders gelungene dreht sich übrigens um einen Mann, der das Vermächtnis von William Shakespeare in die Weiten der Langen Erde hinaustragen möchte und dies in Form selbstreplizierender Bücher tut. Es kommt, wie es kommen muss: Ein Softwarefehler führt dazu, dass sich die literarischen Von-Neumann-Maschinen unkontrolliert vermehren, und Shakespeare frisst die Welt. (Aber zum Glück nur eine Welt.)
Solche skurrilen Episoden sind das vielleicht letzte Erbe Terry Pratchetts in der "Langen Erde". Ansonsten ist die Serie aufgrund von Pratchetts Krankheit und Tod sukzessive in Baxters Hände übergegangen, was man ihr auch deutlich anmerkt. Die Themen, die den Roman prägen, sind typisch Baxter'sche: die Anpassung des Menschen an seine Umwelt, unterschiedliche Entwicklungswege und das Wesen der Evolution. In den Vordergrund rückt dabei diesmal der Gedanke, dass Kooperation zwischen mehreren Spezies ein wesentlicher Grundzug der Evolution sein könnte: Ein positiv stimmender Gedanke, und er passt dazu, dass "Der Lange Kosmos" mit Arthur C. Clarke neben Carl Sagan einem zweiten großen Optimisten der Science Fiction Tribut zollt. Ein schöner Abschluss der Reihe. Und schade, dass es vorbei ist.

Sergej Lukianenko: "Quazi"
Klappenbroschur, 414 Seiten, € 15,50, Heyne 2017 (Original: "КваZи", 2015)
Eine neue Variante des "Odd Couple", also des Motivs von ungleichen Partnern, die sich zusammenraufen müssen, beschert uns Bestsellerautor Sergej Lukianenko in seinem jüngsten Roman. Und nachdem wir uns in der Science Fiction befinden, können diese Partner ziemlich odd sein. Eine verwandte Bezeichnung für das Motiv lautet übrigens "Wunza", eine Verballhornung von "One's a ...". Der Inhalt des Romans ließe sich also kurz mit "Wunza Quazi" zusammenfassen; das wäre fast der Titel der Rundschau geworden.
Das Szenario
Wir schreiben das Jahr 2027, zehn Jahre nach der Zombie-Apokalypse. Milliarden Ex-Menschen torkeln fressgierig über den Globus, hier tragen sie übrigens die geniale Bezeichnung Aufständische. Die Lebendiggebliebenen haben sich in befestigte Städte zurückgezogen und dort wieder zu relativer Normalität gefunden. In Schach gehalten werden die Untoten aber nicht nur von den Barrikaden am Stadtrand, sondern auch von denen, die den nächsten Schritt der Zombie-Evolution vollzogen haben; eben den Quazi.
Durch den Prozess der Erhöhung hat nämlich eine kleine Minderheit von Zombies wieder zu Verstand gefunden – wie dieser Prozess abläuft, wird erst im Verlauf des Romans geklärt werden. Diese Untoten 2.0 verfügen über überlegene körperliche Kräfte, sind hochgradig intelligent und dank ihrer Regenerationsfähigkeit möglicherweise sogar unsterblich. Äußerlich könnte man sie für normale Menschen halten ... wäre da nicht der taubenblaue Teint. Die Quazi haben mittlerweile ihren eigenen Staat gegründet, leben aber auch um und in den Städten der Menschen.
Es ist eine etwas prekäre Koexistenz. Die Quazi wollen weitere Massenbeißereien verhindern, verstehen sich aber auch als Hüter der Zombies – es sind ja gewissermaßen ihre Problemkinder. Und mit den Menschen können sie zwar gut zusammenarbeiten, doch lässt sich der Umstand nicht leugnen, dass man es nun mit zwei Zweigen der menschlichen Evolution zu tun hat. Da sind Konflikte quasi vorprogrammiert.
Duo auf Ermittlung
Der Moskauer Polizeibeamte Denis Simonow kann weder Aufständische noch Quazi ausstehen; einige Rückblenden auf seinen Überlebenskampf während der Zombiekalypse werden dafür unser Verständnis wecken. Der Ermittler für Todesangelegenheiten ist ein echtes Mannsbild Lukianenko'scher Prägung, das gerne grantelt, seine Socken durchschwitzt, Wodka aus der Flasche gluckert und für Political Correctness nicht viel übrig hat. Doch zu seinem Leidwesen bestimmt genau die die aktuelle Moskauer Zombie-Politik. Als Denis also wieder einmal ein paar frischgebackene Aufständische köpft, anstatt sie nur vorübergehend zu immobilisieren, stellt man ihm mit dem korrekten Michail Iwanowitsch Bedrenez einen Quazi als Partner zur Seite.
Denis erwägt zu Beginn zwar noch, Michail vor die Straßenbahn zu schubsen – alles in allem werden die beiden aber relativ rasch zueinander finden; letztlich ist Denis ja doch recht gutmütig. Und zu tun gibt es auch genug: Ein Mordfall wird sich zu einem Politkrimi auswachsen, der sich um die Entwicklung von Biowaffen und das Kräftegleichgewicht zwischen Menschen und Quazi dreht. Und nicht nur bei der Hauptverdächtigen, der Quazi-Wissenschafterin Wiktoria Aristarchowitsch, wird sich im Verlauf des tendenziell episodenhaft angelegten Romans die Frage stellen, auf welcher Seite sie steht.
Locker genommen
Wie man es von Lukianenko gewohnt ist, kann nichts so schlimm sein, dass man sich darüber nicht in launigem Plauderton unterhalten könnte – und wie gehabt wird dabei gerne aus der Literatur zitiert. "Schreiben Sie Gedichte?", wollte Wiktoria wissen. "Das ist von Oscar Wilde, Sie halbtote Ignorantin." An vielen Stellen versüßt Komik das eigentlich ja düstere Szenario. Highlights sind beispielsweise eine Zombiewaschanlage (sowas hab ich auch noch nicht gelesen) oder die Idee, dass ein zombifizierter Johnny Depp endgültig garantiert, dass die "Piraten der Karibik"-Reihe niemals aufhören wird.
Genüsslich fährt Lukianenko satirische Spitzen gegen Political Correctness aus, und sogar die Quazi selbst erscheinen manchmal wie eine Metapher für urbane Korrektlebende: Immerhin wohnen sie in hübsch restaurierten Apartments, ernähren sich vegan (natürlich aus biologischem Anbau) und ziehen das Fahrrad dem Auto vor. Allerdings haben sie auch Eigenschaften, die sich nicht so leicht in dieses Interpretationsschema passen lassen – zum Beispiel einen grundsätzlich statischen Charakter. Wie eine hängengebliebene Schallplatte behalten sie einstige Gewohnheiten bei, persönliche Weiterentwicklung scheint ihnen nicht möglich.
Offene Fragen hinterlässt auch der Schluss – ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das noch nicht alles war. Mal sehen, ob "Quazi" eine Fortsetzung finden wird. Alles in allem ist es zwar nicht Lukianenkos größter Roman, durch seinen Ton aber, der eindeutig nicht aus den USA kommt, eine angenehme Abwechslung.

Gion Mathias Cavelty: "Der Tag, an dem es 449 Franz Klammers regnete"
Gebundene Ausgabe, 137 Seiten, € 18,60, Lector Books 2017
Ein Buch für Alpin-Affine – und was das betrifft, mit dem gelungensten Titel seit Frölich/Kühn/Schmidts "Der Bergfrauendoktor. Ein Leben voller Abstriche" versehen. Was der Schweizer Autor Gion Mathias Cavelty mit "Der Tag, an dem es 449 Franz Klammers regnete" abliefert, ist eine groteske Safari durch Mythologien, Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien in Form einer Zeitreise. Zur Erklärung noch für bundesdeutsche und/oder junge Leser: Franz Klammer war ein Mega-Star des österreichischen Skisports der 70er und frühen 80er Jahre, als Abfahrer eine Art Vorläuferstudie zu Hermann Maier. In die Rolle eines Romanprotagonisten rutscht er eher zufällig – und natürlich auf Brettern.
Heute in Jerusalem
Der Roman beginnt mit der Übertragung der Olympischen Winterspiele von Innsbruck (die Cavelty übrigens seltsamerweise um zwei Jahre vorverlegt hat). Im Abfahrtsrennen schwingt sich Franz Klammer gerade zu einem Sprung empor, als er plötzlich – "Ja, wo ist er denn hin?" – im Nebel verschwindet und irgendwann auch selbst bemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Nach zwanzig Minuten ist Franz immer noch in der Luft. Langsam beginnt er, sich Gedanken zu machen.
Als Nächstes findet er sich im Anflug auf das antike Jerusalem wieder – just in dem Moment, als Jesus Christus dort Einzug hält. Beim Aufprall zerquetscht er den (animatronischen) Esel des Heilands, der sich seinerseits in ein Wölkchen auflöst und damit die gesamte Geschichte des Christentums im Keim erstickt. Dem unfreiwilligen Ruhestörer indes bleibt nichts anderes übrig als zu flüchten. Eine wilde Verfolgungsjagd nimmt ihren Lauf, doch der Franz ist schneller als seine Häscher, trotz seiner je 4,8 Kilogramm schweren Schischuhe.
Im Mahlstrom der Ideengeschichte
So richtig in die Gänge kommt der Trip aber erst, als der Klammer Franz dem abgeschlagenen Kopf von Johannes dem Täufer begegnet ("Jessas", entfährt es dem Franz. "Knapp daneben", erwidert der Kopf.). Der wird in der Folge ohne Unterlass von Paralleluniversen, Quantenverschränkung und zyklischer Zeit faseln – Letzteres war übrigens auch der Aufhänger für eine weitere schräge Zeitreisegeschichte mit noch schrägerem Titel: Wir erinnern uns an Elias Hirschls "Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt". Deutsche Leser wundern sich an dieser Stelle vielleicht über den seltsamen Humor ihrer südlichen Nachbarländer ...
So reisen sie denn von Station zu Station: zu einer römischen Orgie, zu den (keltischen) Maya und nach Atlantis. Wunder über Wunder, die an Franz Klammer allerdings recht eindruckslos vorüberziehen, denn der ist nur an essen, trinken und Schi fahren interessiert und hätte es am liebsten, wenn das ganze Universum ein einziges Gailtal wäre.
Johannes' Ausführungen geraten derweil zu einem wahren Mahlstrom an Themen, von Nazi-Wunderwaffen über die Steine von Ica, die Fibonacci-Folge und die flache Erde, Cthulhu und JFK bis hin zu den Geheimnissen der Pyramiden. Wer in den zahlreichen sachbuchartigen Aufzählungen zu uns spricht, wird allerdings nicht immer ganz klar. Auf jeden Fall drückt er uns schamlos Lügen rein – etwa dass die "menschlichen" Paluxy-River-Fußspuren von Paläontologen als genuin anerkannt wären. Kein Wunder, dass Franz nur Kasnudl versteht.
Lustig, für eine gewisse Zeit
Man könnte "Der Tag, an dem es 449 Franz Klammers regnete" als waschechtes Stück Bizarro Fiction in deutscher Sprache bezeichnen. Wer Caveltys frühere Werke gelesen hat, dürfte davon nicht wirklich überrascht sein – insbesondere "Die Andouillette" und "Die letztesten Dinge", die mit dem nun veröffentlichten Band eine lose Trilogie bilden. Allerdings ist es die Variante von Bizarro, in der der Wahnsinn um des Wahnsinns willen blüht. Die zusätzliche Bedeutungsebene, die ein Carlton Mellick III seinen Irrsinnserzählungen stets verleiht, finde ich zumindest hier nicht. Caveltys Kurzroman ist für einige Zeit höchst unterhaltsam (und dürfte deshalb auch nicht länger sein). Mir fehlt aber die Idee, die die ganze Klamauk-Revue inhaltlich zusammenhält. Man könnte auch sagen: die Klammer.
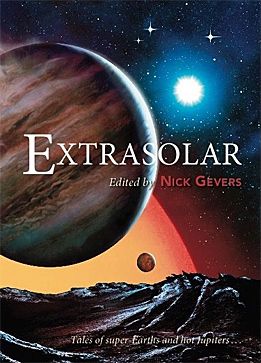
Nick Gevers (Hrsg.): "Extrasolar"
Gebundene Ausgabe, 313 Seiten, PS Publishing 2017, Sprache: Englisch
"Truth is stranger than fiction", lautet ein englisches Sprichwort. Das gilt auch für Exoplaneten, von denen wir seit Anfang der 90er ein paar tausend entdeckt haben und zu einer erstaunlichen Erkenntnis geführt worden sind: Ein paar kleine Gesteinsplaneten innen, ein paar Gasriesen außen – das ist keineswegs das einzige Modell, nach dem ein Sternsystem angeordnet sein kann. Möglicherweise ist es sogar nicht einmal besonders typisch, immerhin gibt es für einige Planetentypen, die da draußen recht weit verbreitet scheinen, in unserem Sonnensystem gar keine Entsprechung: etwa übergroße Supererden oder Heiße Jupiter.
Dass die Science Fiction als die Ideen-Literatur schlechthin der Realität hinterherhinkt, wollte der langjährige SF-Herausgeber Nick Gevers nicht länger hinnehmen. Also rief er für sein Anthologie-Projekt "Extrasolar" Autoren dazu auf, the extraordinary talent Reality has for defying our expectations gerecht zu werden und Erzählungen abzuliefern, in denen exotische Welten den Schauplatz bilden. 14 durch die Bank hochrangige Vertreter des Genres sind dem Ruf gefolgt und schildern einige tatsächlich sehr fremdartige Umgebungen – auch wenn der Effekt auf sehr unterschiedliche und nicht immer der Prämisse der Anthologie entsprechende Weise erzielt wird.
Von Hard SF ...
Am stärksten sind Gevers' Grundidee – nicht ganz überraschend – die Vertreter der Hard SF gefolgt. Genreveteran Gregory Benford etwa, selbst ein Astrophysiker, stellt eine Bibliothekarin des 25. Jahrhunderts in den Mittelpunkt seiner Erzählung "Shadows of Eternity". Die soll eigentlich alte SETI-Signale entschlüsseln, surft aber am liebsten virtuell durch die Daten, die Sonnensegel-Sonden über fremde Welten gesammelt haben. Das ergibt ein wunderbares physikalisch-poetisches Panorama, und so ganz nebenbei kommt man dabei einem dunklen kosmischen Geheimnis auf die Spur und löst das Fermi-Paradoxon.
Die Sonde in Ian MacLeods kurzem "The Fall of the House of Kepler" würde sich freuen, wenn sie auch so ein begeistertes Publikum hätte. Doch sie kann ihr Wissen über die Wunder des Universums nur noch verzweifelt in die Leere hinausschreien, denn die Menschheit ist längst untergegangen. Bitter auch die Ironie in Paul McAuleys "Life Signs". Astrobiologen wollen die Atmosphären von Exoplaneten auf Lebensspuren untersuchen, doch ihr Teleskop wird blind: Der Klimawandel hat den Himmel mit Wolken verhüllt – die "Lebensspur" der Menschheit ...
Nancy Kress schließlich verlegt aktuelle NASA- und ESA-Konzepte zur Suche nach Leben auf dem Saturnmond Enceladus in den interstellaren Raum. In "Canoe" wird der Eismond eines Gasriesen, der um zwei Braune Zwerge kreist, zum Ziel einer Expedition.
... über Aufweichungen der Grundidee ...
Bei einigen Autoren hat der gewählte Exoplanet nur die Funktion einer Bühne. In Aliette de Bodards "A Game of Three Generals" wird diese zum Gefängnis: Hier wird die Insassin einer Strafkolonie auf einer heißen Supererde mit einer grausamen Wahrheit konfrontiert. Alastair Reynolds lässt in "Holdfast" einen Menschen und den Angehörigen einer feindlichen Alienrasse in der Atmosphäre eines sogenannten Super-Jupiters aufeinandertreffen. Spannendes Detail: Nicht nur die Spezies der außerirdischen "maggots", sondern auch die menschliche Gesellschaft dieser Zukunft weist Züge eines Insektenstaats auf.
Noch einen Super-Jupiter finden wir in Matthew Hughes' "Thunderstone"; dieser hier erzeugt in seiner dichten Atmosphäre einzigartige Juwelen. Hughes kennen wir von seiner "Ten Thousand Worlds"-Reihe (siehe etwa "Majestrum"), zu der auch der Mini-Krimi "Thunderstone" gehört. Dieser Erzählzyklus ist als explizites Prequel zu Jack Vances "Dying Earth"-Reihe angelegt und ermöglicht stets aufs Neue faszinierendes Eintauchen in eine opulente Welt der fernen Zukunft, in der das Universum damit begonnen hat, von einem physikalischen auf ein magisches Betriebssystem umzuschalten.
Auch Robert Reed nutzt die Anthologie, um mit seinem Beitrag "The Residue of Fire" eine eigene Reihe zu bewerben. In dem Fall ist es die "Great Ship"-Saga, in der Menschen ein uraltes, gigantisches Raumschiff entdeckt haben, das unzählige exotische Habitate in sich trägt. Fraglos faszinierend, bleibt die Geschichte ohne Kontextkenntnisse aber leider weitgehend unverständlich. Eine weitere Erzählung, in der das Transportmittel wichtiger ist als das extrasolare Ziel, ist Kathleen Ann Goonans komplex gewobenes "The Tale of the Alcubierre Horse". Darin entführen hochbegabte Kinder ein Weltraumhabitat, während die erwachsene Hauptfigur Parallelen zu den Reisen ihrer polynesischen Ahnen erkennt.
... bis zu etwas ganz anderem
Mit der tragikomischen Liebesgeschichte "Arcturean Nocturne" von Jack McDevitt und Terry Dowlings "Come Home", in dem Menschen Traumbotschaften von einem Exoplaneten empfangen, gibt es zwei eher durchschnittliche Beiträge. Aus allen Rohren feuert dafür Paul di Filippo, der sich hier wieder genauso sprachverliebt zeigt wie in seiner legendären Storysammlung "Ribofunk". Seinen Anthologie-Beitrag "The Bartered Planet" hat er als Gesellschaftssatire angelegt: Gemäß den Bestimmungen eines Friedensvertrags muss der Exomond Malenka von seinem Planeten in die Umlaufbahn eines anderen verlegt werden. Und die gleichermaßen schmetterlingshafte wie snobistische Hipster-Bevölkerung Malenkas muss sich daran gewöhnen, künftig in einem äußerst pragmatischen und für sie furchtbar ungehobelten Kulturkreis zu leben.
Ein Fest für Fans von James Tiptree Jr. ist "The Planet Woman By M. V. Crawford" von Lavie Tidhar, ein wunderbares Stück SF-Metaliteratur. Tidhar schlüpft darin in die Rolle eines Herausgebers und präsentiert drei kurze Geschichten der fiktiven Autorin M. V. Crawford, in denen es ganz im Tiptree-Stil um Geschlechterkampf, die Seele der Welt, interplanetaren Sex (also zwischen Planeten, nicht Planetenbewohnern) und Menschen in der Rolle von Spermien geht. Das ist von Gevers' Ausgangsidee weit entfernt, aber eine der besten Tiptree-Hommagen, die ich je gelesen habe.
Die logische Umkehr
Wäre man streng, müsste man konstatieren, dass Nick Gevers als General seine schreibenden Truppen kaum unter Kontrolle bringen konnte. Nur in wenigen Erzählungen hier sind fremdartige Planeten die eigentlichen Stars; meist spielen sie nur eine Rolle am Rande. Was die Qualität der Beiträge anbelangt, ist "Extrasolar" aber eine klar überdurchschnittliche Anthologie. Schriftstellerische Freiheit zahlt sich eben aus.
Und mit Ian Watson kam auch einer auf die fast schon zwangsläufige Idee, den Spieß umzudrehen. In seiner humorvollen, streckenweise recht albernen "Journey to the Anomaly" bereist eine Abordnung Aliens ein Sternsystem, wie sie noch keines gesehen haben – nämlich unseres. Acht Planeten ziehen hier in fast perfekten Kreisen um ihren Stern, "so regelmäßig wie ein Uhrwerk". Das kann keine natürliche Anordnung sein, da müssen die Einheimischen doch mit irgendeiner Supertechnologie nachgeholfen haben ...
Abschließend noch ein Tipp. Da englischsprachige Bücher ein fixer Bestandteil der Rundschau sind und das stete Trommelfeuer den einen oder anderen Originalsprachskeptiker auf Dauer doch weichklopft: Wer genau jetzt vor dem Schritt "Ach, ich trau mich einfach mal auf Englisch, wird schon nicht so schwer sein" steht, sollte die Jungfernfahrt vielleicht nicht gerade mit diesem Titel antreten.

Terry Pratchett unter hülfreicher Unterstützung des Discworld Emporiums: "Vollsthändiger und unentbehrlicher Atlas der Scheibenwelt"
Gebundene Ausgabe, 128 Seiten, € 27,70, Goldmann 2017 (Original: "The Complete Discworld Atlas", 2015)
Lange Zeit hatte sich Terry Pratchett dagegen gesträubt, seine Scheibenwelt zu kartographieren – dafür war sie wohl auch schlicht und einfach nicht planmäßig genug angelegt worden. Erst spät willigte er ein, das bei Fantasy-Lesern so beliebte Roman-Accessoire auch für seine wildwuchernde Schöpfung zuzulassen: Erst gab es Karten zu Ankh-Morpork, dann zum Einzugsgebiet der Stadt ("Mrs Bradshaws Handbuch") – und schließlich war Sir Terry noch in die Konzipierung eines ganzen Scheibenwelt-Atlas involviert. Fertiggestellt hat diesen ein als "Discworld Emporium" auftretendes Kollektiv. Und er ist eine echte Augenweide geworden, die die deutschsprachigen Pratchett-Erstausgaben bei Goldmann zu einem stilvollen Ende bringt.
Wunderbare Optik
Prunkstück des in einem Schuber daherkommenden Atlas ist die 99 x 88 Zentimeter große Karte der gesamten Scheibenwelt, an der man sich gar nicht sattsehen kann: Liebevoll ausgestaltet und in Sepiatönen gehalten wie das Papier des gesamten Bands. Der enthält überdies an die 100 Farbillustrationen ("In prächtigem Thaumicolor") von Dennis West, die uns Landschaften und Bewohner der Scheibenwelt so zeigen, wie wir sie uns vorstellen – soll heißen: das schiere Gegenteil des Covers von "Steife Prise", dem legendären Tiefpunkt in Sachen Pratchett-Illustrationen.
Wie schon in "Mrs Bradshaws Handbuch" werden wieder allerhand "Dokumente" gezeigt, von Broschüren und Plakaten bis zu Annoncen und Hinweisschildern aus verschiedenen Regionen der Scheibenwelt. Außerdem sind diverse bildliche Zitate als Gags eingewoben, sei es Hokusais "Große Welle vor Kanagawa" oder der Teppich von Bayeux.
Eine Welt zum Leben
Der Aufbau folgt von vorne bis hinten demselben Schema: Jede Region wird zunächst mit einem Info-Kastl über Regierungsform, Religion sowie typische Import- und Exportgüter vorgestellt. Dass der Atlas im Grunde ein Wirtschaftslexikon ist, spiegelt Pratchetts bodenständigen Ansatz wider: Dies ist keine Welt, die nur als Schlachtfeld übernatürlicher Konzepte herhält, sondern eine, in der man auch – und vor allem – irgendwie leben muss.
Schon in den Infoboxen stecken genügend Pointen, um Scheibenwelt-Fans zu erfreuen. (Hauptexportartikel Djelibebys? Eingemachtes natürlich.) Daran schließen sich dann jeweils längere und anekdotenreiche Texte über Land und Leute an. Wehmut kommt auf, wenn einem wieder einmal bewusst wird, wie wir Pratchetts ganz besonderen Humor künftig vermissen werden. Wer sonst wäre auf die Idee gekommen, in den Sockel einer Monumentalstatue in der Ruinenstadt Taktikum folgende hehre Inschrift einmeißeln zu lassen: "Von hier oben kann ich dein Haus sehen." Ich empfehle an dieser Stelle übrigens dringend, den Atlas portioniert zu lesen – ansonsten wird man von der Flut an Namen, Fakten und Anekdoten in den Drehwärtigen Ozean gespült.
Zoom-Faktor
Der Atlas beginnt natürlich mit der Stadt der Städte, Ankh-Morpork, und ihrem erweiterten Einzugsgebiet. Dazu zählen auch Lancre, das Kreideland und das (übrigens sehr detalliert vorgestellte) Überwald: kurz, jener Teil der Scheibenwelt, der den Hintergrund für alle Romane der Spätzeit abgegeben hat. Von dieser Kernregion zoomen wir dann aus und besuchen auch deutlich weniger bekannte Gebiete wie die Länder an der Drehwärtigen Küste, die Entgegengesetzten Lande (von denen nur Gennua eine dauerhafte Rolle innehatte), die Wirbelebene oder Wiewunderland und den Gegengewicht-Kontinent. Es gibt übrigens keine weißen Flecken mehr auf der Karte der Scheibenwelt, der Atlas ist tatsächlich komplett!
In vielen Ländern erkennen wir solche aus unserer Welt wieder: Es sind Parodien auf Italien oder Wales, das Alte Ägypten und Griechenland, China und Australien, kenntlich gemacht stets durch groteske Überzeichnung von Klischees. Der Scheibenwelt-Atlas als Ganzes ist damit auch als Parodie auf bornierte eurozentrische Reiseführer vergangener Jahrhunderte zu lesen und als solche ein Extravergnügen.
Und während Schauplätze wie Lancre oder Ankh-Morpork Dauerbrenner waren, sind manche untrennbar mit Einzelromanen verbunden: etwa Djelibeby mit "Pyamiden" (1990), Viericks mit "Heiße Hüpfer" (1999) oder Omnien mit "Einfach göttlich" (1995); Letzteres übrigens immer noch mein Lieblingsscheibenweltroman evah. Liest man die Kurzbeschreibung eines solchen Landes, verspürt man unwillkürlich den Wunsch, den betreffenden Roman noch einmal zu lesen. Das macht den Atlas nicht nur zu einem Überblick, sondern auch zu einem Rückblick auf drei wunderbare Jahrzehnte Scheibenwelt.
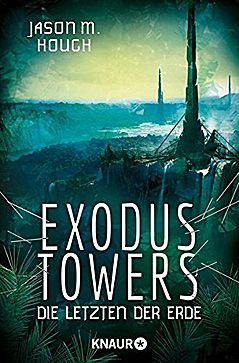
Jason M. Hough: "Exodus Towers"
Broschiert, 672 Seiten, € 13,40, Knaur 2017 (Original: "The Exodus Towers", 2013)
Das Wichtigste zuerst: Wer sich "Exodus Towers" vornimmt, sollte unbedingt zuerst "Darwin City" gelesen haben. Jason M. Hough setzt den ersten Band seines "Dire Earth Cycle" hier nämlich ohne viel Federlesens fort – keine Kurzzusammenfassung des bisher Geschehenen, kein Erinnerungsauffrischen, nichts. Wir steigen unmittelbar in die Handlung ein. Und genauso unmittelbar übrigens auch wieder aus. Vorwarnung: Dieser Band wird mittendrin abbrechen, es ist ein Trilogie-Mittelteil if ever I saw one.
Was bisher geschah (= Spoiler-Alarm für Band 1!)
Darum sei an dieser Stelle noch einmal das Geschehen des ersten Bands rekapituliert. Im späten 23. Jahrhundert hat die Menschheit mehrfach Besuch von Außerirdischen erhalten, die nur als die Erbauer bezeichnet werden. Sie traten zwar nie persönlich in Erscheinung, dafür wogen die Folgen ihres Tuns umso schwerer. Zunächst konstruierten sie einen Weltraumfahrstuhl, der im nordaustralischen Darwin verankert ist. Jahre später streuten sie eine Seuche aus, der fast die gesamte Menschheit zum Opfer fiel; eine kleine Minderheit wurde davon in zombiehafte Subhumane verwandelt. Die letzten Normalgebliebenen drängen sich in und um den Lift, weil der von einem Aura genannten Kraftfeld umgeben ist, das die Seuche abhält.
Zu weiten Teilen drehte sich "Darwin City" um die Gesellschaft, die sich in diesem stark reduzierten Lebensraum – hier die blitzsauberen Decks im Lift, dort die Slums am Boden – entwickelte. Letztlich wurde das etablierte System gestürzt, als mit Russell Blackfield ein neuer Diktator die Macht an sich riss. Die Protagonisten des ersten Bands gerieten in Gefangenschaft oder mussten fliehen. Zum Glück für sie schickten die geheimnisvollen Erbauer aber zum richtigen Zeitpunkt wieder ein paar Schiffe vorbei. Diese installierten im brasilianischen Belém einen zweiten Weltraumfahrstuhl, um den man nun eine neue, menschlichere Kolonie aufbauen will. Soll Blackfield doch in Darwin versauern.
So geht es jetzt weiter
Hauptfigur ist nach wie vor Skyler Luiken – einer von sehr, sehr, sehr wenigen Menschen, die das Glück haben, gegen die Seuche immun zu sein. Darum führte er schon seinerzeit für Darwin Bergungsflüge in die verlassene Umgebung durch; dasselbe macht er nun für die neue Kolonie in Belém. Die hat mit gewissen Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen, und die Politikerin Tania Sharma, die das Projekt formal leitet, merkt immer wieder, dass sie schlicht und einfach überfordert ist. Zu den größten Ärgernissen zählt eine Bande von offenbar ebenfalls immunen Marodeuren unter deren Anführer Carlos.
In Darwin sitzt derweil Skylers ehemalige Einsatzgefährtin Samantha Rinn in Haft. Ein neuer Vertrauter Blackfields, Grillo, schafft es allerdings, sie fürs Erste zur Mitarbeit zu überreden. Blackfield hat seit der Eroberung des Weltraumlifts das Interesse an der Stadt Darwin weitgehend verloren und an Grillo die Aufgabe delegiert, die Slums auf Vordermann zu bringen. Das könnte sich beizeiten rächen – denn Grillo entpuppt sich als beunruhigende Mischung aus rationalem Strategen und religiösem Eiferer.
Machtkämpfe und eine Deadline
Blackfield, Grillo, Carlos – solche Figuren kennen wir. Es sind typische postapokalyptische Warlords, die die Krisensituation zur Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Visionen nutzen. Im Prinzip also das Gleiche wie in "The Walking Dead" (denken wir an Negan oder den Governor), nur auf einem höheren technischen Level; noch zumindest. Und zwischen diesen Führerfiguren finden die ebenso typischen postapokalyptischen Machtkämpfe statt, die – erneut der Blick auf "Walking Dead" – im Prinzip endlos weitergehen können. Diesem Handlungsschema folgt "Exodus Towers" denn auch für mindestens zwei Drittel des Umfangs.
Glücklicherweise versteht es Hough aber, die Leser mit neuen außerirdischen Aktivitäten bei der Stange zu halten: Skyler sieht aus einem Alien-Artefakt eine Substanz austreten, die einen Subhumanen wie ein Schutzpanzer überzieht und ihm erschreckende Kräfte verleiht. In der Nähe von Darwin wuchern Kristallgewächse wie ein Riff auf trockenem Land. Und die bislang verhaltensunauffälligen Auratürme – eine Art schwebende Hinkelsteine, mit denen sich die Kolonisten von Belém vor der Seuche schützen können – driften eines Tages einfach auf und davon. Auf der Suche nach den ausgebüxten Türmen wird Skyler noch Seltsameres finden. Und über allem schwebt eine gefährliche Deadline: Man konnte inzwischen extrapolieren, dass die Ankünfte der Erbauer einem Algorithmus folgen – und die Monate bis zur nächsten schmelzen dahin.
Solide Erzählweise, Spannungserzeugung durch Machtkämpfe und das-außerirdische-Geheimnis-das-alle-brennend-interessiert nur zizerlweise preisgeben: Das ist im Prinzip dieselbe Strategie, mit der Daniel Abraham und Ty Franck ihre "Expanse"-Reihe weiterspinnen. Aber keine Angst: Hough spannt die Leser nicht ganz so lange auf die Folter. Mit Band 3 wird der bisherige Handlungsbogen zu einem ersten Ende gebracht werden. Danach kann man sich – vorerst nur auf Englisch – auch noch ein Prequel und eine weiterführende Duologie zu Gemüte führen, die im Weltraum spielen wird. Womit übrigens nicht das obere Ende des Lifts gemeint ist, sondern viel, viel weiter weg ...
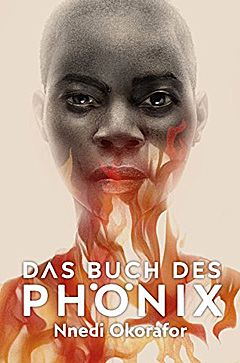
Nnedi Okorafor: "Das Buch des Phönix"
Klappenbroschur, 328 Seiten, € 18,60, Cross Cult 2017 (Original: "The Book of Phoenix", 2015)
Weggabelung: Wer bei einer Geschichte auf Logik Wert legt, kann gleich weiterklicken. Die wird er hier nicht finden. Wer sich hingegen vom Sog einer Erzählung weitertragen lassen will, ist bei Nnedi Okorafor an der richtigen Stelle. "Das Buch des Phönix" ist ein Prequel zu "Who Fears Death", jenem Roman, der der US-Autorin mit nigerianischen Wurzeln 2010 zum Durchbruch verhalf. "Phönix" ist einige Generationen vor den damaligen Ereignissen, aber immer noch ein Stückchen zukunftwärts von uns angesiedelt und erzählt, wie es zu dem Kataklysmus kam, der die Welt so grundlegend verändert hat.
Ausbruch aus der Gefangenschaft
Wie immer bei Okorafor steht eine besonders begabte Frau im Zentrum des Geschehens – und diese ist noch besonderer als alle ihre Vorgängerinnen. Phönix ist ein Gentechnikprodukt, vor zwei Jahren erst gezüchtet, aber bereits wie eine 40-jährige Frau aussehend und auf dieser "Altersstufe" potenziell unsterblich. Sie lebt im 28. Stock einer Einrichtung, die schlicht Turm 7 genannt wird, im Manhattan der nahen Zukunft steht und dem Unternehmen LifeGen gehört. Genetisch veränderte Menschen mit erstaunlichen Fähigkeiten, intelligenzgesteigerte Tiere und genetische Chimären sind Phönix' Mitbewohner.
Es dauert einige Zeit, bis Phönix bewusst wird, dass sie und die anderen eigentlich Gefangene und die Resultate unmenschlicher Experimente sind. Kapitel 1 schildert Phönix' Aufwachsen in der Gefangenschaft, die Saat der Auflehnung, die in ihr herankeimt, und schließlich den buchstäblich explosiven Ausbruch aus dem Turm. Es ist ein furioser Auftakt und könnte gut und gerne als eigenständige Kurzgeschichte fungieren.
Symbolisch aufgeladene Selbstfindung
Für Phönix ist es aber nur die erste Etappe auf dem Weg zu sich selbst. Schritt für Schritt entdeckt sie ihre Kräfte: Sie kann entflammen wie Johnny die Fackel von den Fantastischen Vier, lässt sich Flügel wachsen und ... stirbt, mehrfach, wird aber ihrem Namen entsprechend nach jedem Tod wiedergeboren. Okorafor hat sich aus dem "X-Men"-Fundus gezielt die Elemente herausgegriffen, die die größte Symbolkraft haben: vom Entfalten der Schwingen über die Wiedergeburt bis zu jenem "Rückgrat" genannten Baum, der in Turm 7 wächst und irgendwann seinen Betonkerker sprengt.
Die weiteren Geschehnisse seien nur kurz angerissen: Phönix fliegt vorübergehend nach Ghana, wird dort aber von LifeGen (sie selbst spricht übrigens immer nur vom überwachenden Großauge respektive von den Unternehmensangehörigen pauschal als Großaugen) erneut aufgespürt. Also kehrt sie in die USA zurück und erklärt dem Unternehmen und bald darauf eigentlich der ganzen westlichen Zivilisation (sie neigt nicht zum Differenzieren) den Krieg. "Das Buch des Phönix" ist wie schon "Who Fears Death" eine Rachegeschichte, und die Protagonistinnen ähneln einander stark. "Ich bin die Vorbotin der Gewalt", wird Phönix sagen.
Darüber hinaus ist der Roman aber auch eine Reflexion über das Erzählen an sich und ein Buch im Buch. Im Prolog findet ein Mann der Zukunft eine Höhle voller alter Computer und lädt aus Versehen eine Datei voller Erinnerungsextrakte auf sein Gerät – darunter auch Phönix' Bericht in der uns vorliegenden Form. Ein Bericht, in den wiederum andere Geschichten eingebettet sind: Mein Leben existiert durch meine Worte, durch jeden bewussten Atemzug, den ich nehme. Ich erzähle dir eine Geschichte, in der weitere Geschichten stecken. Universen innerhalb von Universen. Zusammen mit dem übersprudelnden Ideenreichtum – Okorafors größter Stärke – ergibt das ein durchaus beeindruckendes erzählerisches Geflecht.
Die Sache mit der Logik
Okorafors größte Schwäche bleibt hingegen die Logik. Damit sind jetzt nicht die diversen Superkräfte der Hauptfigur und ihrer Mitstreiter gemeint, die kugelabwehrende Sheabutter und sonstigen magischen Elemente – und nicht einmal das außerirdische Samenkorn, das hier ziemlich willkürlich in den Handlungstopf gerührt wird, oder der Umstand, dass Phönix plötzlich auch durch die Zeit fliegen kann. Das läuft alles noch unter Ideenreichtum.
Gemeint sind eher Ungereimtheiten wie diese: Im afrikanischen Kurz-Exil wird Phönix "Okore" (Adler) genannt. Klar, wegen der Flügel, möchte man meinen – die hält sie dort allerdings unter einer Burka versteckt. Als sie in die USA aufbricht, wird sie von einem Mitstreiter ebenfalls als Okore begrüßt, auch wenn der von diesem Namen eigentlich gar nichts wissen kann. Das kann man sich nur über die Schiene wegerklären, dass Okorafor von Beginn an auf mythische Erzählmuster setzt, wo andere Regeln gelten. Zu einem Mythos hat das Publikum Vorwissen, was zu einer gewissen Selbstverständlichkeit führt, die Aspekte wie Perspektivenwechsel oder unterschiedliche Informationsstände irrelevant macht. Kann man also auch noch schlucken.
Was ich Autorin und Hauptfigur hingegen überhaupt nicht mehr abkaufen konnte, ist die Betonung, die Phönix auf ihre "afrikanischen Wurzeln" legt. Welche Wurzeln sollen das sein? Sie ist in einer abgeschotteten Umgebung mitten in New York aufgewachsen, und der einzige tatsächliche Berührungspunkt, den sie mit "ihrer" Kultur hatte, war der Umstand, dass in der Kantine afrikanisches Essen serviert wurde. Generell wird hier übrigens in sehr diffuser Weise "afrikanische" Kultur (welche von den vielen, die es gibt, eigentlich?) idealisiert und die – ebenso pauschalisierende – "westliche" als zerstörerisch gebrandmarkt. Unter der Oberfläche der Erzählkunst schlummert hier letztlich also auch eine gehörige Portion ... Oberflächlichkeit. Aber wo viel Licht ist, ist halt auch Schatten. Und ein Phönix ist ja eine Lichtquelle.
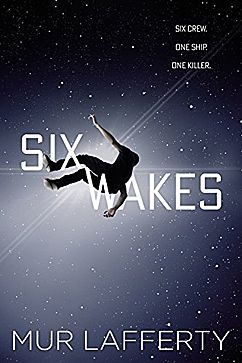
Mur Lafferty: "Six Wakes"
Broschiert, 400 Seiten, Orbit 2017, Sprache: Englisch
Ein halbes Dutzend Protagonisten wacht an Bord eines Raumschiffs auf, kann sich an nichts erinnern und wird in der Folge erkennen müssen, dass jeder von ihnen eine höchst dubiose Vergangenheit hat. Was wie die Ausgangslage der kanadischen TV-Serie "Dark Matter" klingt und von Anfang an recht leichtverdaulich daherkommt, wird sich im weiteren Verlauf aber noch als unverhofft raffiniert entpuppen.
US-Autorin Mur Lafferty ist in erster Linie durch ihre Podcasts bekannt geworden. Als Romanautorin bewegte sie sich bislang im Spektrum von Urban Fantasy bis zu Superheldengeschichten – dementsprechend ist ihr erster eigentlicher Science-Fiction-Roman "Six Wakes" nicht gerade Hard SF, sondern fokussiert auf das Wechselspiel der Figuren. Dem kann Lafferty allerdings einiges abgewinnen.
Zur Ausgangslage
Wir schreiben das 25. Jahrhundert. Ein nur kurz erwähntes Gemisch aus politischen, ökonomischen und religiösen Wirrungen hat die Erde nicht eben lebenswerter gemacht. Deshalb ist das kilometerlange Raumschiff "Dormire" zu einem bewohnbaren Exoplaneten im Tau-Ceti-System unterwegs. 400 Jahre lang wird die Reise dauern, 2.000 kryokonservierte Menschen und 500 digitalisierte Bewusstseinsinhalte sind an Bord. (Sie schlafen ... auf einem Schiff namens Dormire ... da hat wohl jemand ein Italienisch-Wörterbuch geschenkt bekommen.)
Die Besatzung zählt nur sechs Köpfe, soll aber die gesamte Reise über wach bleiben. Schon vor Jahrhunderten hat man nämlich die Klontechnologie perfektioniert und somit potenziell unbegrenzte Langlebigkeit erreicht. Stirbt der alte Körper, wird eine digitale Bewusstseinskopie (mindmap genannt) in einen frischgeklonten Körper verpflanzt, und weiter geht's im besten Alter. Kindheit und die lästige Pubertät überspringt man.
Das Grundprinzip kennen wir ja bereits von Iain Banks & Co – Lafferty wird dem Thema allerdings einige neue Aspekte abgewinnen. Wir werden durch Rückblicke allmählich verstehen lernen, warum "Klone" im Gegensatz zu "Menschen" einigen zu Romanbeginn erwähnten und zunächst absurd klingenden Sonderregeln unterworfen sind. Und wir werden feststellen, dass die "serielle Monoklonie" tatsächlich zu einem ganz eigenen Lebensstil führt. "You don't live centuries without piling up a whole mess of skeletons in your closet ..."
Wer war der Mörder?
Natürlich läuft wieder mal nichts nach Plan. Als unsere Protagonisten erwachen, finden sie sich in den Überresten eines Blutbads wieder. Ihre "Vorgänger" (also ihre alten Körper) wurden abgeschlachtet – bis auf einen, der anscheinend Selbstmord beging, und die Kapitänin, deren alter Körper im Koma liegt. Was ein Entsorgungsproblem der besonderen Art aufwirft, denn gemäß dem internationalen Klon-Abkommen darf es immer nur eine Ausgabe eines Menschen geben. Etwaige übrige sind zu töten.
Vor allem aber gilt es herauszufinden, wer die Tat begangen hat. Kapitänin Katrina de la Cruz, Pilot Akihiro Sato, Sicherheitschef Wolfgang (Nachname unbekannt), Ingenieur Paul Seurat, Ärztin Joanna Glass oder Maria Arena, das "Mädchen für alles" und zugleich die Hauptfigur des Romans: Einer von ihnen muss es gewesen sein – eventuell kommt noch die Bord-KI in Frage, aber sonst gibt es in diesem Kammerspiel niemanden. Leider sind aber nicht nur die Logbücher gelöscht, sondern auch die mindmaps der Klone. Ihre letzten Erinnerungen stammen aus der Zeit kurz vor dem Start – mit mildem Entsetzen müssen sie nun feststellen, dass das Schiff bereits seit Jahrzehnten unterwegs ist.
Persönliche Geheimnisse erschweren die Aufklärung zusätzlich. Sämtliche Crewmitglieder sind Kriminelle, die sich nur deshalb anheuern ließen, weil sie auf Begnadigung hofften. Vertraglich wurde allerdings festgelegt, dass keiner von den Verbrechen der anderen erfahren darf. Was unser verwirrtes Sextett im Einzelnen auf dem Kerbholz hat, wird uns eine Reihe von Rückblenden zeigen – überraschende Querverbindungen zwischen den Protagonisten inbegriffen. In Laffertys Romanszenario steckt so viel an Konstruktion drin, dass man sich fragt, ob in einer der Kryokammern wohl eine geklonte Agatha Christie schlummert.
Kann man sich gönnen
Insgesamt ist "Six Wakes" eine spannende Murder Mystery, die auf einfachen Wegen zu einem gelungenen Ergebnis kommt. Hier gilt übrigens das Gegenteil dessen, was ich zu "Extrasolar" geschrieben habe: Neueinsteigern in englischsprachige SF-Lektüre macht es dieser Roman leicht. Und wer sich trotzdem nicht drübertraut, muss nur bis Juni warten: Dann wird die deutschsprachige Ausgabe ("Das sechste Erwachen") bei Heyne erscheinen.
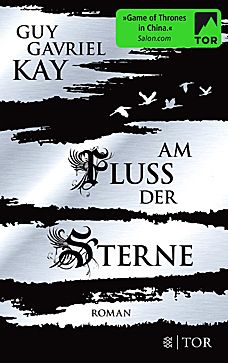
Guy Gavriel Kay: "Am Fluss der Sterne"
Klappenbroschur, 715 Seiten, € 17,50, Fischer Tor 2017 (Original: "River of Stars", 2013)
Im Werk von Guy Gavriel Kay verschwimmen die Grenzen zwischen Fantasy, Alternativweltgeschichte und historischem Roman. Am liebsten nimmt sich der Kanadier ein bestimmtes Land während einer bestimmten prägenden Epoche vor, behält die grundlegenden historischen Abläufe bei, ändert aber alle Namen und hängt eventuell einen zweiten Mond an den Himmel. Schauplätze seiner Romane waren unter anderem schon das maurische Spanien und Byzanz – für das im Vorjahr erschienene "Im Schatten des Himmels" und nun "Am Fluss der Sterne" wählte er das mittelalterliche China. Zur Abwechslung übrigens mit nur einem Mond.
Genauer gesagt handelt es sich um das China der Song-Dynastie, wie Kay im Nachwort erläutert – was etwa unserem 10. bis 13. Jahrhundert entspricht. "Am Fluss der Sterne" ist damit einige Jahrhunderte nach den Geschehnissen von "Im Schatten des Himmels" angesiedelt und kann deshalb problemlos als eigenständiger Roman gelesen werden. Vor allem zu Beginn wird mehrfach auf die Ereignisse des Vorgängerbands verwiesen, aber nur im Sinne historischer Betrachtungen. Denn was damals geschah, legte den Grundstein dafür, wie die Romangegenwart aussieht.
Zeitenwende
Das Reich der Mitte, im Roman Kitai genannt, wird inzwischen von der Zwölften Dynastie regiert – und es ist kein Goldenes Zeitalter. Das Reich ergeht sich in Nabelschau in Form von überkandidelten Künsten und höfischen Intrigen, während sich im Norden Unheil zusammenbraut. Wieder einmal geraten die benachbarten Nomadenvölker in Bewegung; ein neuer Herrscher etabliert sich und richtet sein Auge auch auf Kitai.
In diese Zeit des Umbruchs wird mit Hauptfigur Ren Daiyan eine Heldengestalt geboren. Aus einfachen Verhältnissen stammend, macht er nach einem kurzen Zwischenspiel als (trotzdem ehrenwerter) Gesetzloser Karriere beim Militär. Er wird sich zum vielbesungenen Strategen entwickeln und sich den Invasoren entgegenstellen.
Jetzt und dann
"Vielbesungen" ist übrigens weder Spoiler noch Übertreibung. Kay pflegt ein sehr reflektiertes Erzählen: Immer wieder wird im Text Bezug darauf genommen, wie man die aktuellen Geschehnisse später tradieren wird, wie die Handlungsfiguren sie im Alter selbst wiedergeben oder wie sich Legenden bilden, die man sich noch Jahrhunderte später erzählen wird. Die Grenzen zwischen Geschichte und Geschichten sind nicht immer leicht zu ziehen, wie es an einer Stelle heißt.
Solcherlei Nachbearbeitung muss auch sein. Denn im Kontrast dazu laufen die Dinge dann, wenn sie sich tatsächlich ereignen, so schnell ab, dass die Beteiligten sie kaum erfassen können. Gegen Anfang erschießt Daiyan eine Gruppe von Banditen, und es bleibt ihm nicht mehr zu reflektieren als: Man hatte nicht getötet. Und dann hatte man es.
Allein unter Nebenfiguren
Wer beim Wort Fantasy automatisch Magie mitassoziiert, wird bei Kay kaum fündig werden. Einmal begegnet Daiyan einem Fuchsgeist ... genau genommen könnte es sich aber auch einfach nur um eine besonders talentierte Tätowiererin gehandelt haben. Dafür setzt Kay wie George R. R. Martin ganz auf Realpolitik und Storyverläufe, die das Bedürfnis nach Wohlfühleskapismus nicht immer befriedigen werden. Und er arbeitet mit ähnlich umfangreichem Personal wie Martin – das Personenregister gleich am Anfang des Romans war eine hilfreiche Idee.
Im Klappentext wird nur eine dieser Figuren auf die gleiche Höhe wie Daiyan gestellt, was sich aber nicht wirklich rechtfertigen lässt: Lin Shan, Tochter eines Gelehrten, die von ihrem Vater entgegen den Gepflogenheiten der Zwölften Dynastie eine ordentliche Ausbildung erhielt und auch "männliche" Fertigkeiten beherrscht. Sie wird als hochintelligent und unkonventionell eingeführt, und zunächst glaubt man noch, dass sich hier ein echtes Power Couple aufbaut. Allerdings tut Shan dann den ganzen Roman über nichts sonderlich Bemerkenswertes, während Daiyan stets verlässlich mitten im größten Getümmel steckt.
Am Fluss der Worte
Im Roman fällt des Öfteren der Begriff Strom – gemeint ist damit das endlose Heer der von Posten zu Posten schreitenden Beamten im Regierungsapparat Kitais. Das Wort ist aber auch eine gute Metapher für die Erzählung selbst: ein breiter, gemächlich dahinfließender Strom, mäandernd und Seitenarme ausbildend, gelegentlich zu Stromschnellen in Form von Action-Intermezzi beschleunigend, dann wieder in Beschreibungen von Kalligraphie oder Teezeremonien versumpfend, stets aber dank Kays Sprachgabe mit einem poetischen Glitzern auf der Oberfläche. – Na, die Metapher hab ich jetzt aber ordentlich zu Tode geritten.

Claire North: "Der Tag, an dem Hope verschwand"
E-Book, 636 Seiten, € 9,99, Lübbe 2017 (Original: "The Sudden Appearance of Hope", 2016)
Ray Bradbury: "Das Böse kommt auf leisen Sohlen"
Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, € 25,70, Aladin 2017 (Original: "Something Wicked This Way Comes", 1963)
Alastair Reynolds: "Enigma"
Broschiert, 960 Seiten, € 13,40, Heyne 2017 (Original: "Poseidon's Wake", 2015)
Diese drei Titel fassen wir mal unter dem Überbegriff "spezielle Formate" zusammen. Der Lübbe-Verlag, der schon Claire Norths famoses "The First Fifteen Lives of Harry August" ins Deutsche übersetzt hat, hat nun auch eine deutschsprachige Version von "The Sudden Appearance of Hope" herausgebracht. Allerdings nur in der kuriosen Kombination Audio- und E-Book, nicht in gedruckter Form.
Staunen wir also bildschirmklickend oder lauschend über Hauptfigur Hope Arden und ihre gar seltsame Eigenschaft: Wann immer sie aus dem Blickfeld einer Person gerät, vergisst diese sofort, dass es Hope überhaupt gibt. Das führt zu einigen hirnverrenkenden Effekten, und Hope versteht diese auch weidlich auszunutzen – denn Norths Roman ist keine tranige Metapher fürs Übersehenwerden, sondern ein Thriller.
Klopf, klopf ...
Mit Ray Bradburys "Something Wicked This Way Comes" hat auch ein echter Klassiker ein neues Gewand bekommen. Die Geschichte von zwei Jungen, die in den Sog eines unheimlichen Jahrmarkts geraten, ist schon mehrfach ins Deutsche übertragen worden. Beim Übersetzer aus den 80er Jahren ist es geblieben, allerdings wurde die neue Ausgabe mit zahlreichen Illustrationen geschmückt. In seinen reduzierten Schwarz-Weiß-Bildern fängt Comiczeichner Reinhard Kleist die gleichermaßen bedrohliche wie poetische Stimmung des Romans ein und verstärkt so den Effekt noch.
Der Band fällt unter "kleiner Luxus", ist den Preis aber durch seine liebevolle Gestaltung wert. Ein schönes Geschenk – nicht nur für diejenigen, die ihren Kindern (oder vielleicht besser denen von Bekannten) ein paar nachweihnachtliche Albträume bescheren wollen.
Langzeitprojekt
Und dann ist da noch Alastair Reynolds. *seufz* Ganz ehrlich, ich bin wenig angetan davon, wenn der Abschlussteil einer Reihe auf die Länge der vorangegangenen Teile noch mal ordentlich was draufpackt; das weckt unwillkürlich Assoziationen zur "Hobbit"-Filmtrilogie. Wäre "Enigma" ein Einzelroman, wäre er mit seinen 960 Seiten für die Rundschau nie in Frage gekommen. Andererseits ist es der Abschluss einer Trilogie, und nach dem beeindruckenden "Okular" und dem (schon ein wenig gestreckten) Nachfolger "Duplikat" möchte man doch irgendwie wissen, wie's ausgeht. Wiederum andererseits ist "Poseidons Kinder" eine Trilogie der losen Art, eine Direktfortsetzung hat man also eh nicht. Diesen Zwiespalt (oder Driespalt?) konnte ich bis jetzt nicht auflösen.
Vielleicht mache ich es so wie diese Bloggerin, die sich ein Buch von TV-Starköchin Julia Child vorgenommen und die Rezepte darin ein Jahr lang Stück für Stück nachgekocht hat. Ungefähr so: "Hallo Leute, ich wünsche allen ein glückliches 2018 und beginne jetzt mit 'Enigma'." – "Frohe Ostern! Und hättet ihr gedacht, dass wir etwas so Zentrales nach 200 Seiten immer noch nicht erfahren haben?" – "Treibe gerade mit meiner Luftmatratze auf dem Neusiedler See und habe soeben die magische Marke erreicht, bei der ich in der linken und in der rechten Hand gleich viel Papier halte." Und so weiter. Na, mal sehen.
Schon lange vor Abschluss eines solchen Langzeitprojekts wird jedenfalls bereits der nächste Reynolds auf Deutsch erscheinen. "Rache" kommt im Jänner heraus und ist dankenswerterweise beträchtlich kürzer. Ebenfalls im Jänner wird es die mittlerweile schon traditionelle Best-of-Rundschau geben; für die habe ich mir unterm Jahr extra ein paar zusätzliche Titel aufgespart, die hier bislang noch nicht rezensiert wurden. (Josefson, 16. 12. 2017)
_______________________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher