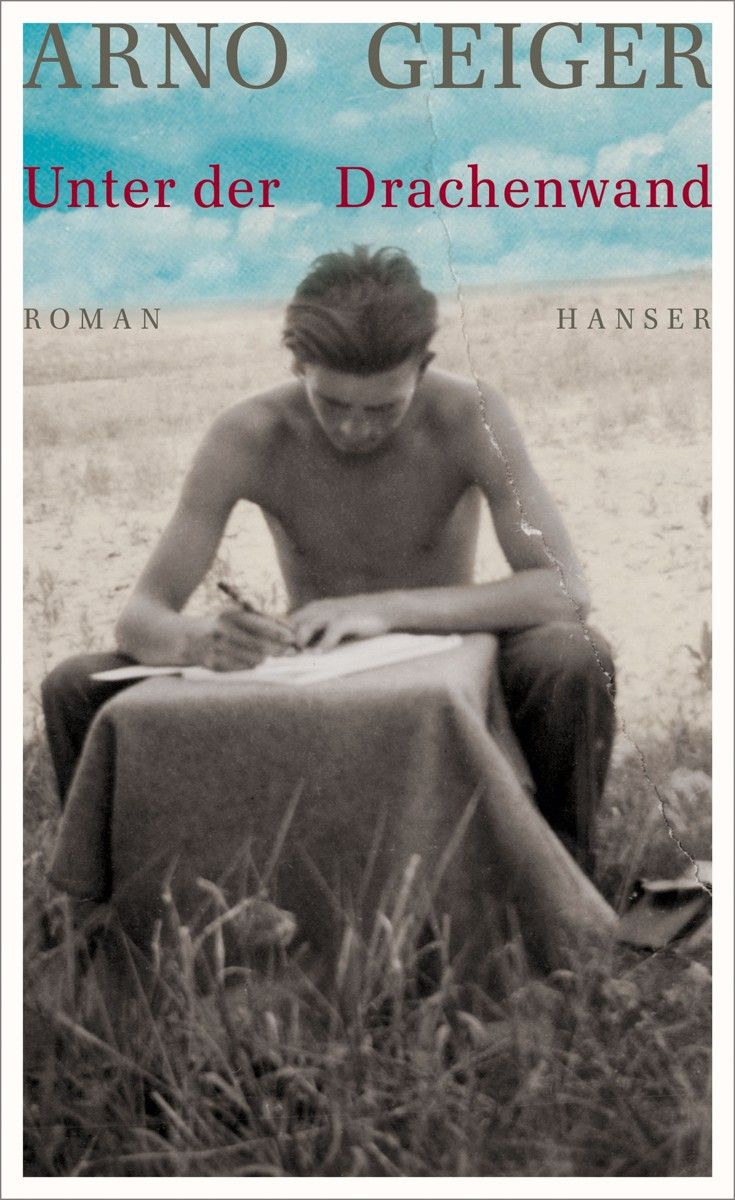Unter dem "schauerlich herabstürzenden Felsen" liegt der Mondsee, "über allem die albtraumhaft hingestellte Drachenwand", heißt es vom Titelort in Arno Geigers Roman. Er spielt, mitunter einige Jahre zurückblickend, 1944. Der Krieg bricht auch in dieser ländlichen Gegend in das dünne Geflecht einer scheinbaren Normalität ein – bis er albtraumhaft über allem steht.
Aus der Nähe der Ich-Perspektive folgt die Erzählung zunächst dem knapp 24-jährigen Veit Kolbe. Statt ein Studium anfangen zu können, war er zur Wehrmacht befohlen worden, sein ganzes Erwachsenendasein lang hat er an der Front gekämpft. Bis ihn am Dnjepr drei Splitter verwundeten. Zur Genesung kommt er aus dem Sanatorium nach Hause, die Familie lebt in Wien. Der Tod hat sie schon vor Kriegsbeginn heimgesucht, die geliebte Schwester war ihrer schweren Krankheit erlegen.
Im Osten musste Veit das Grauen der vorderen Linie ertragen und von Massenhinrichtungen erfahren, im Hinterland hält er die Einstellungen und Phrasen (man möge sich glücklich schätzen, denn "wir leben in einer gro- ßen Zeit") nicht aus. Der Onkel, Postenkommandant in Mondsee, besorgt dort dem ermatteten, bisweilen plötzlich unter albtraumhaften Kriegsbildern zusammenbrechenden Soldaten ein Zimmer.
Leben in der Zwischenwelt
Seinen Zustand, seine Sichtweise stellt Geigers gewieft gebaute Schilderung gleich im starken ersten Satz mit der bestimmenden Perspektive klar: "Im Himmel, ganz oben, konnte ich einige ziehende Wolken erkennen, und da begriff ich, ich hatte überlebt." Es habe ihn der Krieg "auch diesmal nur zur Seite geschleudert".
Ebenfalls am Mondsee, Unter der Drachenwand, wie der Titel angibt, ist eine Mädchenklasse aus Wien mit ihrer Lehrerin einquartiert, das Zimmer neben Veit bewohnt hinter hellhöriger Wand die "Darmstädterin" Margot mit ihrem Baby, und der Bruder der nazifanatischen Quartierfrau, "der Brasilianer", betreibt im Glashaus eine Orchideen- und Gemüsezucht. Sie alle bewegen sich mühsam in einer ungewissen Zwischenwelt, unter einer zunehmend deutlichen Bedrohung.
Zwar lässt sich die Niederlage absehen, ein Bild einer Zukunft aber nicht. Der nach der Auswanderung zurückgekehrte "Brasilianer" sehnt sich nach Rio und dem Dschungel, die Schülerin Nanni nach ihrem jugendlichen Geliebten. Margot hat in aller Eile einen Fronturlauber aus Linz geheiratet, der ihr nun fremd ist, und erhält aus Darmstadt Nachrichten von der Zerstörung der Stadt. Veits Onkel wendet und windet sich in seiner Polizeigewalt, es blühen Durchhalteparolen, während kritische Worte den "Brasilianer" in höchst bedrohliche Schwierigkeiten bringen. Und dem verwundeten Soldaten geht durch den Kopf, die verlorene Zeit vermöge er nie aufzuholen: "Krieg war ja eigentlich das Einzige, was ich noch kannte." Wie weit "die Verzerrung des eigenen Wesens schon vorangeschritten" sei, merke man erst im Alltag "normaler Menschen". Den jedoch gibt es nicht mehr.
Wohl ersteht eine überraschende Liebesgeschichte, die Situation aber ist prekär, der Himmel voller Bombengeschwader, am Boden herrschen Gewalt und Angst. Es geht ums Überleben.
Arno Geiger schafft es, eindringlich in diese Stimmung zu versetzen, indem er ganz aus der Perspektive der Protagonisten erzählt, mit entsprechenden Übergängen und Brüchen, bezeichnet von ungewöhnlichen Querstrichen. So ist nach und nach zu erkennen, dass Veit Kolbes Worte aus seinem Tagebuch stammen könnten. Und in drei der sieben Teile des Romans bestehen die Kapitel offenbar aus Briefauszügen: etwa von Margots Mutter aus Darmstadt, von Nannis Geliebtem Kurt aus Wien und von Oskar Meyer, der wie Kurt und Veit in der Possingergasse gewohnt hat.
Budapest und Brasilien
Als Jude flüchtet er mit Frau und Kind nach Budapest, wo sich für sie alles verschlimmert. Dieser Überlebenskampf bildet die eine, äußerst leibhaftige Gegenwelt zum Mondsee. Brasilien die andere, derartig idyllisierte, dass die Sätze des "Brasilianers" nach Stefan Zweig klingen. Dort hätten die Leute "nichts Grobes, Auftrumpfendes oder Anmaßendes. Es sind stille, träumerische, sinnliche Menschen" – dass dort gerade eine Diktatur herrscht, sagt er nicht.
Die Eindringlichkeit, die diesen Roman so faszinierend und zugleich beklemmend macht, bewirkt Geiger nicht nur durch wechselnde Ich-Perspektiven und eine Handlung voll erschreckender sowie bewegender Momente, sondern auch durch den Duktus. Im ersten Teil erscheint er zunächst kurz formelhaft und steif, so wie sich eben der verwundete Tagebuchschreiber bewegt. "Auch ohne Zerwürfnis mit den Eltern war die zwischenmenschliche Bilanz meines Lebens verheerend", führt er Buch.
Im Laufe seiner Aufzeichnungen erweist er sich als scharfer Beobachter, gelegentlich ironisch, wenn er das NS-Regime den "Dienstgeber" nennt. Das Scheitern der Offensive an der Ostfront sei abzusehen. "Doch aufhören? Das wäre total gegen den Stil des Hauses gewesen." Es sind die lakonischen Einsichten eines Erschöpften, die Klarheit hinter den Phrasen schaffen: "Die Partei war bemüht, ihren Lebensraum in die Köpfe der Kinder auszudehnen."
Auch den Teilen des Romans, die aus jeweils drei Briefkorrespondenzen bestehen, hat Geiger behutsam einen je eigenen Tonfall verliehen, ohne dies in den Vordergrund zu spielen. Aus Darmstadt kommen die redundanten Familiennachrichten vom prekären Leben und Ableben unter den Bomben, dazwischen ein paar banale Bemerkungen; vom jungen Kurt die schwärmerischen Worte an Nanni, die sich den Zwängen entwinden will und lange vermisst bleibt; von Oskar Meyer die quälende Suche, der Judenverfolgung zu entfliehen, und die Selbstvorwürfe, falsche Entscheidungen getroffen zu haben.
Hoffnungsschimmer der Liebe
Gemeinsam ist ihnen allen ihre Genauigkeit, eine zeitweilige Verknappung zur Deutlichkeit: "Wie schlecht eine Zeit ist, erkennt man daran, dass sie auch kleine Fehler nicht verzeiht", stellt Oskar lapidar in zu spät gewonnener Einsicht richtig fest. Nicht nur dank seines stimmigen, anziehenden Arrangements gelingt Geiger ein dichtes Romangeflecht, sondern auch mittels feiner Ketten von Motiven wie der dünnen Wände, durch die Geräusche und Klopfzeichen dringen. Und am Ende lässt er einige Protagonisten der verschiedenen Erzählstränge kurz aufeinandertreffen. Entsprechend notiert der genesende Soldat Veit Kolbe, "dass ein kleiner Kreis Anstalten macht, sich zu schließen". Alle Hauptfiguren verbindet das latente Gefühl der Aussichtslosigkeit und dennoch der Hoffnungsschimmer der Liebe.
Die Zusammenstellung persönlicher Schicksale ergibt zugleich ein tiefgreifendes Panorama der dunklen Jahre: Frontgrauen und schrecklicher Hunger, Bombenkeller und Disziplinierungen, Unwirtlichkeiten im täglichen Überleben, auch menschliche Gesten und starke Emotionen. Der Romantitel verweist auf das Drachenmotiv der Zeit, als die Nazis Siegfried den Drachentöter führerhaft völkisch propagierten, und klingt an Under the Volcano (1947) von Malcolm Lowry an – auch in dieser großen Parabel geht es um Herrschaft und Unterdrückung, Grausamkeit, Wut und Lethargie.
Auffallend viele Bücher der vergangenen Monate kommen auf die großen Waffengänge, den Dreißigjährigen Krieg, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg zurück. Sie zeugen von der heutigen Notwendigkeit, sich zu erinnern. Kurt Bauers historisches Sachbuch Die dunklen Jahre führt, auch aus der Sicht persönlicher Lebenszeugnisse, "Politik und Alltag im nationalsozialistischen Österreich" schauerlich vor Augen. Bei Geiger ersteht nun diese Zeit ebenso packend wie literarisch gelungen. (Klaus Zeyringer, Album, 7.1.2018)