
Elan Mastai: "Die beste meiner Welten"
Gebundene Ausgabe, 480 Seiten, € 20,60, Goldmann 2018 (Original: "All Our Wrong Todays", 2017)
Peter S. Beagle: "In Kalabrien"
Gebundene Ausgabe, 164 Seiten, € 16,50, Klett-Cotta 2018 (Original: "In Calabria", 2017)
Mir scheint, die Prognose-Qualität der Rundschau ist im Steigen: Bevor es auf den nächsten Seiten zu den Neuvorstellungen geht, sei hier noch schnell auf zwei hervorragende Erzählungen aus dem Vorjahr verwiesen, die schon im Original besprochen wurden und nun auch auf Deutsch erschienen sind. Die Links im Text führen zu den jeweiligen Rezensionen von 2017.
"Die beste meiner Welten" heißt die Übersetzung von Elan Mastais famosem Roman "All Our Wrong Todays", der quietschvergnügt beginnt und allmählich – ohne deswegen an Unterhaltungswert einzubüßen – eine nachdenklichere Richtung einschlägt. Die Prämisse: Die "Zukunftswelt" des Jahres 2016 müsste eigentlich so aussehen, wie man sich das in den 50er Jahren vorgestellt hat: voller Flugautos, unbegrenzter Energiequellen und sonstiger technischer Innovationen. Leider hat der Romanheld Tom Barren dann aber durch eine ungeschickt verlaufende Zeitreise alles verändert und die Welt den Lauf nehmen lassen, den wir kennen. Nun plagt ihn die Frage: Lässt sich das wieder rückgängig machen?
Hinterfragenswerte Preis-Wahl
Anfang April wurden die Nominiertenlisten für den Hugo Award, den renommiertesten Preis für SF-Literatur, bekanntgegeben. Mastais Roman glänzt darauf wie einige andere beeindruckende Werke – etwa Daryl Gregorys "Spoonbenders" oder Cory Doctorows "Walkaway" – durch Abwesenheit. Stattdessen drängeln sich in der Romankategorie die üblichen Verdächtigen, die Jahr für Jahr wieder und wieder und wieder nominiert werden: N. K. Jemisin, John Scalzi, Ann Leckie, Yoon Ha Lee ... und zumindest Scalzis "Collapsing Empire" war wirklich alles andere als ein großer Wurf, da hat der Autor schon bedeutend Besseres abgeliefert. Das ist keine erfreuliche Entwicklung.
Für Peter S. Beagle war auf der rein weiblich besetzten Nominiertenliste in der Novellenkategorie offensichtlich auch kein Platz mehr – erneut völlig unverständlich. Umso erfreulicher der Umstand, dass "In Calabria" ins Deutsche übersetzt wurde; das ist bei kürzeren Werken ja keineswegs selbstverständlich.
Der Fantasy-Altmeister kehrt darin zu seinem Erfolgsthema Einhörner zurück. Anders als im Weltbestseller "Das letzte Einhorn" spielt das Sagentier hier aber nicht die Hauptrolle, sondern übt nur die Funktion eines Katalysators aus. Im Zentrum steht Claudio, ein nicht mehr ganz junger italienischer Bauer aus unserer Gegenwart, auf dessen Hof sich eines Tages ein Einhorn einfindet, um ein Junges zur Welt zu bringen. Claudios beschauliches Leben gerät damit völlig aus den Fugen. Ganz plötzlich hat er es nun mit lästigen Touristen, den Medien und der Mafia zu tun – aber auch mit der unverhofften Chance auf eine neue Liebe. "In Kalabrien" schildert in poetischer Weise, wie aus einer Existenz, mit der man sich abgefunden hat, ganz unerwartet wieder ein Leben werden könnte. Sehr schön!
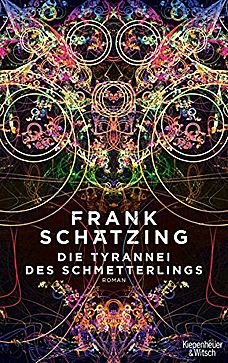
Frank Schätzing: "Die Tyrannei des Schmetterlings"
Gebundene Ausgabe, 734 Seiten, € 26,80, Kiepenheuer & Witsch 2018
Der Schätzing ist wieder da! Dafür verschiebe ich jetzt glatt das eigentlich für diese Rundschau geplante "Die Tiefe der Zeit" von Andreas Brandhorst um einen Monat (zwei Wälzer der Doppelrahmstufe wären sich einfach nicht mehr ausgegangen). Aber ein neuer Schätzing ist eben ein bedeutend selteneres Ereignis als ein neuer Brandhorst: Neun Jahre ist es schon her, dass der deutsche Bestsellerautor zuletzt in der Rundschau vertreten war, nämlich mit "Limit". Seitdem ist nur der nicht zur Phantastik gehörende Roman "Breaking News" erschienen. Und jetzt also "Die Tyrannei des Schmetterlings", das dem Alltime-Favorite "Der Schwarm" zum Glück deutlich näher kommt als "Limit". Großes Kino!
Künstliche Intelligenz wird uns im Klappentext als Thema verheißen. Also eines, das vor Frank Schätzing schon jede Menge anderer Autoren abgehandelt haben, zuletzt etwa (da ist er schon wieder!) Andreas Brandhorst in "Das Erwachen". Aber – pst! – darum wird es hier die längste Zeit gar nicht gehen, jedenfalls nicht hauptsächlich. "Die Tyrannei des Schmetterlings" ist Schätzings sciencefictioneskester Roman bisher und greift neben KIs und der Gefahr einer technologischen Singularität eine ganze Reihe bewährter SF-Konzepte auf. Ein für die Handlung weniger wichtiges (menschliche Bewusstseine, die in Kunstkörper geladen werden) sei als Beispiel genannt. Dasjenige, das den Plot prägen wird, verschweige ich hier aber, um die Überraschung nicht zu verderben. Ich zumindest hätte die Richtung nicht erwartet, die der Roman ab dem Ende von Abschnitt 2 einschlägt.
Und so beginnt es
Im Prolog dürfen wir miterleben, wie ein Soldatentrupp in einem afrikanischen Bürgerkrieg von einem Schwarm vorerst nicht näher vorgestellter Kreaturen ausgelöscht wird. Zwingend notwendig für die Gesamthandlung ist diese erst viel später erklärte Episode nicht. Sie fungiert aber als der in Thrillern gerne eingesetzte Schockeffekt zum Auftakt, der uns verheißen soll: Hier wird sich noch einiges tun (ungelogen übrigens, im vorletzten Abschnitt wird ordentlich die Post abgehen). Nach einem solchen Vorglühen kann sich dann die eigentliche Handlung ganz langsam und in aller Ruhe aufbauen.
Und wo wäre es ruhiger als in einem Kaff in der kalifornischen Sierra? Das ist das Einsatzgebiet von Hauptfigur Luther Opoku, der kurz vor der Beförderung zum Bezirkssheriff steht und all die kleinen und mittleren Rechtsverstöße aufklären soll, wie sie in der Provinz eben so anfallen. Wir fühlen uns beim Lesen also zunächst wie in einer dieser Reality-Serien à la "Alaska State Troopers" oder "Lone Star Law". Bis Luther in einem Canyon eine Frauenleiche findet – offenbar ist die Arme in blinder Panik ungebremst über die Klippe gerannt.
Ungeahnte Herausforderungen
Seine Ermittlungen führen Luther zum Hightech-Unternehmen Nordvisk, das in der Gegend eine geheime Anlage betreibt. Firmengründer Elmar Nordvisk ist eine dieser visionären Gestalten, die sich mit Elon Musk und Sergey Brin zum Gedankenaustausch treffen und in Wissenschaftsthrillern gerne eine undurchsichtige Rolle spielen. Nordvisks bedeutsamste Schöpfung ist der Quantencomputer A.R.E.S., der sich als wahrer Wunderwuzzi erweist und in allen möglichen Bereichen die Innovation vorantreibt.
Aha, Quantencomputer --> Künstliche Intelligenz --> Singularität, werden jetzt alle denken. Und ja, irgendwann wird es auch in diese Richtung gehen. Aber vorher kommt eben noch dieser gänzlich unerwartete Plot, der dem Buch einen erfreulichen Überraschungseffekt beschert. Der auch, das muss man gerechtigkeitshalber sagen, nur äußerst unbefriedigend erklärt wird, was die technologisch-physikalischen Aspekte anbelangt. Aber hey: lieber etwas nicht ganz ausgegorenes Überraschendes als an zusammenrecherchierten Fakten klebende Erwartbarkeit.
Die Rückkehr des Erzählers
Schätzing hat in seinen vergangenen Werken einen Mischstil aus Roman und Sachbuch entwickelt, der auf reichlich Kritik gestoßen ist. Die Recherche an sich ist ehrenwert, aber die 1:1-Wiedergabe in sachbuchartigen Passagen oft genug langatmig. Doch der Autor hat offenbar darauf reagiert. Wenn hier der Satz fällt: "Wenn du mir noch einmal Wikipedia vorliest, schalte ich dich ab", dann kann das nur ein Anfall von Selbstironie sein.
Und von Einsicht. "Die Tyrannei des Schmetterlings" beginnt mit der stimmungsvollen Beschreibung eines Wetterereignisses – eine Prozessschilderung ganz ähnlich der, mit der einst Lawrence Norfolk sein "Ein Nashorn für den Papst" beginnen ließ. Das liest sich, als sollte hier gleich zu Beginn eine Duftmarke gesetzt werden: He Leute, ich lege jetzt wieder mehr Wert aufs Erzählen. Dieser Eindruck wird sich im Verlauf des Romans bestätigen. Der strotzt zwar immer noch vor Faktenwiedergaben und philosophischen Exkursen. Aber sie sind diesmal organischer eingebaut und mit ausreichend Action abgefedert.
Es bleibt aber eine Breitwand-Erzählung, da machen wir uns nichts vor. Schlank wirkt "Schmetterling" nur im Vergleich zum 1.300-Seiten-Monster "Limit" (ob der Titel damals auch selbstironisch gemeint war?). Mit über 700 Seiten ist es natürlich immer noch ein ordentlicher Brocken. Ausufernde Beschreibungen tragen ebenso ihren Teil zum Volumen bei wie mehr oder weniger wissenswerte Exkurse über die Vorgeschichten von Neben- und Randfiguren. Und vor allem reizt Schätzing den Aufbau von Schlüsselmomenten gerne bis zum Anschlag aus. Wenn Luther ein bedeutsames Foto findet, dann vergehen erst mal mehrere Seiten voller "Wie Luther reagiert", bis wir endlich selbst erfahren dürfen, was auf dem verdammten Foto denn zu sehen ist. Mitunter wird also die Geduld des Lesers strapaziert – aber immer geraaaaade so noch nicht überstrapaziert.
Hat sich gelohnt
Vor der Lektüre lautete die große Frage, wie sich Schätzings Version von all den anderen Singularität-durch-KI-Romanen auf dem Markt unterscheiden würde. Die Antwort: Sie tut's durch einige unerwartete Handlungsverläufe, die bis zum psychedelischen Schlusskapitel die Ungewissheit aufrechterhalten, wie's wohl weiter- bzw. ausgehen mag. Mehr kann man sich eigentlich nicht erhoffen. Ein Buch zum richtig schön Schmökern, dessen größter Fehler bleibt, dass es zur falschen Jahreszeit erschienen ist. Jetzt liest man draußen auf Parkbänken und Wiesen, und dorthin kann man dieses massive Trumm wirklich nicht mitnehmen.
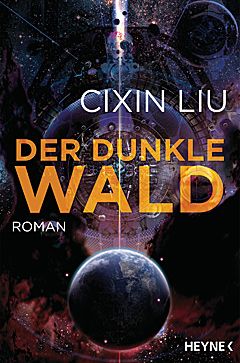
Cixin Liu: "Der dunkle Wald"
Klappenbroschur, 815 Seiten, € 17,50, Heyne 2018 (Original: "Heian Senlin", 2008)
Das Universum ist ein dunkler Wald. Erst spät im Buch wird dieser Satz fallen, um uns den Titel zu erklären. Und die Auflösung hat nichts damit zu tun, dass man am Anfang tatsächlich glaubt, im Wald zu stehen: Die Fortsetzung von Cixin Lius mega-erfolgreichem Roman "Die drei Sonnen" startet nämlich mit rasantem Hin- und Herschalten zwischen jeder Menge Protagonisten, aus denen sich dann aber zum Glück doch noch eine klare Hauptfigur herausschält. Und ab dann fließt der Roman dahin, dass es eine wahre Freude ist: Selbst 800 Seiten können wie im Flug vergehen!
Die Anbindung an den Vorgängerband besorgt ein sehr schöner Einstieg, in dem die Hauptfigur von "Die drei Sonnen", Ye Wenjie, gleichsam das Handlungszepter an ihren Nachfolger Luo Ji übergibt – und das alles geschildert aus der Perspektive einer Ameise. An welchem Ort sich Menschen und Insekt dabei befinden, verrate ich hier nicht: Soll jeder selber ausprobieren, wie lange er braucht, bis er es erraten hat.
Die Lage
An dieser Stelle ist erst einmal ein Rückblick notwendig, um die Situation kurz zu umreißen: Man hat entdeckt, dass ein außerirdisches Volk, die Trisolarier, eine Invasionsflotte Richtung Erde ausgeschickt hat. In 400 Jahren werden sie eintreffen, und der Menschheit droht der Untergang. Abwehrmaßnahmen gestalten sich durch die überlegene Technologie der Aliens aber fast unmöglich.
Die Trisolarier haben sogenannte Sophonen vorausgeschickt. In "Die drei Sonnen" wird deren Herstellungsprozess beschrieben – vereinfacht ausgedrückt dürfen wir sie uns als intelligente Partikel bzw. dimensionslose Künstliche Intelligenzen vorstellen, die alles sehen und alles durchdringen (vgl. dazu Cixin Lius Konzept vom allsehenden Auge in der Novelle "Spiegel"). Ihre begrenzten Eingriffsmöglichkeiten in den dreidimensionalen Raum reichen den Sophonen aus, jegliche Grundlagenforschung zu sabotieren, ob an Quantencomputern oder neuen Raumfahrtantrieben. Den Menschen bleibt nur, all das optimal auszunutzen, was sie bereits an Technologie entwickelt haben.
Das Wandschauer-Programm
Nur eine Schwäche haben die Trisolarier: Sie sind mit dem Konzept der Lüge nicht vertraut. (So beispielsweise klingt ein Gespräch mit einem ihrer menschlichen Handlanger: "Die Unterschiede in der Transparenz des Denkens sind für uns nur ein Grund mehr, die Menschheit zu vernichten. Bitte helft uns dabei. Danach werden wir euch vernichten." – "Ihr drückt Euch etwas ungeschickt aus, wenn ich das so sagen darf, Herr.") Diese Schwäche versucht die UNO auszunutzen und ruft das Projekt Wandschauer ins Leben; "wandschauen" bedeutet übrigens in etwa "meditieren". Ein paar ausgewählte Einzelpersonen sollen Verteidigungsstrategien ausarbeiten, jedoch mit niemandem darüber sprechen, sondern hinter einer Nebelwand aus vorgetäuschten Maßnahmen ihre wahren Pläne verbergen – die einzige Möglichkeit, die Sophonen auszutricksen.
Aus diesem im Grunde irrsinnigen Plan entspringt ein mehrfaches Dilemma. Zum einen wird den insgesamt nur vier Auserwählten praktisch unbegrenzte Macht in die Hände gegeben – da kann der eine oder andere schon dem Größenwahn erliegen. Zum anderen haben aber auch die Wandschauer selbst ein Problem: Sie können nichts mehr tun, ohne dass man es ihnen als Teil ihrer Weltrettungsstrategie gutschreibt. Sie können nicht einmal aus dem Projekt aussteigen – auch das könnte ja Teil ihres Plans sein. Sie werden also die Verantwortung einfach nicht los.
Der unfreiwilige Held
Luo Ji hat es versucht. Während es sich bei den anderen drei Wandschauern um weltbekannte Strategen handelt, ist er nur ein unscheinbarer Uni-Dozent für Soziologie und neuerdings auch Kosmologie. Luo Ji hat keine Ahnung, warum man auch ihn auserwählt hat oder warum die Schergen der Trisolarier hinter ihm ganz besonders eifrig her sind. Als er seine neue Rolle ablehnen will und frustriert feststellen muss, dass ihm das aus besagten Gründen keiner glaubt, beschließt er, aus seiner Situation das Beste zu machen: Er nutzt die unbegrenzten Ressourcen der UNO dafür, sich ein gemütliches Feriendomizil einrichten zu lassen – und auch gleich dafür, dass man eine Ehefrau für ihn findet, die seinem Ideal entspricht. Und obwohl er sonst nichts tut, wird ihm jeder Wunsch erfüllt. In dieser Zeit allerhöchster Anspannung war Luo Ji der entspannteste Mann der Welt.
Ob und wie und warum Luo Ji doch noch in die Gänge kommt, sei hier nicht verraten. Wohl und Wehe der Hauptfigur sind aber ohnehin nur ein Aspekt des insgesamt sehr breit angelegten Romans. "Der dunkle Wald" wird als mehrere Jahre umspannende Chronik erzählt, vor dem letzten Teil erfolgt sogar ein Sprung über zwei Jahrhunderte (dank Kälteschlaftechnologie bleiben uns aber die wichtigsten Protagonisten erhalten). Schon in der ersten Hälfte des Buchs spricht Cixin Liu eine große Zahl technologischer und physikalischer Konzepte an. Nach dem Zeitsprung wird sich das noch einmal deutlich verstärken.
In dieser ziemlich veränderten Zukunftswelt wird dann eine ganze Parade an SF-Konzepten an uns vorbeiziehen: Die Zeitreise und die Führung durch ein zukünftiges Utopia. Das Generationenschiff. Heimtückische Attacken durch technische Geräte, die einen eigenen Willen zu haben scheinen. Der Erstkontakt mit einem rätselhaften Stück außerirdischer Technologie. Und ein Weltraumgefecht (oder genauer gesagt ein Weltraummassaker). Es wirkt, als wollte Cixin Liu den gesamten Ideen-Output der SF des Goldenen Zeitalters in seiner Trilogie zusammenführen. Das klingt nach zu viel, interessanterweise wirkt der Roman aber nicht überladen. Was zum einen an der leicht verständlichen Schreibe des Autors liegt, zum anderen aber auch daran, dass er all die verschiedenen Elemente irgendwie zusammenhält. Und keines davon unterwegs vergisst – nicht einmal die Ameise vom Anfangskapitel.
Empfehlung!
Insgesamt kann ich sagen, dass mir "Der dunkle Wald" um einiges besser gefallen hat als der mit unglaublichen Vorschusslorbeeren versehene Vorgängerband. Zum Großteil lag das sicher an der jeweiligen Erwartungshaltung. Eine Rolle dürfte aber auch spielen, dass die Trisolarier im aktuellen Band nur als Macht im Hintergrund agieren und deshalb den Nimbus des Geheimnisvollen wahren können (tut ihnen gut – im ersten Band kamen sie doch recht banal rüber). Nimmt man dazu noch, wie geschickt sich in "Der dunkle Wald" tiefe Ernüchterung und Hoffnungsschimmer die Waage halten, darf man wirklich gespannt sein, welchen Ausgang die geplante Invasion der Erde im Abschlussband nehmen wird. Erfahren werden wir das aber leider erst in einem Jahr.

Yoav Blum: "The Coincidence Makers"
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, St. Martin's Press 2018, Sprache: Englisch (Original: "Metsarfe ha-mikrim", 2011)
Menschen geraten ins Netz rätselhafter Organisationen, die mit übernatürlich erscheinenden Kräften Zufälle steuern und den Lauf des Schicksals lenken können: Das ist nicht das häufigste Mystery-Motiv, aber eines, das in der Phantastik immer wieder mal auftaucht. Denken wir etwa an den Kampf zwischen The Purpose und The Random in Stephen Kings "Insomnia" ("Schlaflos") oder den Matt-Damon-Film "The Adjustment Bureau" ("Der Plan"), der auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick beruhte.
Zu Letzterem weist Yoav Blums bezaubernder Roman "The Coincidence Makers" einige unverkennbare Parallelen auf, doch kehrt der israelische Autor die gängige Formel solcher Plots um. Seine Hauptfiguren sind nicht Menschen, die erkennen müssen, dass ihr Leben von äußeren Kräften gesteuert wird, und sich dagegen wehren. Diesmal betrachten wir das Ganze aus der Perspektive der reality backstage-workers selbst. Die tragen Namen wie Guy, Emily oder Eric und scheinen auf den ersten Blick ganz normale Menschen zu sein. Sie versuchen, sich in der Organisation, für die sie arbeiten, zu bewähren, verspüren den üblichen beruflichen Leistungsdruck – finden zwischendurch aber auch mal Zeit für einen Schwatz im Café und schließen dort Wetten ab, wer den besten unwahrscheinlichen Zufall konstruieren kann.
Die Arbeit hinter der Bühne
So ganz der Junge und das Mädchen von nebenan sind die Protagonisten natürlich nicht. Das wird uns spätestens dann klar, wenn wir erfahren, dass Hauptfigur Guy in seiner früheren Karriere der imaginäre Freund einer langen Reihe von Kindern war, ehe er für den Jobwechsel zum Coincidence Maker einen feststofflichen Körper erhielt. Guy und seine Freunde mögen ein paar Fähigkeiten haben, die über das Menschliche hinausgehen. Da sie in der Hierarchie der Organisation noch auf der Anfängerstufe stehen, sind diese aber stark begrenzt – mal eben jemanden krank werden lassen, spielt's beispielsweise nicht ("We don't work at the cellular level.").
Vielmehr verlangen ihre Aufträge wochenlange Recherchearbeiten und subtile Weichenstellungen: An der Wand in Guys Wohnung breiten sich im Verlauf jedes Projekts riesige multifaktorielle Diagramme aus. Denn das deterministische Chaos wird ausgehebelt, sobald man alle Variablen kennt und steuert – und genau das ist der Job eines Coincidence Makers. Selbst wenn er dafür auf einen anderen Kontinent fliegen und einen ganz bestimmten Schmetterling zu dem Flügelschlag animieren muss, der später an einem anderen Ort einen entscheidenden Windstoß auslösen wird. Es ist angewandte Chaosforschung in höchster Vollendung! Da kann man Guy den Stolz auf seine Leistungen wirklich nicht übel nehmen: It was the sensation that came from knowing he was about to reach out a finger and nudge the planet, or the heavens.
Die Ziele der Zufallsmacher
Wer sich jetzt schon die ganze Zeit fragt, was es mit dieser geheimnisvollen Organisation auf sich hat: Nun, zumindest dürfte sie auf der Seite des Guten stehen. Sie versucht, potenzielle Liebespaare zusammenzubringen, Inspirationen für Kunstwerke oder Erfindungen zu schaffen und Ähnliches. Und sie tut das schon seit langer Zeit. Der Roman ist durchsetzt mit Lehrbuchpassagen, in denen uns erschlossen wird, wie sich die ehrwürdige Disziplin des Coincidence-Making im Lauf der Jahrzehnte weiterentwickelt hat, wie ihre wichtigsten Techniken funktionieren und welche Aspekte von ihren herausragenden Köpfen kontrovers diskutiert werden. Guy und seine Freunde sind schließlich noch Studenten, und zusammen mit ihnen erhalten wir so eine Ahnung davon, wie umfassend das Wissenskorpus ist, das sich ein Zufallsmacher aneignen muss.
Zugleich erden diese äußerst nüchtern gehaltenen Kapitel den Roman, der insgesamt beschwingt und gerne mal im Tonfall leiser Ironie erzählt wird, aber auch vor dem großen Gefühl nicht zurückscheut. Erwartbar wäre wohl, dass ein solcher Plot auf das alte Thema von Schicksal versus freier Wille hinausläuft, aber das spielt hier interessanterweise gar keine so große Rolle. Die Coincidence Makers legen Wert darauf, dass sie Möglichkeiten schaffen, keine Zwänge – ihre Klienten können die ihnen gebotenen Gelegenheiten immer noch ausschlagen. Es geht nicht darum, ob man überhaupt freie Entscheidungen treffen kann, sondern darum, welche Entscheidungen man trifft. Und so gut wie alle drehen sich hier um die Liebe.
Klar empfehlenswert!
Das Thema Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Roman: Von dem Paar, das Guy zu Romanbeginn durch eine ausgefuchste Konstruktion zusammenbringt, über den Klienten, der jede Hoffnung auf Liebe längst aufgegeben hat, bis zu Guys eigenen Problemen: Er denkt immer noch wehmütig an Cassandra – ebenfalls eine imaginäre Freundin – zurück, die er verlor, als er in seine neue Existenz wechselte.
Natürlich bietet "The Coincidence Makers" all das, was man bei einem solchen Mystery-Plot erwarten würde: Details, die erst später Sinn ergeben werden, Twists und ungeahnte Querverbindungen sowie eine ausgeklügelte Konstruktion, die am Schluss einen perfekten Bogen schlägt. Vor allem aber ist es eine sehr menschliche Geschichte. Jeder, der Herz hat, wird dieses Buch am Ende mit einem wohligen Aaaaaah zuschlagen.
Nachtrag: Was Yoav Blum anbelangt, ist gerade eine Übersetzungswelle ins Rollen gekommen. Drei Romane hat der Autor bislang auf Hebräisch geschrieben, alle mehr oder weniger stark mit Phantastik-Elementen versehen. "The Coincidence Makers" ist inzwischen als erstes Buch nicht nur ins Englische, sondern in eine ganze Reihe weiterer Sprachen übersetzt worden. Im Herbst soll auch eine deutschsprachige Ausgabe erscheinen.
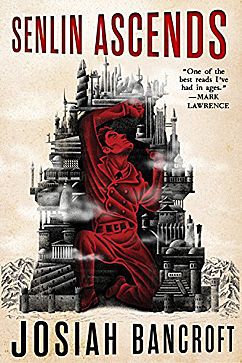
Josiah Bancroft: "Senlin Ascends"
Broschiert, 432 Seiten, Orbit 2018, Sprache: Englisch
Bei Fantasy mehr noch als bei Science Fiction braucht es schon eine originelle Prämisse, um mich hinter dem Ofen hervorzulocken: Die hat der Klappentext hier eindeutig verheißen: "Senlin Ascends" soll sich um einen Touristen drehen, dem seine Frau im Turm zu Babel verloren geht, das ist doch mal originell! Persönlicher Bezug war auch vorhanden (ich hab mal auf Interrail meine Mitreisenden am Eiffelturm verloren und erst Monate später wiedergesehen) – schon war ich also angelockt. Und es hat sich absolut gelohnt: US-Autor Josiah Bancroft hat hier ein wirklich ungewöhnliches Debütwerk hingelegt.
Das Setting des Jahres
Der Eiffelturm ist natürlich nur eine Hütchenspielfigur im Vergleich zum Schauplatz dieses Romans. Denn der Turm zu Babel in "Senlin Ascends" nimmt sich eher wie die steinerne Version eines Weltraumlifts aus. Nur Aeronauten und Mystiker behaupten, je seine weit über die Wolken hinausragende Spitze gesehen zu haben. Was ihnen allerdings eh keiner glaubt, Gerüchten zufolge wird der Turm sogar immer noch aufgestockt. Wie alt er ist und wer den Bau einst begonnen hat, weiß niemand mehr. Dabei kennt die Gesellschaft des Romans bereits Luftschiffe und Eisenbahn und macht erste Versuche mit Elektrizität: Da sollte sie doch mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein, das uralte Geheimnis beizeiten zu ergründen. Wir werden sehen!
Wir scheinen uns jedenfalls in einer Welt zu befinden, in der der eifersüchtige biblische Gott das größte Bauwerk der Menschheit nie ruiniert hat. Das Land, in dem der Turm steht, heißt (immer noch) Ur – Verweise auf andere Weltregionen bleiben vage und widersprüchlich. Mal wird kurz etwas vertraut Klingendes erwähnt, mal rätseln wir, wo das Herkunftsland der sehr westlich wirkenden Hauptfiguren liegen mag. Als Titelheld Thomas Senlin zu Romanbeginn im unfassbaren Gewimmel am Fuße des Turms ankommt, kommentiert er dies jedenfalls mit bestem britischen Understatement: "It certainly is busy." Generell ist der Roman sehr ansprechend geschrieben. Bancroft pflegt eine kultivierte Ausdrucksweise, in die drollig veraltete Wörter wie foofaraw oder loblolly ganz selbstverständlich einfließen.
Die Suche beginnt
Lange braucht der durchaus umfangreiche Roman übrigens nicht, um seiner Prämisse gerecht zu werden: Schon nach zehn Seiten hat Thomas seine Frau Marya in der Menschenmenge verloren. Von der Verschwundenen können wir uns fürderhin also nur in einigen kurzen Rückblenden ein Bild machen und werden dabei feststellen, dass wir es mit einem recht ungleichen Paar zu tun haben. Zuhause in Isaugh konnte niemand so recht fassen, dass die lebhafte Marya einen unscheinbaren Kleinstadtlehrer wie Thomas geheiratet hat. In einem seltenen Anfall von Abenteuerlust wählte dieser aber den Turm zu Babel als Flitterwochenziel aus – und jetzt hat er den Salat.
Rasch zeichnet sich ab, dass der Turm mit seinen ringdoms genannten einzelnen Ebenen eine Welt für sich ist. Der Glamour der Touristenattraktionen kann aber nicht ganz verdecken, dass hier höchst brutale und oft unfaire Regeln gelten: Wer sein Urlaubsbudget überzieht, wird versklavt, unerwünschten Besuchern verpasst man ein Brandmal oder löffelt ihnen die Augen aus. Selbst auf der sogenannten Bäder-Ebene, deren Flair an den "Zauberberg" oder "Fellinis Schiff der Träume" denken lässt, kann es passieren, dass einem angeblichen Kriminellen öffentlich, zwischen Strandpromenade und Kurkonzert, der Kopf abgerissen wird – buchstäblich.
Und immer mehr erinnert der Turm mit der Zeit an ein Schwarzes Loch, das niemanden mehr freigibt, der seinen Ereignishorizont überschritten hat. Unter den verschiedenen Nebenfiguren, denen Thomas im Verlauf seiner vertikalen Queste begegnet, ist auch ein Lebemann, der seit 16 Jahren im Turm versumpft ist und sich nicht zur Abreise aufraffen kann. Der wird Thomas warnen: "You have no idea what the Tower will turn you into!"
Erwarte das Unerwartete
Gründe, warum "Senlin Ascends" als Roman ausgezeichnet funktioniert, gibt es mehrere. Da ist zum einen natürlich der Originalitätsfaktor. Liebhaber herkömmlicher Fantasy-Kampfaction werden hier trotz immer wieder aufflammender Brutalität nicht auf ihre Rechnung kommen – erst im letzten Abschnitt kommt es zu einem Gefecht klassischer Prägung. Dafür bietet der Turm mit seinen sehr unterschiedlichen "Reichen" immer wieder Gelegenheiten für gänzlich unerwartete Handlungsvolten.
Mal sieht sich Thomas durch die Umstände zum Diebstahl eines schwer bewachten Gemäldes genötigt. Mal muss er an einem surrealen Massentheater teilnehmen – nicht im Sinne einer olympischen Eröffnungszeremonie, sondern als Darsteller in einem von unzähligen identischen Vier-Personen-Stücken, die parallel zueinander aufgeführt werden. Der Plot (des Romans, nicht des Stücks) ist erfreulich unvorhersehbar, und manchmal enthüllt sich der Sinn des Erlebten erst viel später.
Kein größeres Abenteuer als das Leben
Um und Auf des Romans ist aber, wie gut sich der Turm als Metapher für das Leben an sich eignet – denn in das muss sich unser unfreiwilliger Held nun stürzen, will er seine Holde wiederfinden. Am Anfang präsentiert sich uns Thomas als zurückhaltender und etwas steifer Buchgelehrter, der aufgebracht seinen Reiseführer schwenkt, wenn die Realität es wagt, nicht mit dem darin Geschriebenen übereinzustimmen. Kurze Auszüge aus diesem "Everyman's Guide to the Tower of Babel" sind übrigens jedem Kapitel vorangestellt ... bis sie später ganz unauffällig von solchen aus einem anderen Buch abgelöst werden: einem, das Thomas selber geschrieben hat und das einen etwas anderen Ton anschlägt. So können wir miterleben, wie sich im Verlauf der mehrere Monate umfassenden Handlung aus dem Bücherwurm ein Mann mit "Packen wir's an"-Attitüde entwickelt. In einer Rezension wurde Thomas Senlin als der unwahrscheinlichste Held seit Bilbo Baggins bezeichnet, und das ist – inklusive Sympathiewert – gar nicht so verkehrt.
Dieser beachtliche Persönlichkeitswandel wird zum Ende des Romans abgeschlossen sein, was aber auch – hier nun die schlechte Nachricht – das Einzige ist, was zu einem Abschluss gebracht wird. Bancroft hat sein monumentales Erstlingswerk auf vier Bände angelegt. Immerhin: Kurz nach der Veröffentlichung des eigentlich schon 2013 fertiggestellten "Senlin Ascends" ist auch bereits die Fortsetzung "Arm of the Sphinx" auf den Markt gekommen. Danach heißt es aber erst mal warten – an Band 3 wird gerade erst geschrieben.
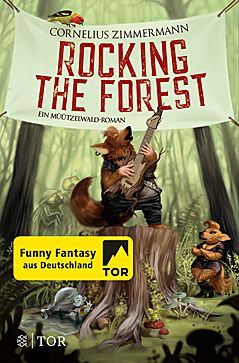
Cornelius Zimmermann: "Rocking the Forest"
Broschiert, 364 Seiten, € 10,30, Fischer Tor 2018
Der Flügelflagel gaustert
durchs Wiruwaruwolz,
die rote Fingur plaustert,
und grausig gutzt der Golz.
Unwillkürlich ist mir mein Lieblingsgedicht von Christian Morgenstern durch den Kopf gegangen, als ich "Rocking the Forest" zu lesen begonnen habe – setzt der deutsche Autor Cornelius Zimmermann in seinem Roman doch auf ein ähnlich lautmalerisches Wording. Schauplatz ist der Müützelwald, ein kunterbunter Forst voller intelligenter Tierwesen, die fiktiven Spezies wie Wolfmorfen, Mulmen und Ähnlichem angehören und eines gemeinsam haben: Sie alle stehen auf Musik.
Andere Assoziationen waren Alan Dean Fosters "Bannsänger"-Zyklus (darum kommt man bei der Kombination Funny Fantasy plus musizierende Tiere einfach nicht herum, auch wenn es plottechnisch keine wirklichen Parallelen gibt) und nicht zuletzt der Song "Love Is All" von Roger Glover aus dem Jahr 1975. Manche erinnern sich vielleicht an das dazugehörige Zeichentrickvideo mit dem rockenden Frosch: Das war zum Entzücken ganzer Generationen von Kindern jahrzehntelang ein beliebter Programmfüller diverser TV-Sender.
Let There Be Rock
Zimmermanns (Anti-)Held heißt Iggy und würde sich ganz gut in einem Roman von Sven Regener machen – blendet man aus, dass es sich um einen Wolfmorf handelt, ein nicht näher definierbares kleines Pelztier mit Maulwurfsschaufeln und buschigem Schwanz. Vor allem aber ist Iggy eines: ein Musiker. Malen wir ihn uns als einen Rocker der alten Schule mit klaren Wertvorstellungen aus: Es ist ehrenvoller, alleine auf leerer Bühne im eigenen Erbrochenen zu ersticken, als die Bühne erst gar nicht zu betreten. Wenn Iggy nicht gerade jammt, hängt er in Waldkneipen herum und grantelt über den Verfall der Musikkultur. Denn aktuell sind im Müützelwald Auswüchse wie Libellenpop angesagt: schwere Zeiten für einen, der nur guten alten Forest Doom (das Müützelwald'sche Pendant zu Rock) gelten lässt.
Wegen seiner Kompromisslosigkeit überwirft sich Iggy mit dem Rest seiner Band – und steht damit nur wenige Tage vor dem alljährlichen Rocking the Forest Band Contest plötzlich ganz alleine da. In seiner Not fällt ihm nur ein Ausweg ein: Er pilgert zum legendären Musik-Guru Blubb die Pfütze. Es ist eine Reise quer durch den Wald, die ihn mit allerlei fantastischen Wesen, Missgeschicken und Gefahren konfrontieren wird, und zugleich ein Trip durch die Vielfalt der Müützelwalder Musikstile: von Quallen-Psychedelia bis Schneckenschlager. Man wird zudem einige Bandnamen und Songtitel aus unserer Welt wiedererkennen.
Ein Held auf seiner Queste
Am Ziel angelangt, wird Iggy überrascht feststellen, dass Blubb 1) in einer reichlich spießigen Gegend wohnt und 2) entführt worden ist: Das Abenteuer beginnt also erst. Und als wären die folgenden Ereignisse nicht schon stressig genug, ist da auch noch die bezaubernde – und ebenfalls rockende – Wolfmorfette Lila, die Iggy so gerne beeindrucken würde. Leider schafft er es aber, jede Begegnung mit ihr hoffnungslos zu vergurken.
Dass "Rocking the Forest" in Setting wie Tonfall schrullig bis albern gehalten ist, soll freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es hier mit einer waschechten Fantasy-Queste zu tun haben. Und mit einem Helden im Streit zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis ... oder prosaischer ausgedrückt: zwischen denen, die ihn und den Forest Doom als Ganzes auf ein neues musikalisches Level bringen wollen, und denen, die Iggys Karriere samt seinem geliebten Musikstil zerstören möchten. Auch die Klimax des Romans braucht sich hinter der handelsüblichen epischen Fantasy-Schlacht nicht zu verstecken: Beim Rocking the Forest Band Contest ist das Publikum nämlich berüchtigt dafür, außer Rand und Band zu geraten – die Schlusskapitel lesen sich wie eine apokalyptische Variante des San-Remo-Festivals.
Witz mit Methode
Der ewige Goldstandard in Sachen Funny Fantasy wird natürlich Terry Pratchett bleiben. Den müsste man gar nicht heranziehen, wenn "Rocking the Forest" nicht ein paar Parallelen aufweisen würde. Allen voran die Grundidee, ein Phänomen unserer Gegenwart auf ein Fantasy-Setting zu übertragen – denken wir etwa an die Scheibenwelt-Romane "Voll im Bilde" (Kino) oder "Rollende Steine" (Rock). Zimmermanns Roman beginnt auch mit einer Einzoom-Passage wie einst "Total verhext" mit dessen stimmungsvoller Annäherung an einen Hexensabbat ... auch wenn deren Auflösung mit "Was soll das heißen, wir haben alle Kartoffelsalat mitgebracht?" in Sachen romantische Ironie nicht zu überbieten ist.
Zum Stichwort Pratchett denkt man unwillkürlich auch an Fußnoten. Die setzt Zimmermann zwar nicht, dafür gibt es vergleichbare Texteinschübe, in denen der Autor die Leser direkt anspricht und ihnen auch schon mal fröhlich erklärt, dass er sie gerade verarscht hat: Vergesst den letzten Absatz, in Wirklichkeit geht's nämlich so weiter. Mir persönlich sind diese Hüpfer auf die Meta-Ebene im Tonfall leider zu anbiedernd, aber das ist wohl Geschmackssache.
Apropos Geschmack: Da ergibt sich ungeplantermaßen doch noch eine Parallele zu den "Bannsänger"-Romanen: Über meine Foster-Taschenbücher aus dem Antiquariat habe ich nämlich eine reichlich bizarre Form von Reklame kennengelernt, die in den 80ern ausprobiert wurde: Mitten im Buch kamen da optisch abgesetzte Stellen, in denen auf die Romanhandlung eingegangen wurde, um dann zum Twist zu führen, dass Protagonist XY vom Erlebten jetzt so erschöpft ist, dass er sich sicher gerne mit einer 5-Minuten-Terrine von Maggi stärken würde. Glücklicherweise hat sich diese Werbeform nicht dauerhaft etabliert.
Der Wald als ökonomische Nische
"Rocking the Forest" ist ein ziemlich einzigartiger Roman auf dem gegenwärtigen Markt. Ob der Müützelwald, wie vom Autor kurz angedeutet, genug Stoff für weitere Bände abgibt, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall könnte Zimmermann aber im aktuell ziemlich spärlich besetzten Segment der Funny Fantasy seine Nische finden.

Patrick Schön (Hrsg.): "Unfassbar! Fantastische Krimis"
Broschiert, 121 Seiten, € 8,90, p.machinery 2017
In die Ära der Kurzgeschichten von Roald Dahl oder Robert Bloch führt uns diese kleine Anthologie zurück – also in eine Zeit, in der die Genregrenzen zwischen Krimi, Grusel und dezent eingebrachter Phantastik noch sehr offen waren. Zwölf kurze Bösenachtgeschichten sind es, die uns Herausgeber Patrick Schön hier als giftig-süße Betthupferl serviert; ein paar davon etwas unausgegoren, andere wiederum sehr vergnüglich zu lesen.
Das Böse ist immer und überall
Nur zwei der Beiträge stammen von Männern, und fast scheint sich zu Beginn des Bands ein Schwerpunkt "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" abzuzeichnen. In Brigitte Tholens "Es ist nicht alles Gold" flüstert ein "Engel" einer frustrierten Ehefrau den Wunsch zu bösen Taten ein. Und Gabriele Behrend lässt in "Macchiato" eine Callcenter-Mitarbeiterin ausflippen. Sie begeht einen Mord und wähnt sich sicher – würde nicht ausgerechnet das Einzige in ihrem Leben, das ihr Freude bereitet hat, zum Edgar-Allen-Poe-artigen Omen mutieren.
Könnte sich das Böse in diesen beiden Geschichten noch rein im Kopf der Hauptfiguren abgespielt haben, so zeigt es sich in "Ungewolltes Erbe" von Ingeborg Boisen auf ganz andere Art: Ein Ehepaar hat einen Schrank geerbt, in dessen Einbauspiegel Bilder künftiger Gewaltverbrechen aufflimmern wie auf einem Fernseher. Was aber soll man mit Informationen anstellen, die wichtig wären, deren Herkunft man aber niemandem erklären kann, ohne für verrückt gehalten zu werden? Welcome to the Twilight Zone!
Der letzte Schliff
Zwei Geschichten beziehen ihre Spannung daraus, dass sie uns so lange wie möglich im Unklaren lassen. Bei Herausgeber Patrick Schön alias Jon Padriks ist es die Frage, wie sich die zwei scheinbar voneinander unabhängigen Plot-Linien von "Dexter" (beide drehen sich um einen Frauenmörder) verbinden werden. Der Schluss hätte allerdings ein bisschen besser ausgearbeitet werden können. Das gilt – wenn auch auf eine andere Weise – ebenso für "Tochter des Apophis" von Anke Höhl-Kayser, in dem eine Liebesgeschichte auf gewalttätige Weise den Bach runtergeht. Da könnten wir so schön bis zum Ende rätseln, wer oder was die Ich-Erzählerin ist, würde die Autorin sich nicht selbst sabotieren. Entweder ändert man den Titel oder streicht den letzten Satz – beides zusammen ist jedenfalls übererklärt.
Die Schweizer Krimiautorin Ina Haller ist vielleicht der bekannteste Name in dieser Anthologie. Von ihr gibt es bereits eine ganze Reihe Romane – Kurzgeschichten freilich sind ein anderes Pflaster, und in der Konstruktion von "Die Spende" knirscht es etwas. Kurioses Detail: Haller kommt zwar aus der Krimibranche, setzt aber auf eines der gewagteren Phantastik-Elemente hier: "Die Spende" ist in einer Welt angesiedelt, in der Gartenzwerge lebendig geworden sind. Zwingend notwendig erscheint die Idee für die Story freilich nicht – vielleicht handelt es sich ja um eine extra für die Anthologie bearbeitete Version, und in der Originalfassung war's ein Papagei. Oder so.
Zimtsterne surprise
Keinerlei Probleme mit dem Kurzgeschichtenformat hat offensichtlich Regina Schleheck, ebenfalls aus der Krimi-Szene kommend. Ihr "Mann oh Manna" ist mein klares Highlight in diesem Band: eine dank Erzähltempo und vollmundiger Wortwahl herrlich zu lesende Posse über die ungeahnten Konsequenzen der Weihnachtskekse, die Oma Pachulke mit göttlicher Beihilfe – wirklich! – gebacken hat. Eine Perle.
Schleheck ist noch mit zwei weiteren Geschichten vertreten: "Warte, warte nur ein Werthelchen" bringt ein Liebespaar mit verhängnisvollen familiären Hintergründen zusammen ... und auseinander. Und in "Kleine weiße Frau" erzählt ein Mädchen vom mysteriösen Verschwinden seiner Schwester. Beide zählen zu den besseren Geschichten in "Unfassbar!", aber Oma Pachulkes ungeplante Verstrickungen in die Zeitgeschichte bleiben eine Klasse für sich. Schreibt die Geschichtsbücher um und druckt Oma-Pachulke-T-Shirts!

Linda Nagata: "The Last Good Man"
Broschiert, 464 Seiten, Mythic Island Press 2017, Sprache: Englisch
Technology changes. War ist eternal. Was als Motto über so manchem Werk von US-Autorin Linda Nagata stehen könnte (wir erinnern uns an ihre großartige "The Red"-Trilogie), erhält in ihrem jüngsten Roman "The Last Good Man" eine höchstpersönliche Note. Erneut handelt es sich um knallharte Military SF aus der nahen Zukunft – noch näher sogar als seinerzeit in "The Red".
Ende einer langen soldatischen Tradition
Hauptfigur des Romans ist True Brighton, eine 49-jährige Veteranin der US-Armee, die den Dienst quittiert hat, weil Drohnen und Künstliche Intelligenzen immer mehr Soldaten den Job wegnehmen. Trues Verhältnis zur Technologie ist daher ambivalent. Als jemand, der aus einer Army-Familie stammt, die ihre Wurzeln im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg hat, sieht sie eine ehrwürdige Tradition sterben. Trotzdem will sie sich an die Umbruchszeit anpassen. Im Roman findet sie langsam sogar Gefallen an ihrer origami army: faltbaren Drohnen und Kleinrobotern aus dem 3D-Drucker.
Denn das Kämpfen an sich hat True nicht aufgegeben. In einer Zeit, in der immer mehr Aufgaben des Militärs von privaten Sicherheitsunternehmen übernommen werden (inklusive regionaler Kriegsführung), hat sie sich einer solchen Firma angeschlossen. Requisite Operations Incorporated wird von ihrem alten Kameraden Lincoln Han geleitet, dessen Körper so viele künstliche Ersatzteile enthält, dass er in älterer Science Fiction wohl als Cyborg bezeichnet worden wäre. Sein Herz aber schlägt noch am rechten Fleck. In bemerkenswert unzynischer Weise verfolgen Lincoln und True mit ihrem Unternehmen eine Politik der "right action": Sie führen ausschließlich moralisch rechtfertigbare Missionen durch (dies freilich mit aller gebotenen Härte).
Der Plot
Das ganze erste Drittel des Romans schildert einen solchen Einsatz – die Rettung eines Entführungsopfers aus der längst in Anarchie versunkenen "Tigris-Euphrat-Zone" (TEZ) – im Detail. Vom Feeling her erinnert das eher an "Black Hawk Down" oder die Serie "The Long Road Home" als an klassische SF – nicht zuletzt deshalb, weil wir uns technologisch wie politisch in einer sehr nahen Zukunft befinden. Und wie genau kennen wir schon den aktuellen Stand der Militärtechnik? Nach Science Fiction beginnt sich das Ganze erst so richtig anzufühlen, wenn wir die Protagonisten anschließend nach Hause begleiten. Wenn eine Überwachungsdrohne in Form eines Rehs durch ein Wohngebiet stakst, löst das schon einen stärkeren Fremdheitseffekt aus.
Die Mission war freilich nur der Auftakt für die eigentliche Handlung. In der TEZ kam Trues Einheit erstmals der geheimnisvolle Warlord Jon Helm in die Quere – und das wird für True zu einem erschütternden Erlebnis. Helm trägt nämlich ein Tattoo mit dem Namen ihres gefallenen Sohns, samt Zusatz "The Last Good Man". True hat keine Ahnung, wie sie das einschätzen soll. Und je tiefer sie dem Rätsel auf den Grund geht, desto mehr weitere Fragen tun sich auf: Hat Helm Verbindungen zum State Department? War ihr Sohn in Kriegsverbrechen verwickelt? Und haben ihr Ehemann Alex und Partner Lincoln davon gewusst? True ist wild entschlossen, auf diese Fragen Antwort zu finden – selbst wenn das bedeutet, dass sie sich von den Menschen, die ihr am nächsten stehen, abwenden muss.
Der Krieg in all seinen Aspekten
Linda Nagata ist eine erfreulich vollständige SF-Autorin. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass für sie die Menschen im Mittelpunkt stehen. Trotzdem drückt sie sich – anders als einige derzeit hochgejubelte Berufskolleginnen – nicht um die technologischen Aspekte herum. Im Gegenteil, sie geht so ausführlich auf die (Militär-)Technologie ein, dass man sie glatt für eine Eisenfresserin halten könnte. Auf die entsprechende Terminologie übrigens auch: Ob MRE (meal ready to eat), IED (improvised explosive device) oder QRF (quick reaction force), E-Book-Leser sind hier etwas im Vorteil, weil sie die unzähligen im Roman verwendeten Drei-Buchstaben-Abkürzungen sofort nachschlagen können.
Zusätzliche Erdung erhält die Geschichte noch dadurch, dass Nagata auch auf die wirtschaftlichen Zwänge und die rechtlichen Rahmenbedingungen eingeht, unter denen Soldaten und Söldner in dieser Welt agieren (etwa was die Abstimmung zwischen staatlichen Armeen und privaten Sicherheitsunternehmen betrifft). Es ist Military SF in höchster Vollendung, eingebettet in eine Familiengeschichte um Rache, Trauer und Reue – angesiedelt in einer Zukunft, die nur wenige Stunden entfernt scheint.
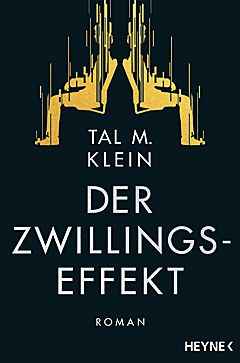
Tal M. Klein: "Der Zwillingseffekt"
Klappenbroschur, 414 Seiten, € 15,50, Heyne 2018 (Original: "The Punch Escrow", 2017)
Die gute alte Teleportation! Bei dem Thema denkt man unwillkürlich an Larry Niven und Harry Harrison, an "Star Trek" und "Perry Rhodan" ... und steckt damit mitten in den 1960er Jahren, kein Wunder, wenn einem ganz nostalgisch zumute wird. Nostalgie war übrigens auch ein klares Kalkül des Autors von "Der Zwillingseffekt", dem in Israel geborenen US-Amerikaner Tal M. Klein, der mit diesem Roman ein überaus erfolgreiches Debüt hinlegte. Stellen wir uns also auf Verweise auf die Popkultur des 20. Jahrhunderts ein, mögen sie vom Handlungshintergrund her manchmal auch schwer zu begründen sein.
Wir schreiben das Jahr 2147 und die Welt ist ein recht komfortabler Platz geworden. Es wimmelt nur so von Errungenschaften aus Quanten-, Nano- und Gentechnologie, ohne dass sich diese Zukunftswelt grundlegend anders anfühlen würde als eine Mitte des 20. Jahrhunderts ersonnene. Vielleicht mit einer Ausnahme: Nach dem Grauen des Letzten Krieges sind Staatsregierungen weitgehend abgemeldet, die Macht liegt ganz in den Händen von Konzernen. Einer der größten ist International Transport (IT), der das Monopol auf Teleportation innehat: das weltweit beliebteste Verkehrsmittel dieser Zeit.
Figuren und Plot
Hauptfigur und Ich-Erzähler des Romans ist der New Yorker Joel Byram. Ein Durchschnittstyp, der gelegentlich als Salter arbeitet, soll heißen: Er bringt Künstlichen Intelligenzen bei, um die Ecke zu denken, damit sie sich weiterentwickeln können. De facto bedeutet das im Wesentlichen, dass er ihnen Wortspiele und Witze erzählt. Seine Frau Sylvia arbeitet in der Entwicklungsabteilung von IT, wo sie deutlich mehr verdient. She brings home the bacon, wie das auf Englisch so schön heißt. Zum Ausgleich will Joel mit ihr am 10. Hochzeitstag nach Costa Rica teleportieren.
Just in dem Moment, als er den Sprung vollziehen soll, wird das örtliche Teleportationszentrum jedoch durch ein Selbstmordattentat in die Luft gesprengt. Für einen entscheidenden Moment befindet sich Joel also in der Situation von Schrödingers Katze – und anschließend gibt es ihn doppelt (die Erlebnisse seines "Alter Egos" Joel2 werden dann übrigens in 3. Person alternierend mit dem Haupthandlungsfaden erzählt).
Unversehens rückt der unscheinbare Joel damit in den Fokus ganz unterschiedlicher Interessen. Eine religiöse Splittergruppe ist bald ebenso hinter ihm her wie ein ausländischer Geheimdienst und natürlich International Transport selbst: Die haben ihm das Angebot gemacht, sich freiwillig selbst zu entleiben, da es ihn ja nicht zweimal geben darf. Wenig überraschend beschloss Joel, lieber auszubüxen ... und nun überlegt er auf der Flucht vor seinen diversen Verfolgern fieberhaft, wie er die "Dreiecksbeziehung" mit Sylvia und Joel2 bereinigen soll.
Kennt man alles irgendwie schon
Das ethische Dilemma, vor dem Kleins Hauptfigur hier steht, ist identisch mit dem der Teleportationsreisenden in James Patrick Kellys Erzählung "Think Like a Dinosaur" aus dem Jahr 1995. Und wenn "Der Zwillingseffekt" verfilmt wird (Projekt soll bereits angelaufen sein), werden Drehbuchautoren und Regisseur alle Hände voll zu tun haben, dass das Ganze nicht wie ein Plagiat des Schwarzenegger-Vehikels "The 6th Day" rüberkommt. Ok, hier Klone, dort Teleport-Zwillinge – aber im Grunde der gleiche Plot.
Schon früh wird angedeutet, dass die Teleportation vielleicht nicht so funktioniert, wie IT das der Welt weismachen möchte. Wenn die Konzernbosse Joel die Wahrheit eröffnen, dürfte aber kein SF-Fan wirklich überrascht sein. Immerhin: Klein hat sich das nicht als finalen "Schock" aufgespart, sondern verrät es uns einigermaßen früh. Die einzige wirkliche Überraschung ist der Schluss des Romans – die unerwartete Wendung könnte aber auch einfach nur ein Sequel vorbereiten. (Kurz Kleins Blog besucht: Yep, es sollen zwei weitere Romane folgen.)
Unterhaltsam, aber ...
Von Anfang an schlägt Klein einen munteren Ton an. So beispielsweise wird gleich auf der ersten Seite ein Sonnensturm beschrieben: Man kann es sich wie einen platzenden Pickel auf der Stirn der Sonne vorstellen, nur dass der Pickel etwa die Größe der Venus hatte und der austretende Eiter eine elektromagnetische Gülleflut war. Gut, das ist ein ziemlich krasser visueller Vergleich, aber jetzt ist er in Ihrem Kopf drin und aus meinem raus.
In der zweiten Romanhälfte, wenn die Action am Rollen ist, wird Klein der Witz langsam ausgehen – ebenso wie (glücklicherweise!) ein zweites Stilmittel, das in den vorderen Romanteilen im Übermaß eingesetzt wird: Fußnoten zur Erklärung technischer Hintergründe. Die sind sehr eng gedruckt und sehr lang – in Extremfällen länger als der Text darüber, was ich schon bei Sachbüchern unmöglich finde und hier immer wieder den Lesefluss stört. Außer man blendet sie einfach aus. (Eine endet selbstironischerweise mit: Sind Sie immer noch wach, nachdem Sie das gelesen haben? Dann gibt's dafür einen Orden.) Wozu Klein die überhaupt verwendet, ist unklar, schließlich setzt er auch im Fließtext jede Menge Infodumps und Exkurse – zum Beispiel einen ziemlich originellen über die Verbindung von Quantenphysik und Big Macs.
"Der Zwillingseffekt" ist unterhaltsam, aber auch eines von diesen Büchern, bei denen man sich ständig angezwinkert und scherzhaft in die Seite geknufft fühlt. Dazu gehört auch das Kokettieren mit der Nostalgie: Joel und Sylvia unterhalten sich gerne wie die Nerds der "Big Bang Theory" über "Star Trek" und Co (zur Handlungszeit alles fast 200 Jahre alt), und Joel steht aus irgendwelchen Gründen auf die vom Rest der Welt längst vergessene Musik der New Wave. Oder na schön, aus einem Grund: Es war die Musik von Tal M. Kleins Jugend. Das soll wohlig-wehmütige Erinnerungen der Leser wecken, wirkt vor dem Hintergrund der Romanwelt aber aufgesetzt. Und auch das alles kennen wir bereits von einem anderen supersmart agierenden Autor – nämlich von Ernest Cline und dessen "Ready Player One".
Letzte Worte
Ich kann "Der Zwillingseffekt" empfehlen, weil ich weiß, dass er vielen Lesern großen Spaß machen wird – auch wenn ich selbst nicht dazugehöre. Fluch und Segen des Romans hat einer der Filmbosse von Warner perfekt auf den Punkt gebracht: "The next Ready Player One".

Nadine Boos: "Tanz um den Vulkan"
Broschiert, 264 Seiten, € 13,40, Wurdack 2018
Mit "Der Schwarm der Trilobiten" hatte Nadine Boos einen durchweg erfreulichen Beitrag zur deutschen SF-Serie "D9E" geschrieben. Seinerzeit habe ich die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass wir bald in ihren Teil dieses Shared Universe zurückkehren würden, aber vier Jahre sind's jetzt doch geworden – da schadet es sicher nicht, wenn man kurz zurückblickt.
Vergiss nie die Hondh
"D9E" steht für "Die neunte Expansion" und bezieht sich auf ein interstellares Imperium, das sich äußerst geheimnisvoll gibt und alle heiligen Zeiten sprunghaft seine Grenzen erweitert. Aktuell läuft die neunte Expansionswelle an, und die galaktische Nachbarschaft versucht verzweifelt, vom Eroberungszug der technologisch überlegenen Hondh nicht überrollt zu werden. 17 "D9E"-Bände sind bereits erschienen, dazu ist im April nun auch die Ableger-Serie "Der Loganische Krieg" angelaufen. Das galaktische Panorama wird von den einzelnen Autoren des Shared Universe aus höchst unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und auf regionale Geschehnisse und unabhängig voneinander agierende Protagonisten heruntergebrochen.
Boos wählte als Schauplatz den Planeten Andesit in einem eher abgelegenen Sternsystem, das von den galaktischen Vorgängen bislang weitgehend unberührt geblieben ist – die jüngste Hondh-Expansion wird aber auch hier mit Sorge registriert. Trixi Darjeeling, die angehende Matriarchin des Planeten, wollte von ihrer politischen Bestimmung jedoch nichts wissen und büxte auf ein Weltraumabenteuer aus. Das allerdings ein schnelles Ende fand, als sie einen Unfall mit einem anderen Raumschiff baute – an Bord Kalmi, die Kundschafterin einer Spezies von Wasserbewohnern, die ihrerseits vor den Hondh flüchten und hoffen, auf Andesit eine neue Heimat zu finden. "Tanz um den Vulkan" schließt nun nahtlos an den seinerzeit geschilderten Erstkontakt an.
So geht es weiter
Im neuen Band reißt es Trixi weiterhin zwischen ihren Amtspflichten und der Lust auf Weltraummissionen herum, die ihr einfach im Blut steckt. Mehrfach gibt sie diesem Drang auch nach und bricht auf lange Reisen auf – dass sich das mit ihrer Aufgabe als Leiterin des Planeten unter einen Hut bringen lassen soll, ist zugleich der unglaubwürdigste Aspekt des Romans. Außer man bewertet die Figur komplett um und sieht sie statt der sympathischen Rebellin von einst nun ganz einfach als verantwortungslose Person.
Trixis Job wird inzwischen weitgehend von ihrem Mann Karolus erledigt, der damit auch als Figur stärker in den Fokus rückt. Durch seine Umtriebigkeit reizt er die Grenzen der Rolle aus, die ihm in der matriarchalischen Gesellschaft von Andesit zugestanden werden. Immer mehr beginnt er sich auch für die Technologie von Kalmis Volk, den Asmini, zu interessieren, das in einem geistigen Verbund lebt und es geschafft hat, nahezu die gesamte Flora und Fauna seines Ursprungsplaneten zu einer Art Supercomputer zusammenzuschließen. Nun, da die Asmini auf Andesit Asyl gefunden haben, versuchen sie hier das Gleiche. Anfangs leidet Kalmi noch unter der Stille dieser nicht-vernetzten Welt, aber so langsam knüpft sie Kontakte zu den tierischen Bewohnern des jungfräulichen Ozeans (die sich übrigens als eine Art Best-of-Meeresleben der Erdgeschichte präsentieren, vom Mosasaurus bis zum Wal).
Die neben Karolus zweite Figur, die alles zusammenhält, ist Berenike, Trixis Mutter und ehemalige Sicherheitschefin. Nach einem Attentat für tot gehalten, taucht sie – buchstäblich – ab und baut in der Anonymität einen informellen zweiten Sicherheitsdienst auf, der nach möglicher Infiltration durch die Hondh und anderen Störfaktoren fahndet.
Schlaglichter
Boos bietet die klassische Mischung aus Planetenabenteuer und Social SF, Schwerpunkt interkulturelle Konflikte. Schon vor der Ankunft der Asmini war Andesit eine zweigeteilte Welt, besiedelt sowohl von Menschen als auch den amphibisch lebenden Ureinwohnern – recht ähnlich eigentlich den Verhältnissen auf Naboo in "Star Wars". Dass sich die Menschen der Kultur der Ur-Andesiter gegenüber ziemlich ignorant verhalten, ist nur eine von vielen Quellen der Unzufriedenheit, die Berenike und Karolus in den Griff bekommen müssen. Die neueingewanderten Asmini bringen nicht nur einen zusätzlichen Schuss Exotik in die Mischung ein, sie machen die Situation natürlich noch einmal komplexer. Und das alles, während man eigentlich sämtliche Anstrengungen darauf konzentrieren muss, sich gegen einen äußeren Feind zu wappnen.
"Tanz um den Vulkan" ist erneut ein gelungener Beitrag zum Shared Universe. Worauf man sich vor der Lektüre allerdings einstellen sollte, ist Boos' Erzählweise. Sie blendet gerne mal weg und belässt potenziell spannende Geschehnisse im Off (etwa Trixis ersten, immerhin einjährigen Trip in die Galaxis; möglicherweise wird der ja in einer anderen "D9E"-Erzählung geschildert). Anders als etwa ein Andreas Brandhorst, der seine Geschichten kontinuierlich auserzählt, richtet Boos lieber Schlaglichter auf einzelne Punkte innerhalb eines mehrere Jahre umfassenden Zeitraums, um anschließend weiterzuspringen. Damit entspricht der Roman in seinem inneren Aufbau zugleich seiner äußeren Einbettung in den Kontext der Serie. Was freilich auch bedeutet, dass Leser der Serie im Vorteil gegenüber denen sind, die "Tanz um den Vulkan" gerne als abgeschlossenen Einzelroman sähen: Den Gefallen wird er ihnen mangels eines wirklichen Schlusses nicht tun – aber vielleicht dauert's bis zur Fortsetzung wenigstens nicht wieder vier Jahre.
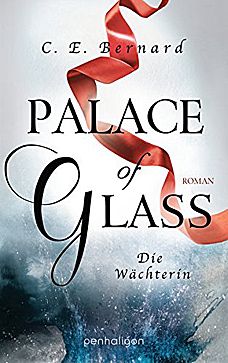
C. E. Bernard: "Palace of Glass. Die Wächterin"
Klappenbroschur, 416 Seiten, € 12,40, Penhaligon 2018
Auf eine etwas kuriose Veröffentlichungsgeschichte blickt dieser Roman – Auftakt einer Trilogie – zurück: "C. E. Bernard" ist eigentlich die Deutsche Christine Lehnen, die ihre Bücher aber auf Englisch geschrieben hat. So weit noch nichts Besonderes, denken wir etwa an Hannu Rajaniemi oder Karin Tidbeck. Allerdings ist "Palace of Glass" dann doch nicht auf Englisch erschienen, sondern wurde an den deutschsprachigen Verlag Penhaligon verkauft, wofür es natürlich einer Übersetzung bedurfte. Und die hat Lehnen seltsamerweise nicht selbst erledigt, stattdessen wurde eine Übersetzerin engagiert. Sowas hatte ich in zehn Jahren Rundschau auch noch nie.
Eine Welt wie keine andere
Als Handlungszeit wird explizit das Jahr 2054 genannt, woraus aber nicht notwendigerweise der Schluss zu ziehen ist, dass es sich bei "Palace of Glass" um Science Fiction handelt. Rechnet man Feeling, Handlungsabläufe und Ausstattung zusammen, kommt man auf eine kaum einordenbare Mischung aus Contemporary Fantasy, Alternativweltgeschichte, Steampunk und SF, garniert mit einem Schuss Romantasy. Handys und Luftkissenbahnen finden sich hier neben frühneuzeitlichen Bekleidungsregeln – und das alles vor dem Hintergrund eines Europas, das wieder aus lauter Monarchien besteht. Da wird schon ein gehöriges Maß an Konstruktion auf dem Reißbrett erkennbar, aber es ist auf jeden Fall eine eigenständige Welt.
Das für die Erzählung zentrale Element sind die sogenannten Magdalenen: Menschen (primär Frauen), die durch Berührung Einfluss auf die Gedanken anderer nehmen können. Sie werden von Lehnen als die Erben der Hexen von einst bezeichnet und sind klar positiv besetzt. Dennoch gelten sie als Staatsfeinde. Vor 26 Jahren wurde ihre Subkultur entdeckt, was zu umfassenden gesellschaftlichen Veränderungen geführt hat (eigentlich zu umfassenden für diesen kurzen Zeitraum). In Ländern wie dem Hauptschauplatz Großbritannien sind Berührungen streng verboten, Handschuhe und den Hals bedeckende Marienkrägen sind obligatorisch: "Der Weg zur Hölle führt über die Haut."
Die Neue
Die Hauptfigur ist eine solche Magdalena: Eigentlich eine Schneiderin, nimmt Rea Emris auch regelmäßig an illegalen Boxkämpfen teil, um sich abzureagieren (der Roman beginnt damit, wie sie einen solchen Kampf aufgrund ihrer Gedankenleser-Gabe auf unfaire Weise gewinnt). Dabei fällt sie eines Tages dem Königshof auf und wird für eine Doppelrolle engagiert: Sie soll die neue Leibwächterin des Kronprinzen werden, auf den bereits einige Attentate verübt wurden. Nach außen hin muss sie zur Tarnung die Kate Middleton geben – dass es zwischen ihr und dem Prinzen tatsächlich zu knistern beginnt, verkompliziert die Lage allerdings.
Der Plot ist im Grunde fantasytypisch: Rea muss sich in ihrer neuen Rolle bei Hofe einleben, ein nicht gerade einfaches Umfeld voller undurchsichtiger Akteure. Sei es der Weißer Ritter genannte Sicherheitschef des Palasts, die sich jeder Einschätzung entziehende Duchesse (Hofdame und Wirtschaftstycoon gleichermaßen) oder der Kronprinz selbst: Jeder davon könnte ebenso gut Gegner wie Freund oder sogar mehr sein. Und vor allen muss Rea das Geheimnis, eine Magdalena zu sein, hüten, ansonsten droht ihr die Hinrichtung. Kurze, schlicht gehaltene Hauptsätze und ein leicht betäubt wirkender Erzählton im Präsens geben Reas stetes Dahinstolpern am Rande der Überforderung wieder.
Die dystopische Gesellschaft der Romanwelt hat durchaus ihre Logik: Aus der Magdalenen-Hysterie ist eine allgemeine Leibfeindlichkeit entsprungen, die sich ihrerseits sowohl zu Kunst- als auch zu tendenzieller Frauenfeindlichkeit ausgeweitet hat. Real existierende Diktaturen aus unserer Welt haben's vorgemacht. Wenn Rea vom Hofstaat wie ein Stück Fleisch begutachtet und später wegen eines Verstoßes gegen die Sitten ausgepeitscht wird, klingt für kurze Momente Margaret Atwoods "Report der Magd" an (wenn auch in der hochgradig stilisierten Designer-Variante à la "V for Vendetta"). Das sind die stärksten Passagen von "Palace of Glass".
Überdosis G'fühl
Was den Roman ein Stück weit runterzieht, ist das Übermaß an Befindlichkeiten. Ich-Erzählerin Rea hat eh schon mit einem inneren Dauerkonflikt zu ringen: Wie jede Magdalena giert sie nach Hautkontakt. Und obwohl das für sie ein genauso grundlegendes Bedürfnis wie Essen und Trinken ist, ekelt sie sich deshalb vor sich selbst. Die "Finsternis" in ihrem Inneren manifestiert sich – nur für sie selbst sichtbar – als Tier.
Aber damit ist es bei weitem nicht getan. Vor allem in der ersten Romanhälfte kippt Rea immer wieder in Erinnerungen an ihre Kindheit und das tragische Schicksal ihrer Eltern zurück. Und in der zweiten Hälfte kommen auch noch Herzensangelegenheiten dazu. (Generell versandelt "Palace of Glass" dann etwas in Romantasy-Mustern: der im falschen Moment beobachtete Kuss, die Trennung nach einem Missverständnis usw.) Innerhalb von zwei Seiten kann Rea zwischen Freude, Scham, Erregung, Stolz und Unsicherheit pendeln: Das ist etwas gar viel, um die Figur auf Dauer ernst zu nehmen. Wünschen wir Rea, dass sie sich beizeiten ein bissel zusammenreißt, immerhin hat sie noch zwei weitere Bände voller neuer Abenteuer durchzustehen. Beide werden noch heuer erscheinen, der nächste bereits Ende Mai.
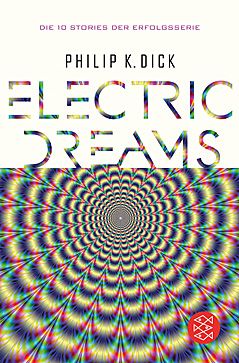
Philip K. Dick: "Electric Dreams"
Broschiert, 239 Seiten, € 12,40, Fischer 2018 (Original: "Philip K. Dick's Electric Dreams", 2017)
Wer hat die britische Anthologie-Serie "Electric Dreams" – bei uns nur über Amazon Video erhältlich – schon gesehen? Dieser Band umfasst die zehn Kurzgeschichten Philip K. Dicks, auf denen die einzelnen Episoden basieren. Sie stammen aus den Jahren 1953 bis '55. Kenner der Serie, eines zeitgemäßen Hochglanzprodukts à la "Black Mirror", müssen sich also darauf einstellen, hier in einen etwas anderen Kosmos einzutauchen – nämlich in eine Wirtschaftswunderwelt Hut tragender Familienväter aus der Vorstadt ("Es gibt Wildfasan vom Uranus, dein Lieblingsessen."). Den Effekt kennen wir ja vom Vergleich zwischen dem Film "Blade Runner" und der Romanvorlage "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?".
Die TV-Serie hat aber nicht nur die Technologie modernisiert und das Personal über das Segment männlicher WASPs hinaus erweitert. Es handelt sich generell um sehr freie Adaptionen der von Dick entwickelten Grundideen. Der deutschsprachige Band trägt zwar den Vermerk "Originalausgabe", vermutlich aufgrund bereits bestehender Übersetzungen. "Electric Dreams" gibt's allerdings – mit dem gleichen Cover – auch auf Englisch. Und in der Version wären auch Anmerkungen der Serienmacher zu den einzelnen Episoden und deren Zusammenhang mit Dicks Vorlagen enthalten gewesen. Wer die Serie nicht kennt, für den spielt das alles freilich keine Rolle; der darf sich einfach über eine Sammlung zwar alter, aber ziemlich guter Kurzgeschichten Philip K. Dicks freuen.
Modernisierte "Twilight Zone"
In "Ausstellungsstück" flüchtet sich ein Historiker des 22. Jahrhunderts in das von ihm betreute Museumsexponat, die Rekonstruktion einer Suburb aus der Mitte des 20. Jahrhunderts: eine quasi-virtuelle Welt, die ihm immer realer erscheint – zumindest bis zur gelungenen Schlusspointe. Das für Dick typische Verschwimmen der Realität eignet sich hervorragend für Serien im "Black Mirror"-Stil und ihren Anspruch, die "Twilight Zone" unserer Generation zu sein. Das gilt auch für die gruselige Geschichte "Der Gehenkte", in der mitten in einem Kleinstadtidyll eine Leiche vom Laternenpfahl baumelt. Doch niemand außer der Hauptfigur scheint dem irgendeine Bedeutung beizumessen. Und es gilt für "Der Pendler", in dem ein Mann am Fahrkartenschalter ein Ticket in eine nirgendwo verzeichnete Stadt kaufen will. Weil er behauptet, dort jeden Tag hinzufahren, geht ein Bahnbeamter der Sache nach und landet zwischen zwei Welten.
Reisen in den Weltraum spielen in diesen SF-Geschichten übrigens nur eine untergeordnete Rolle. In "Der unmögliche Planet" will eine steinreiche und -alte Dame eine Passage zur Erde buchen, die jedoch in der ganzen Galaxis nur noch für einen Mythos gehalten wird. Und in der Konsumzwang-Satire "Eine todsichere Masche" hängt Protagonist Ed erst im täglichen interplanetaren Pendler-Stau fest, um letzten Endes in ein anderes Sternsystem zu fliehen. Fluchtgrund ist eine Hausbesetzung der besonderen Art: Ein neuer Allzweckroboter führt Eds Familie seine Nützlichkeit vor und verhält sich dabei so rabiat wie ein Mafia-Schläger.
Wer bist du?
Typisch für Philip K. Dick ist es auch, vermeintlich gesicherte Identitäten in Frage zu stellen. Zweimal geschieht dies hier in Form des guten alten Körperfresser-Motivs. In "Das Vater-Ding" entdeckt der junge Charles, dass sein Vater durch eine Kopie ersetzt wurde. Der Übernahme-Vorgang ähnelt übrigens verblüffend genau dem aus Jack Finneys Klassiker "The Body Snatchers". Der ist im selben Jahr wie Dicks Kurzgeschichte erschienen und war offenbar von ihr inspiriert. In "Menschlich ist" kehrt sich der Plot um: Hier kommt ein Mann von einer Weltraumreise verändert zurück – allerdings war er vorher ein gefühlskaltes Arschloch und wirkt jetzt durch und durch liebenswert.
"Der Haubenmacher" zeichnet eine dystopische Gesellschaft mit telepathischer Überwachung, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint. Doch Vorsicht: Wer in den Köpfen anderer herumschnüffelt, kann dabei auch auf fatale Wahrheiten stoßen. Düster auf eine ganz andere Art ist die Welt von "Autofab": Nach einem Nuklearkrieg versorgen ausgedehnte Maschinennetzwerke die restliche Menschheit vollautomatisch – und das gar nicht schlecht. Trotzdem würden einige Menschen gerne wieder die Kontrolle über die Produktion in eigenen Händen halten. Aber ist das wirklich eine gute Idee?
Offene Fragen
Die meisten der Erzählungen hier laufen auf Schlusspointen, auf identifizierbare Feinde und die Unterscheidbarkeit von richtig und falsch hinaus. "Autofab" bleibt ambivalent, und das gilt noch stärker für die beste, weil vielschichtigste Geschichte in "Electric Dreams". "Foster, du bist tot" zeichnet eine Konsumgesellschaft unter Kriegsangst, in der Familienbunker die neuen Verkaufsschlager und Statussymbole sind. Nur Mike Fosters Vater will bei dem florierenden Geschäft nicht mitmachen. Wenn der kleine Mike darob verzweifelt, dann geschieht dies aus ehrlich empfundener Angst vor einem Angriff ebenso sehr wie aus der Sehnsucht, zu all den anderen Kindern dazuzugehören, deren Eltern brav ihre Bunker kaufen. Diese Geschichte braucht keine Pointe, sie lebt ganz von ihrer Stimmung.
Trotz ihres Alters – und kaum etwas veraltet so radikal wie Science Fiction – haben mir die zehn Geschichten hier großes Vergnügen bereitet: eine klare Empfehlung. Und mit diesem Golden Oldie schließt die aktuelle Rundschau, während die nächste schon in den Startlöchern scharrt. Dann wird der Brandhorst aber wirklich mit dabei sein. (Josefson, 5.5.2018)
_____________________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher