Paul Zabel hat kein leichtes Jahr vor sich. Der deutsche Raumfahrtingenieur verbringt 2018 auf dem Ekström-Schelfeis in der Antarktis – mit einer ungewöhnlichen Aufgabe: Er soll mithilfe eines Hightech-Gewächshauses unter den extremen Bedingungen des Südpols Tomaten, Gurken, Erdbeeren, Salate und Kräuter anbauen. Dass das Experiment die Belegschaft der Polarforschungsstation Neumayer III mit frischer Kost versorgt, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Hauptzweck ist aber, Technologien zu testen, die in nicht allzu ferner Zukunft im Weltall eingesetzt werden könnten, um Astronauten auf Raumstationen oder gar Kolonisten auf Mond oder Mars zu ernähren.
Damit der Gemüseanbau im All oder am Südpol gelingen kann, setzt das Projekt Eden-ISS auf ein hochpräzises, computergesteuertes und autarkes System: Anstatt in Erde oder einem anderen Medium zu wachsen, werden die Wurzeln der Pflanzen in der Luft automatisch alle paar Minuten mit einem Wasser-Nährstoff-Gemisch besprüht. All das Wasser, das die Pflanzen wieder abgeben, wird recycelt, um den Verbrauch auf das absolute Minimum zu reduzieren. Auch der geschlossene Luftkreislauf im Gewächshaus wird exakt den Bedürfnissen angepasst: Sporen und Keime werden mittels UV-Strahlung eliminiert, der Kohlenstoffdioxidgehalt wird künstlich erhöht, um das Pflanzenwachstum zu befördern. Die fehlende Sonne wird durch präzise steuerbares LED-Licht ersetzt.

Grünzeug für die Stadt der Zukunft
Während Zabel in seinem futuristisch anmutenden Weltraumgewächshaus antarktisches Gemüse hegt, beschäftigt sich auch Josef Schmidhuber mit der Ernährung der Zukunft. Auch ihn interessieren neueste technologische Innovationen in der Landwirtschaft, sein Fokus liegt dabei aber auf unserem Heimatplaneten. Schmidhuber ist stellvertretender Direktor der Abteilung für Handel und Märkte der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und forscht zu Ernährungssicherheit und Zukunft der Lebensmittelproduktion.
Er sieht in hochtechnologischen Anbausystemen zwar keine Lösung der Welternährungsprobleme, aber einen sehr interessanten Beitrag dazu, wie eine rasant wachsende städtische Bevölkerung ressourcenschonend mit gesunden Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse versorgt werden kann: Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,8 Milliarden Menschen anwachsen wird – und dann rund zwei Drittel aller Menschen in städtischen Gebieten leben werden.

Wer heute einen Blick in die mögliche Zukunft der urbanen Landwirtschaft werfen möchte, muss nur bis in die Niederlande reisen. Dort wird längst in großem Stil auf Anbausysteme gesetzt, die sich wohl am besten unter dem Begriff "smarte Landwirtschaft" subsumieren lassen. Anders wäre auch nicht denkbar, wie dieses winzige, dicht besiedelte Land mit gerade einmal der halben Fläche Österreichs zum weltweit zweitwichtigsten Exporteur landwirtschaftlicher Güter werden konnte – nur die USA schaffen noch mehr. Wir sprechen hier keineswegs nur von den berühmten holländischen Tulpen: Was etwa die Ausfuhr von Tomaten und Gurken angeht, kann nicht einmal Nordamerika dem kleinen EU-Land das Wasser reichen.
Hightech auf dem Bauernhof
Möglich ist das nur durch extrem effiziente Anbaumethoden: Kartoffelbauern, die die Bodenbeschaffenheit ihrer Äcker und das Pflanzenwachstum per Flugdrohne kontrollieren, sind in den Niederlanden keine Seltenheit. Traktoren, die dank exakter GPS-Überwachung kein noch so kleines Fleckchen Land doppelt bewässern, düngen oder mit Pestiziden besprühen, sind landwirtschaftlicher Alltag. Die festen Grundpfeiler der erstaunlichen niederländischen Produktivität sind aber die vielen modernen Hydrokulturglashäuser, in denen zum Teil voll automatisiert und gleichzeitig äußerst ressourcensparend Obst und Gemüse in rauen Mengen produziert werden.
Der Anbau erfolgt hier mittels Hydroponik: Statt in Erde wachsen die Pflanzen in einem anorganischen Substrat und werden in idealer Menge mit einer Nährlösung versorgt. Die Methode erfordert dank der extrem kontrollierten Bedingungen nicht nur weniger Wasser und Dünger, sondern auch deutlich weniger Platz als herkömmliche Landwirtschaft. Außerdem lässt sich der Pestizideinsatz drastisch reduzieren. Diese Systeme können mit der Aufzucht von Speisefischen kombiniert werden, wobei die Ausscheidungen der Fische als Nährstoffe für die Pflanzen dienen – in diesen Fällen spricht man von Aquaponik.
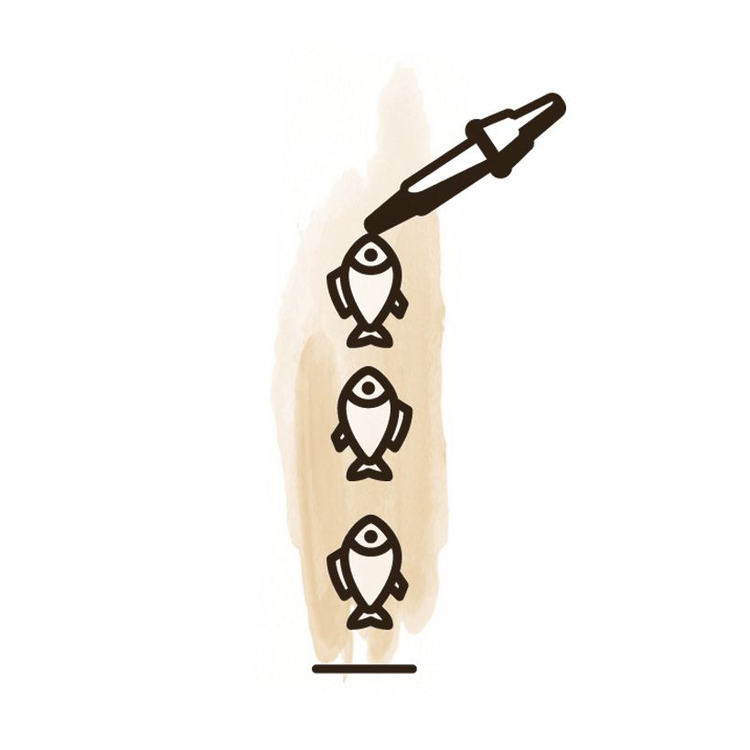
Der Fischverzehr steigt von Jahr zu Jahr – seit den 1980er-Jahren wird der erhöhte Bedarf beinahe ausschließlich aus Aquakultur-Züchtungen befriedigt. Ein Verfahren könnte diese Methode noch weiter optimieren: Aquaponik. Dabei werden die Aquakultur-Haltung von Fischen und die Kultivierung von Nutzpflanzen in Hydrokulturen miteinander kombiniert.
"Die neueste Generation solcher Gewächshäuser ist so unglaublich effizient, dass sie netto betrachtet kaum Energie verbraucht", sagt Schmidhuber. Der gebürtige Bayer hat mit Kollegen kürzlich untersucht, ob sich der smarte Gewächshausanbau auch in extrem trockenen Regionen realisieren ließe, etwa in den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Zu unserer Überraschung hat sich herausgestellt, dass das Ganze in ariden oder semiariden Gebieten nicht nur funktioniert, sondern auch unter gegebenen Umständen wirtschaftlich ist, weil man mit so wenig Wasser auskommt und die Elektrizität kaum etwas kostet.
Man kann Tomaten im Vergleich zu importierter Ware aus Europa um mehr als ein Drittel billiger produzieren, bei Erdbeeren ist die Gewinnspanne noch größer – allerdings bei höherem Produktionsrisiko." Der Anbau in Verbrauchernähe – also in der Stadt – spart auch Transportkosten und Emissionen – ein vielversprechendes Konzept für die Städte von morgen. Schmidhuber: "Das ist sicher ein Beitrag zur Produktion von gesunden Nahrungsmitteln bei geringem Ressourcenverbrauch und niedrigen Treibhausgasemissionen. Es ist natürlich keine Lösung für Kleinbauern in Afrika südlich der Sahara, aber für die rasant wachsenden Städte der Zukunft."
Genetischer Bauplan
Wie aber ließe sich die Landwirtschaft in den ländlichen Regionen Subsahara-Afrikas und Asiens verbessern, wo der Großteil der weltweit mehr als 800 Millionen unter extremer Armut und Mangelernährung leidenden Menschen lebt? Dort kommen zu den oftmals kriegerischen Konflikten auch extreme klimatische Bedingungen hinzu, die den Anbau von Nahrungsmitteln immer schwieriger machen und sich in Zeiten der Erderwärmung weiter verschärfen. Forscher arbeiten weltweit daran, zumindest Teilantworten auf diese Frage zu finden.

Weizen ist neben Reis das wichtigste Getreide für die menschliche Ernährung. Das gigantische Genom des Weizens ist fünfmal so groß wie das des Menschen – und längst Gegenstand der Forschung. Neben der Verbesserung von Erträgen und Resistenzen gegen Schädlinge, Dürre und versalzte Böden wird etwa versucht, Gene im Weizen zu beeinflussen, die an Zöliakie und Glutensensitivität beteiligt sind.
Eine davon ist Kellye Eversole. Die Pflanzengenetikerin ist Vorsitzende des Internationalen Weizengenom-Sequenzierungskonsortiums (IWGSC) und steht mit ihren Kollegen kurz vor der Veröffentlichung der kompletten Genomsequenz des Brotweizens – ein Megaprojekt: Das Erbgut des Weizens ist mit 17 Milliarden Bausteinen etwa fünfmal so groß wie das des Menschen, zudem liegt jedes Chromosom gleich sechsfach vor. Einen Entwurf haben die Forscher schon 2014 in Science vorgelegt und damit erstmals ermöglicht, spezifische Weizengene schnell und zuverlässig zu finden.
Die Möglichkeiten, die die Genkartierung mit sich bringt, sind enorm: Sie lässt die effiziente Zucht neuer Sorten zu, die ertragreicher und resistenter gegen Krankheiten, Dürre oder salzhaltige Böden sind. "Man kann das mit Google Maps vergleichen: Wir können gezielt Gene und die mit ihnen verbundenen Merkmale lokalisieren, vergleichen und verändern", sagt Eversole. Das gilt freilich nicht nur für den Weizen – Forscher entschlüsseln nach und nach den genetischen Bauplan der wichtigsten Nahrungspflanzen.
Gen-Schere im Dauereinsatz
Besonders vielversprechend für deren gezielte Optimierung erscheint die Geneditierungsmethode CRISPR/Cas9. Vereinfacht gesagt können damit schnell und günstig Gene im Erbgut von Lebewesen ausgeschaltet oder modifiziert werden, ohne Fremd-DNA einführen zu müssen. FAO-Experte Schmidhuber sieht darin eine zukunftsweisende Technologie: "Meines Erachtens hat Genome Editing ein riesiges Potenzial, nachhaltiger zu wirtschaften. Ob es den Hunger schnell bekämpft, hängt aber von vielen Faktoren ab, auch davon, was damit gemacht wird: In welche Anwendungen wird investiert, werden auch Sorten entwickelt, die die Menschen in Niger oder Mali brauchen?"
Genau an diesem Punkt setzt ein Team um den Pflanzengenetiker Howard-Yana Shapiro an. Der Chefwissenschafter des Nahrungsmittelkonzerns Mars Incorporated will mit einem Konsortium das Erbgut von 100 afrikanischen Nahrungspflanzen entschlüsseln und kostenlos veröffentlichen, um den Anbau zu verbessern und höhere Nährstoffgehalte zu erzielen. So könnte etwa versucht werden, die Verfügbarkeit von Zink, Eisen oder Vitamin A zu erhöhen.
Es geht dabei vor allem um Pflanzen, die von lokaler Bedeutung sind, von der Agrarindustrie aber vernachlässigt und daher nicht weiterentwickelt wurden – zum Beispiel die Yamswurzel oder der Brotfruchtbaum. Für Shapiro liegt in der Kombination aus Präzision und einfachem wie günstigem Zugang zur Technologie der Schlüssel zum Erfolg: " Das ist in meiner Lebenszeit der Durchbruch aller Durchbrüche. Früher gab es ein paar Gruppen, die mit den besten Technologien arbeiten konnten, aber das hat sich geändert."
Schlechte Zeiten für Goldenen Reis
Was Genome Editing, aber auch andere gentechnische Methoden für die Zukunft der Ernährung leisten können, hängt nicht allein vom Forschungsstand und dem Zugang zu Technologien ab. Es ist nicht zuletzt eine gesellschaftliche und politische Frage, auf welche Weise Nahrungsmittel verändert und optimiert werden sollen. Für die Pflanzengenetikerin Pamela Ronald von der University of California, Davis ist deshalb noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Ihre Befürchtung ist, dass unfundierte und ideologische Standpunkte oder Wohlstandsbefindlichkeiten in den reichsten Gesellschaften der Welt das Potenzial bremsen, die Lebenssituation der Ärmsten zu verbessern.
Die Sorge ist nicht unbegründet. Ein besonders drastisches Beispiel dafür ist der Streit um den sogenannten Goldenen Reis: In den 1990er-Jahren stießen Forscher die Entwicklung dieser gentechnisch veränderten Reispflanze an, die reich an Beta-Carotin ist, das im Körper zu lebenswichtigem Vitamin A umgewandelt wird. So könnte der folgenreiche Vitamin-A-Mangel einfach und effektiv bekämpft werden, der nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation vor allem in Südostasien jährlich knapp zwei Millionen Menschen erblinden lässt oder gar das Leben kostet, großteils Kindern.

Doch als die Herstellung der lebensrettenden Pflanze schließlich mit finanzieller Unterstützung der Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung gelang, war nicht nur die Freude groß, sondern auch die Empörung: Westliche Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace protestierten, Anti-Gentechnik-Aktivisten zerstörten Versuchsfelder auf den Philippinen. Bis heute wird derart Stimmung gegen das Projekt gemacht, dass es nur langsam vorwärtskommt. Vor zwei Jahren warnten über 100 Nobelpreisträger in einem offenen Brief vor den Folgen dieser Kampagnen und sprachen sich für den Gentechnikeinsatz in der Landwirtschaft aus, um die wachsende Weltbevölkerung versorgen zu können.
Verschwörungstheorien
Ronald, die mit ihrem Mann Raoul Adamchak soeben eine aktualisierte Neuauflage ihres Bestsellers Tomorrows Table veröffentlicht hat (siehe S. 42), in dem auch die irrationale Skepsis gegenüber neuen Methoden thematisiert wird, wittert viele Verschwörungstheorien und unwissenschaftliche Behauptungen hinter der Pauschalkritik an Gentechnik: "Wissenschaft ist kein Glaubenssystem, es geht um Beweise, und die sind eindeutig: In den mehr als 40 Jahren, in denen Gentechnik in der Pflanzenzucht oder bei der Herstellung von Medikamenten eingesetzt wird, gab es keinen einzigen dokumentierten Fall für gesundheitliche oder ökologische Schäden. Alle großen wissenschaftlichen Organisationen kommen zu dem Schluss, dass die Risiken moderner Gentechnik im Pflanzenbau mit denen konventioneller Methoden vergleichbar sind. Das sind dieselben Institutionen, denen die meisten von uns in vielen anderen Lebensbereichen vertrauen."
Faktor Fleisch
Ronald wird nicht müde zu betonen, dass alles, was wir essen, genetisch verändert wurde – mit der einen oder anderen Technik. Dementsprechend sieht sie in der gentechnischen Entwicklung einer neuen Reissorte, an der sie selbst vor einigen Jahren beteiligt war, nur den "bisher letzten Schritt in einem Prozess, der mit der Reiskultivierung vor Jahrtausenden begann". Gemeinsam mit Kollegen erzeugte Ronald Reispflanzen, die ohne Ertragseinbußen bis zu 14 Tage unter Wasser überleben können. Für Reisbauern in Südostasien, wo durch Monsunregen und Sturzfluten jährlich Millionen von Tonnen Reis auf den Feldern vernichtet werden, ist das eine enorme Verbesserung zu herkömmlichen Sorten, die nur drei Tage im Wasser überstehen.

In einigen Gegenden werden Insekten schon lange als Nahrungsmittel geschätzt – laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation essen zwei Milliarden Menschen täglich Insekten. Ein wichtiger Impuls, damit sich der ressourcenschonende Proteinlieferant auch bei uns durchsetzen kann, ist kürzlich gelegt worden: Seit 2018 sind Insekten auch in der EU als Lebensmittel zugelassen.
Kurt Schmidinger interessiert sich hingegen für Fleisch – obwohl er schon lange vegan lebt. Der Gründer der österreichischen Informationsplattform Future Food beschäftigt sich mit der Frage, welche Alternativen Forschung und Industrie zur konventionellen Fleischproduktion bieten könnten. Für Schmidinger, der vor einigen Jahren auch seine Dissertation an der Universität für Bodenkultur Wien dem Thema widmete, liegt der Weg in eine Zukunft mit weniger Ressourcenverschwendung, Mangelernährung, Tierleid und Treibhausgasproduktion in einer Umstellung der Ernährung, die für Konsumenten nicht oder nur kaum spürbar ist: Die Vision ist nicht der völlige Verzicht auf Fleisch und andere tierische Produkte, sondern alternative Herstellungsmethoden. Schmidinger: "Es gäbe zwar genügend Möglichkeiten, sich ohne Fleisch gesund und abwechslungsreich zu ernähren, aber man muss die Menschen abholen, wo sie sind."
Aktuelle Zahlen verdeutlichen die Relevanz der Suchen nach neuen Strategien: Nach Angaben der FAO stammen schon heute 14,5 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Haltung und Verarbeitung von Tieren. Die Haltung der mehr als 20 Milliarden Hühner, 1,5 Milliarden Rinder und Milliarden von Schweinen und Schafen auf unserem Planeten beansprucht knapp ein Viertel der globalen Landfläche – die Fütterung fast ein Drittel der gesamten Ernteerträge. Die wachsende Weltbevölkerung und der steigende Wohlstand in Schwellenländern bedeuten zudem, dass der Konsum tierischer Proteine weiter zunehmen wird.
An Ideen zu einer nachhaltigeren Produktion tierischer Proteine mangelt es nicht. Ob ein großer Teil der Menschheit je zu Würmern oder Insekten greifen wird – so sinnvoll das aus ökologischen und physiologischen Gründen auch sein mag – ist unklar, wenn nicht zweifelhaft. Immerhin wird Insektenmehl zunehmend als Futtermittel für Schweine oder Fische in Aquakultur eingesetzt, ein Schritt Richtung Ressourcenschonung. Die Grundprobleme der Intensivtierhaltung löst das aber nicht.
Fleisch (fast) ohne Tiere
Bild nicht mehr verfügbar.
Der Ansatz, Fleisch im Labor zu züchten, erscheint da schon vielversprechender – und wird immer greifbarer. Das Prinzip, wenige tierische Ausgangszellen in Nährlösungen zu vermehren und dann auf einem essbaren Gerüst zu Fleischprodukten heranwachsen zu lassen, funktioniert in Ansätzen bereits.
Seit der niederländische Forscher Mark Post von der Universität Maastricht 2013 den weltersten im Labor erzeugten Burger aus Rindermuskelstammzellen präsentierte, hat sich einiges getan: Inzwischen gibt es etliche Forschungsgruppen, denen die Herstellung von Burgern, Fleischbällchen und Nuggets auf diese Weise gelungen ist. Bisher beschränken sich die Erfolge auf verarbeitete Fleischwaren. Die In-vitro-Produktion von Fleisch in seiner Ursprungsform, etwa als Steak, ist wesentlich komplexer als die eines Fleischbällchens – und selbst dieses hat es noch nicht in den Handel geschafft. Doch in den vergangenen Jahren flossen enorme Summen in die Entwicklung, auch mehrere große Fleischkonzerne investieren heute in die Entwicklung von In-vitro-Fleisch.
Billige Burger
Schmidinger sieht darin einen großen Fortschritt: Denn die Voraussetzung dafür, dass derartige Erzeugnisse einmal anstatt herkömmlicher Fleischprodukte auf den Tellern landen, sei der Preis. Kostete die Herstellung des ersten Labor-Burgers von Mark Post noch rund 250.000 Euro, stehe man heute bei etwa 60 Euro. Ein Unternehmen behauptet, Supermärkte schon bis 2020 beliefern zu können – wobei hier auch noch die komplizierte Frage der Zulassung zu klären sein wird. "Die Technologie muss deutlich effizienter werden als die Tierhaltung, sonst wird In-vitro-Fleisch nie marktfähig werden", so Schmidinger. "Ich denke, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts wird es etwas am Markt geben, und dann beginnt das Tunen am Geschmack." Würde er selbst als Veganer ein solches Produkt probieren? "Ja, aus Neugier – vermissen tue ich Fleisch aber nicht."

Bereits seit den 1990er-Jahren wird daran gearbeitet, Fleischgewebe künstlich zu kultivieren. Der erste In-vitro-Burger wurde 2013 präsentiert, Fleischbällchen aus Rinderstammzellen 2016. 2020 könnten erste In-vitro-Fleischprodukte marktreif sein.
Auch FAO-Experte Schmidhuber sieht in alternativen Methoden zur Fleischproduktion einen aussichtsreichen Ansatz. "Wenn das praxisreif ist, wird sich die Tierhaltung stark verändern. Und das wird sie auch müssen, weil es aus Verbrauchersicht immer mehr Forderungen gibt, tiergerechter zu produzieren." In absoluten Zahlen sei weltweit bis 2050 annähernd von einer Verdoppelung des Fleischkonsums auszugehen – doch die Zunahme erreicht Grenzen: In westlichen Gesellschaften sei der Fleischverzehr heute pro Kopf bereits so hoch, dass er kaum noch wachsen könne.
In Asien sehe das anders aus, wobei es gerade in Indien und China, zwei bevölkerungsreichen Ländern mit wachsender Mittelschicht, zu keinem immensen Anstieg kommen werde. Schmidhuber: "In China haben wir schon in der Vergangenheit unglaubliche Wachstumsraten gesehen, der Fleischverbrauch ist heute relativ hoch. In Indien hingegen haben die Menschen vor 50 Jahren genauso wenig Fleisch verzehrt wie heute – das hat religiöse und kulturelle Gründe und wird wahrscheinlich auch so bleiben." In Subsahara-Afrika gebe es wiederum nicht die Einkommenssteigerung, die einen starken Zuwachs erlaube.
Aus Ressourcensicht sei es absolut sinnvoll, global weniger Fleisch zu produzieren und damit weniger Treibhausgase, weniger Wasserverbrauch und weniger Landverbrauch zu verursachen. Das heiße nicht, dass man kein Fleisch mehr essen solle, so Schmidhuber: "Es ist ein absolut sinnvoller Teil der Ernährung. Aber man kann das deutlich reduzieren, ohne gesundheitliche Mängel zu verursachen. Das ist ja gerade eines der Probleme der Urbanisierung: Man konsumiert mehr, als man eigentlich sollte." (David Rennert, 10.4.2018)