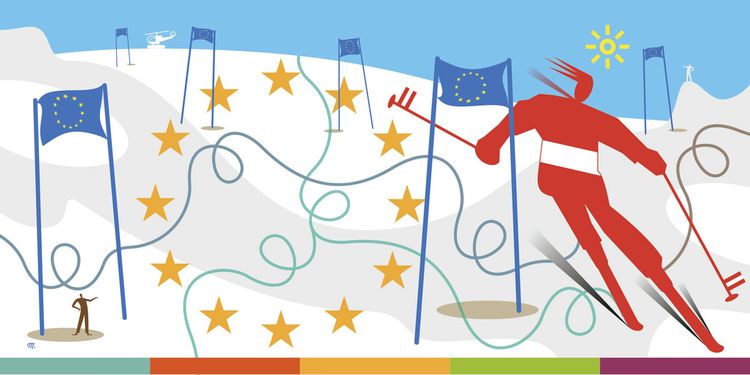Was hat die EU eigentlich beim Karfreitag verloren? Diese Frage stellen sich viele in Österreich, seit ein Spruch des Europäischen Gerichtshofs im Februar die jahrzehntelange Praxis beendet hat, dass nur Protestanten und Altkatholiken an ihrem höchsten Feiertag freibekommen.
Denn für das Funktionieren des Binnenmarkts mit seinen vier Freiheiten und anderen Prinzipien der Union ist es gleichgültig, wer am Karfreitag arbeiten muss und wer nicht. Und für viele ist das EuGH-Urteil ein weiteres Beispiel für ein Übermaß an Regulierung und Einmischung durch die EU – eine Kritik, die auch im kommenden Europawahlkampf vor allem die FPÖ aufgreifen dürfte.
Doch das Gesamtbild ist viel komplexer, betonen Juristen. Während in einigen Rechtsbereichen die wesentlichen Entscheidungen in Brüssel und Luxemburg fallen, ist der Spielraum der Mitgliedsstaaten anderswo weiterhin sehr hoch.
Grundrechtecharta als Quelle
Das Karfreitag-Urteil des EuGH ist recht untypisch für das Beziehungsgeflecht zwischen der EU und Österreich. Grundlage des Urteils ist die Europäische Grundrechtecharta, die mit dem Vertrag von Lissabon ins Primärrecht der Union eintrat. Darin ist das Verbot jeder Diskriminierung wegen Geschlechts, Rasse, Religion, sexueller Ausrichtung oder Weltanschauung festgeschrieben – und dies wird vom EuGH streng ausgelegt, sagt Thomas Jaeger, Vorstand des Instituts für Europarecht an der Universität Wien.
Das sei eine problematische Entwicklung, denn "in der Grundrechtecharta steht viel drin, und wenn der EuGH beginnt, sie zu breit zu interpretieren, dann weiß man nicht, wo das aufhören wird".
Auch beim Umwelt-, Natur- und Artenschutz sieht Jaeger zum Teil eine sehr hohe Regelungsdichte durch das Unionsrecht, die manchmal über das Notwendige hinausginge. In vielen anderen Bereichen aber spielten EU-Richtlinien und Verordnungen nur eine untergeordnete Rolle, da hätte der nationale Gesetzgeber viel Spielraum.
"Mit der dritten Piste am Flughafen Wien hat die EU nur mittel- bar etwas zu tun, im Kern geht es um nationale Bestimmungen und eigenes Ermessen", verweist Jaeger auf eine aktuelle Kontroverse.

Insgesamt hätte Österreichs Wirtschaft, Unternehmen genauso wie Arbeitnehmer und Verbraucher, durch die EU-Mitgliedschaft ungemein viel gewonnen, betont Jäger. Das merke man in jedem Supermarkt, wo Auswahl, Qualität und Leistbarkeit in den vergangenen 25 Jahren deutlich zugenommen hätten – und dies vor allem dank des engen rechtlichen Korsetts des Binnenmarkts, der den freien Zugang für Produkte, Dienstleistungen und Arbeitnehmer regelt.
Manche wertvolle Prinzipien gehen sogar auf die Gründungsverträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zurück, sagt Ex-Justizministerin Maria Berger, die gerade als EuGH-Richterin ausgeschieden ist – etwa das Gebot der Lohngleichheit. "Da ging es um die Wettbewerbsgleichheit zwischen Deutschland und Frankreich", sagt sie. "Kein Staat soll sich einen Vorteil verschaffen, indem er Frauen schlechter bezahlt."
Deshalb mussten auch Teile der Umweltpolitik auf die EU-Ebene verlagert werden, betont Berger. "Für fairen Wettbewerb brauche ich faire Rahmenbedingungen. Sonst erhält ein Unternehmen, das sich nicht an die gleichen Umweltauflagen halten muss, einen Wettbewerbsvorteil." Wohin das führe, sehe man bei der Steuerpolitik, die kaum vergemeinschaftet ist. Die Folge sei, dass Staaten mit immer geringeren Körperschaftssteuersätzen miteinander konkurrierten, zum Schaden der Gemeinschaft.
Richtlinien und Verordnungen
Das europäische Primärrecht beruht auf den Verträgen, das sogenannte Sekundärrecht auf den von den Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament gemeinsam beschlossenen Richtlinien und Verordnungen. Bei der Umsetzung gemeinsamer Vorschriften wird den Mitgliedsstaaten grundsätzlich ein gewisser Spielraum eingeräumt, vor allem bei den EU-Richtlinien, die erst ins nationale Recht umgesetzt werden müssen. Verordnungen wirken hingegen direkt.
Doch die Grenzen zwischen diesen beiden Instrumenten verschwimmen immer mehr, sagt Kurt Retter, Partner und Head of Regulatory in der Anwaltskanzlei Wolf Theiss. So werden immer mehr Richtlinien von Durchführungsverordnungen begleitet, weil die Unterschiede in der Regulierung sonst zu groß wären. "Die Richtlinie als Harmonisierungsinstrument ist an ihre Grenzen gestoßen", sagt er und verweist auf den Datenschutz, wo statt der früheren vagen Richtlinie seit knapp einem Jahr die viel strengere DSGVO gilt. Vor allem bei der Höhe der Strafe habe es zuvor viel zu große Abweichungen gegeben.
Aber auch eine EU-Verordnung sichert keine rechtliche Einheitlichkeit, weil den Staaten immer noch Flexibilität bei der Umsetzung eingeräumt wird. Das sei die Folge von unvermeidlichen politischen Kompromissen, betont Retter. "Die gab es auch bei der DSGVO, das war das meistlobbyierte Gesetz der EU-Geschichte. Die Folge sind schwammige Formulierungen, die dann später der EuGH interpretativ lösen muss."

Aber auch die EU-Richter sind nicht frei von politischen Einflüssen und Motiven, was manchen Europarechtlern Sorgen bereitet. So stieß das Gutachten des Generalanwalts zur deutschen Pkw-Maut, die den Inländern durch eine Senkung der Kfz-Steuern rückvergütet wird, auf viel Kritik, weil das die Möglichkeit der indirekten Diskriminierung infrage stellt. Auch die EuGH-Richter dürften davor zurückschrecken, Deutschland bei einem politischen Prestigeprojekt zu verurteilen.
Aber Jäger hofft zumindest auf ein eng argumentiertes Urteil. "Wenn die Richter die Logik des Generalanwalts übernehmen, dass heimische Steuerzahler und nichtzahlende Ausländer keine vergleichbaren Gruppen sind, weil die einen ja nichts zahlen, dann wirft das ein Grundprinzip der Union über den Haufen. Das würde das Verbot der Diskriminierung ausländischer Staatsangehöriger aushöhlen und Ungleichbehandlungen aus rein wirtschaftlichen Gründen erlauben. Das war bisher zu Recht ein No-Go."
Indexierung hat geringere Chancen
Weniger Chancen werden hingegen der Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebenshaltungskosten in den Ländern, in denen die Kinder leben, gegeben, die Österreich vor kurzem beschlossen hat. Dies verstoße zwar nicht unbedingt gegen die Grundfreiheiten, aber wahrscheinlich gegen die Koordinierungsverordnung für Sozialversicherungsleistungen aus dem Jahr 2010, betont Jaeger. Die könne zwar abgeändert werden, aber nur mit einer politischen Mehrheit, die derzeit nicht in Sicht sei. Deshalb erwarten die meisten Experten, dass Österreich das Verfahren vor dem EuGH verliert.
Für David Christian Bauer, Managing Partner der internationalen Sozietät DLA Piper in Wien, wäre dies ein weiteres Zeichen dafür, dass in der Union "das Prinzip der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit verlorengeht. Auch ein einheitlicher Binnenmarkt muss nicht alles einheitlich regeln." Wie beim Karfreitag gebe es auch bei der Höhe der Familienbeihilfe Differenzierungskriterien, die angewendet werden sollten. "Dieses Prinzip wird vernachlässigt", kritisiert Bauer.
Vergessenes Leitbild
Vor allem im Finanzmarkt und bei Anlageprodukten sei die EU als Folge der Weltfinanzkrise in eine Überregulierung verfallen, die sich etwa bei der MiFID-II-Richtlinie zeige, die seit Anfang 2918 in allen Staaten anzuwenden ist. "Die EU ist hier vom Leitbild des mündigen Verbrauchers weggegangen und übernimmt eine immer eingreifendere Rolle," sagt er. Mit einem Übermaß an Formularen und Regulierungen sei auch dem Ziel, Finanzkunden einen besseren Schutz zu bieten, nicht gedient. Denn die seien durch die vielen Auflagen überfordert.
Auch hier hätte Österreich Spielraum für eine praxisnähere Umsetzung gehabt, doch die werde oft nicht genützt. "Was fehlt, ist der Wille zur Flexibilität", sagt Bauer. "Aber wenn man das Ziel hat, den strengsten juristischen Standard zu setzen, und dies über die Wirtschaftlichkeit stellt, dann ist das weder im Interesse des Binnenmarktes noch in dem der Kunden."

Als Goldplating wird die Tendenz bezeichnet, EU-Vorschriften überzuerfüllen. Bauer sieht dies auch beim Entwurf für die Umsetzung der neuen Aktionärsrichtlinie. Diese verlangt, dass die Identität von Aktionären ab einer Beteiligung von 0,5 Prozent offengelegt werden muss. In Österreich soll das für jeden einzelnen Aktionär gelten, egal wie klein sein Investment sei. "Das Unternehmen muss dann bei der Bank nachfragen, und die bei dem Kunden. Wo ist da der Gewinn? Inhaberaktien sollten überdies auch tatsächlich solche bleiben, und damit auch anonym."
Retter von Wolf Theiss meint, dass es sich die Legisten in den Ministerien oft zu leicht machen und bei der Umsetzung von Richtlinien die begleitenden Verordnungen einfach nur abschreiben. "Die Deutschen nehmen sich mehr Freiräume heraus. Österreich übernimmt dabei oft auch unklare Bestimmungen, die dann zur Gerichtssache werden oder als Vorlage beim EuGH landen." Dass auffallend viele EuGH-Entscheidungen Österreich betreffen, begründet Retter so: "Wir haben eine sportliche Rechtskultur mit vielen Anfechtungen und werden so zum Treiber der EuGH-Judikatur." Die Causa Karfreitag sei dafür nur ein Beispiel.
Wie man Goldplating eindämmt
Das Goldplating einzudämmen ist eine der Aufgaben von Justizminister Josef Moser. Sein Ressort hat nun eine erste Regierungsvorlage eingebracht, die 800 überschießende Bestimmungen identifiziert, aber nur ungefähr 30 verändert. Bauer hält dies für einen sinnvollen ersten Schritt, andere hingegen für eine fragwürdige Übung.
"Der Kampf gegen Goldplating ist aus einer Polemik herausgeboren", sagt der Europarechtler Jaeger. Denn es liege in der Natur von Richtlinien, dass sie nur einen Mindeststandard festlegen, der übertroffen werden kann. "Hohe Umweltstandards können für ein Land wie Österreich sinnvoll sein, ebenso ein hoher Konsumentenschutz", sagt Retter. "Das ist auch eine Frage der Kultur. Allerdings darf es nicht zu Standortnachteilen für österreichische Betriebe führen."
Berger verweist auf den Mindesturlaub von vier Wochen, den das Unionsrecht vorsieht. "Wenn man Goldplating wirklich abschaffen will, dann stünde die fünfte Urlaubswoche in Österreich zur Debatte", sagt sie. "Ich glaube nicht, dass das jemand angreifen will."

Doch auch im Umweltrecht müsse man nicht alles so stur umsetzen, etwa bei der Natura-2000-Verordnung, sagt Retter. Er beschreibt einen Fall aus der Praxis, wo ein Hotel in einem Naturschutzgebiet den Weg in der Nacht nicht beleuchten dürfe, weil dies die Fliegen stören würde. "Das wird in anderen Ländern unter Umständen nicht so heiß gegessen. Aber die Behörden stehen unter starkem Druck der NGOs und wollen nicht in den Geruch des Amtsmissbrauchs kommen."
Bauer von DLA Piper wiederum kritisiert Gerichte, die ihre Urteile ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Notwendigkeiten fällen. "Die Befolgung der EU-Regeln ist in der österreichischen Spruchpraxis sehr streng und teilweise überschießend. Wenn man Goldplating reduzieren will, geht es nicht nur um die Gesetzgebung, sondern auch die Gerichts- und Verwaltungspraxis", sagt er.
Schwierige Entsendungen
Ob EU-Recht zu streng oder zu locker umgesetzt wird, ist von Fall zu Fall verschieden. Berger verweist auf die Schwierigkeiten, die bei der Entsendung von Arbeitnehmern aus anderen EU-Staaten entstehen. Diese dürfen nicht behindert werden, doch müssten die arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Lohnstandards eingehalten werden.
"Die Entsendemöglichkeit in der EU ist eine gute Sache, aber die Einhaltung der Regeln wird nur schwach überwacht", sagt Berger. "Einerseits werden viele Hürden aufgebaut, wenn ein saarländischer Tischler mit zwei Mitarbeitern im Elsass arbeiten will, und gleichzeitig wird Missbrauch betrieben, um Standards zu umgehen."
Auch wenn Politiker immer öfter auf nationale Interessen setzten und Alleingänge versuchen, sieht Berger keinen allgemeinen Trend zur Renationalisierung des Rechts. "Das findet eher in Randbereichen statt. Sonst macht die Wirtschaft zu viel Druck, dass es nicht dazu kommt." (Eric Frey, Wirtschaft & Recht Journal, 21.3.2019)