Auf dem Campus in Maria Gugging, wo Englisch praktisch die Amtssprache ist, nennt ihn jeder Tom. Im Gespräch gehen dem gebürtigen Linzer immer wieder englische Wörter schneller von der Zunge als deutsche – ein Resultat seiner jahrzehntelangen Forscherkarriere abseits von Österreich. 2009 zog es den renommierten Computerwissenschafter wieder in die Heimat zurück. Seither leitet er das Institute of Science and Technology (IST) Austria, eine bislang einzigartige Einrichtung in der österreichischen Forschungslandschaft.
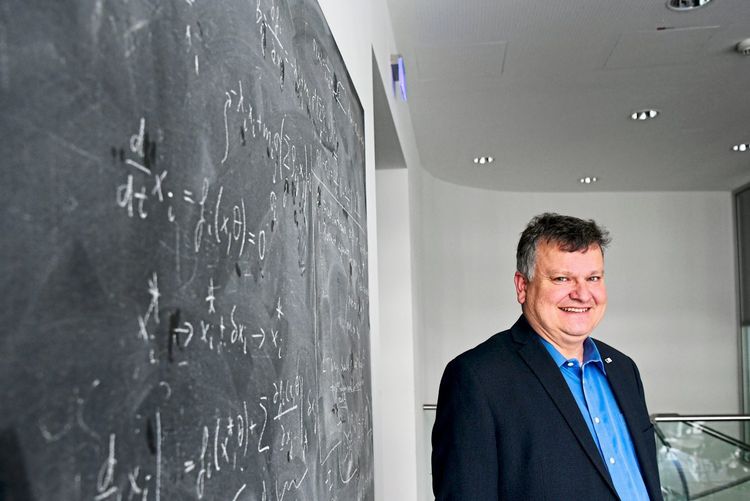
STANDARD: Das IST hatte keinen leichten Start nach den jahrelangen Debatten rund um den Standort und Sinn und Zweck einer "Elite-Uni" in Österreich. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass der Plan nicht aufgehen könnte, in Maria Gugging ein Topforschungsinstitut auf der buchstäblich grünen Wiese aufzuziehen?
Henzinger: Die Entscheidungen über Standort und Grundkonzept sind gefallen, bevor ich als Präsident berufen wurde. Tatsächlich konnte ich mir nicht sicher sein, was daraus wird. Es war ein risikoreiches Projekt, und kein Mensch konnte garantieren, was dabei herauskommt. Zehn Jahre später kann man das schon sagen. Wir sind, um nur ein Beispiel zu nennen, die erfolgreichste Institution europaweit bei der Einwerbung von Geldern des European Research Council (ERC). Wir liegen bei der ERC-Erfolgsrate vor der ETH Zürich, Oxford, Cambridge und der Max-Planck -Gesellschaft. Wenn ich Ihnen das vor zehn Jahren versprochen hätte, hätte ich es wahrscheinlich selber nicht geglaubt.
STANDARD: Die hochdotierten ERC-Grants wurden ungefähr zeitgleich mit der Gründung des IST eingeführt – waren sie so etwas wie ein Katalysator für das Institut?
Henzinger: Retrospektiv muss man sagen, dass die ERC-Grants das Modell, auf dem das IST aufgebaut ist, sehr unterstützt haben (ein Drittel der öffentlichen Gelder ist an die Einwerbung von Drittmitteln gebunden, Anm.). Zwei Drittel unsere Professoren brauchen keine andere Finanzierung. Damals war die Entwicklung des ERC nicht vorhersehbar. Das war ein Glücksfall.

STANDARD: Weniger auf Glück beruht der Aufstieg in die Topliga der weltweiten Forschungszentren, den sich das IST auf die Fahnen geschrieben hat. Was ist Ihr Rezept? Ist es die Cafeteria für alle, in der Studenten mit Nobelpreisträgern plaudern, womit Max F. Perutz unter anderem den Erfolg seines Labors begründete, oder ist es doch schlicht das Geld, das in Österreich immer wieder als Voraussetzung für Exzellenz angeführt wird?
Henzinger: Beides stimmt. Hierarchielosigkeit ist ein riesiger Vorteil der angloamerikanischen Wissenschaftskultur gegenüber der traditionell kontinentaleuropäischen, wo an der Spitze der große Professor sitzt und es darunter viele Ebenen bis zum Studierenden gibt. Wir setzen ganz bewusst auf kleine Forschungsgruppen mit maximal 15 Personen. Es gibt keinen akademischen Mittelbau. Professoren und Studierende, auch aus verschiedenen Fachrichtungen, sitzen gemeinsam am Tisch, nicht nur beim Kaffee, sondern werden auch ganz gezielt zusammengebracht. Diesen Spirit, diese Kultur zu schaffen ist ganz wichtig, damit Ideen entstehen können. Wissenschaft ist Kreativität. Und Ideen entstehen oft im ungeplanten, unerwarteten Gespräch.
STANDARD: Um die Ideen umzusetzen, braucht es Geld.
Henzinger: Ohne das geht es natürlich auch nicht. Man kann in den modernen Naturwissenschaften nicht konkurrieren, wenn nicht die Technik auf dem modernsten Stand ist. Unsere dritte wesentliche Säule ist es, die besten, klügsten Köpfe hierherzuholen und sie frei forschen zu lassen.

STANDARD: Wie kommt man denn an die besten Köpfe – müssen Sie sie überreden und mühevoll abwerben oder stark selektieren?
Henzinger: Das kommt darauf an. Wenn es um neue Wissenschaftsfelder geht, die noch nicht am Institut etabliert sind – wie derzeit die Chemie –, ist es notwendig, aktiv hinauszugehen, Wissenschafter gezielt anzusprechen, ein weltweites Netzwerk aufzubauen. Da muss man mitunter jemanden überreden, praktisch aus dem Nichts ein neues Gebiet aufzubauen. Das reizt nicht viele aus der wissenschaftlichen Topliga. Auf der Ebene der Assistenzprofessuren, für die sich Postdocs aus aller Welt bewerben können, bekommt man dagegen die nötige Anzahl und Qualität an Bewerbern – mehr als 1000 pro Jahr. Unser größtes Geheimnis ist, dass wir immer vollkommen offen gegenüber allen Feldern waren und nie etwa speziell Biochemiker oder Mathematiker gesucht haben. Dadurch haben wir immer große Pools an Kandidaten, aus denen man die, die herausstechen, herholen kann. Exzellenz und wissenschaftliches Potenzial sind unsere einzigen Rekrutierungsfaktoren – praktisch unabhängig davon, welche Fachrichtung jemand betreibt.
STANDARD: Nicht nur aufgrund dieses Ansatzes wirkt das IST in der österreichischen Forschungslandschaft bisweilen wie eine Parallelwelt. Auch die umfangreichen, langfristigen Finanzierungsgarantien von Bund und Land Niederösterreich unterscheiden es von anderen Institutionen. Inwieweit spielen Forschungs- und Regierungspolitik für Sie eine Rolle?
Henzinger: Ich kann nur sagen: Gott sei Dank wird uns diese Unabhängigkeit und Freiheit gewährt, nicht nur zu entscheiden, in welchen Feldern wir forschen und wen wir anstellen, sondern auch unsere eigenen Strukturen und Prozesse zu gestalten, vollkommen unabhängig von der Wissenschaftslandschaft in Österreich. Hier muss man der Politik auch ein Kompliment machen, dass so etwas möglich ist in diesem Land. Wir zeigen, dass langfristiges und zielgerichtetes Denken in der Wissenschaftspolitik Erfolge zeigt. Es liegt nicht an uns, ob das einen Effekt auf den Rest des Systems hat, aber als Österreicher hoffe ich natürlich, dass unsere Erfolgsrezepte auch in anderen Bereichen Beachtung finden werden.

STANDARD: Von den 258 Alumni, also PhD-Absolventen und ehemaligen Postdocs, sind lediglich 38 in Österreich geblieben und nun in der heimischen Wirtschaft oder Wissenschaft tätig. Sind die besten Köpfe schnell wieder weg?
Henzinger: Die Zahlen sind nicht sehr aussagekräftig, weil die meisten der derzeitigen Alumni bei uns Postdocs waren, also Wissenschafter, die woanders ihren PhD gemacht haben, für eine bestimmte Zeitspanne hierherkommen und dann ihre Karriere woanders weiterverfolgen. Die Zahl der Studierenden, die hier ihr Doktorat gemacht haben, steigt erst langsam an, schließlich dauert das Studium im Schnitt fünf Jahre. Interessanterweise ist der Anteil der Wissenschafter, die aus Österreich kommen, und der Anteil, der nach dem Abschluss in Österreich bleibt, immer um die 20 Prozent. Aber es sind nicht die gleichen 20 Prozent. Vielen, die hierherkommen, gefällt es.
STANDARD: Die Sorge wegen Braindrains, also der Abwanderung von hochqualifizierten Wissenschaftern, ist also unbegründet?
Henzinger: Es geht hier weniger um den vielzitierten Braindrain und Braingain. Es geht vielmehr darum, Teil der Brain-Circulation zu sein. Im internationalen Wettbewerb gibt es ein ständiges Kommen und Gehen. Auch und gerade erfolgreiche Wissenschafter bleiben nie ewig an ihren Institutionen, weil sie neue Umfelder suchen. In der Champions League der Wissenschafter mitzumachen ist Kern des IST – mit allen daraus resultierenden Vorteilen für ein Land wie Österreich. Wenn man Teil der Topliga ist, siedeln sich etwa Firmen mit ihren Forschungsabteilungen an. Nichts ist internationaler und offener als Wissenschaft. Wenn man sich national einengt, fällt man zurück. Es liegt in Natur der Sache: Wenn man an etwas arbeitet, das noch unerforscht ist, dann stellen sich möglicherweise Forscher in Singapur dieselben Fragen wie in Kalifornien. Um aber manchmal der Erste zu sein, muss man die Besten haben. Darum ist nichts mehr hinaus geworfenes Geld als mittelmäßige Grundlagenforschung. Weil man nicht die Chance hat, Erster zu sein.

STANDARD: Kommt der nächste österreichische Nobelpreisträger vom IST?
Henzinger: Die Welt ist voller Nobelpreisträger, die ungefähr 80 Jahre alt sind, den Preis mit 75 bekommen haben für etwas, das sie mit 25 gemacht haben. Man kann in der Wissenschaft in den meisten Fällen nicht feststellen, wie wichtig ein Ergebnis zehn Jahre später sein wird. Ziel unseres Instituts ist es, jetzt ein glückliches Händchen bei der Auswahl junger Forscher zu haben, sodass vielleicht einer von ihnen in 50 Jahren einen Nobelpreis bekommt, ob nun hier oder woanders, ist letztlich egal.
STANDARD: Wo liegt das IST auf dem Weg in die Topliga?
Henzinger: Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht fertig mit diesem Projekt. Mit 50 Forschungsgruppen haben wir bei weitem noch nicht die internationale Sichtbarkeit, um ein dauerhafter Hub in der internationalen Wissenschafterszene zu sein. Wir haben eine abgesicherte Finanzierung, um bis 2026 auf 90 Gruppen zu wachsen, aber selbst das ist noch keine kritische Masse. Dafür wären etwa 150 Gruppen ideal. Das bedeutet eine Verdreifachung bis 2036. Diese Perspektive ist unheimlich wichtig für das Institut. Ich vertraue darauf, dass die Politik ihre langfristige Unterstützung auch konsequent fortsetzen wird.
STANDARD: Wie lange bleiben Sie noch am Steuer?
Henzinger: Ich bin in der dritten Amtsperiode bis 2021. Schauen wir mal weiter. Ich würde auch gern wieder mehr forschen. (Karin Krichmayr, 31.5.2019)