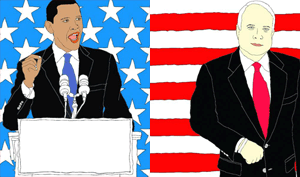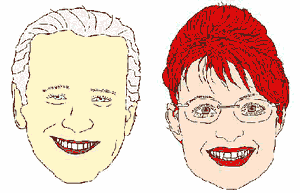Die Strategie des Demokraten Barack Obama scheint kurz vor der US-Präsidentenwahl aufzugehen: Er präsentiert sich als Ruhepol in stürmischer Zeit. Sein Rivale John McCain verlagert sich auf Selbstironie.
***
Es ist kalt, es schüttet wie aus Schaffeln. Die Menschen vor der Bühne tragen Kapuzen und Capes, man sieht an ihren Gesichtern, wie sie frösteln in diesem Sauwetter. Vor ihnen steht Barack Obama, bekleidet mit Jacke und Jeans, an den Füßen Turnschuhe. Kein Schirm beschützt ihn, mit stoischer Gelassenheit trotzt er dem Wolkenbruch, der die Stadt Chester in Pennsylvania gerade in eine Seenlandschaft verwandelt. Es ist ein zufälliges Bild, aber kein Regisseur hätte es besser arrangieren können: Obama im Regen, durch nichts zu erschüttern, ein Kerl, auf den man auch dann bauen kann, wenn die Sonne nicht scheint. Es ist die optische Übersetzung für die Wandlung eines Mannes, der sich in der Schlussphase des Wahlkampfs als Ruhepol in stürmischen Zeiten verkauft.
Vor zwanzig Monaten war er aufgebrochen, in klirrender Kälte in Springfield, Illinois, der Stadt Abraham Lincolns. Er verkündete seine Kandidatur, war der klare Außenseiter. Dann besiegte er nicht nur Hillary Clinton, sondern auch das Establishment seiner Partei, das ihm nahegelegt hatte, sich doch noch ein paar Jährchen zu gedulden. Die mitreißenden Reden, die er hielt, um auf sich aufmerksam zu machen, sind heute Kult, von Rockstars besungen, von Künstlern verfilmt. Der Jubel des Jänners, der Sensationssieg zum Auftakt in Iowa, der verbale Aufbruch zu neuen Ufern, das "Yes we can".
Im Oktober erleben die Amerikaner einen Obama, der sehr viel nüchterner klingt, mehr wie ein Ökonomieprofessor, der geduldig erklärt, warum die Lage ist, wie sie ist. Die Rezession verleidet den Wählern den Appetit auf wolkige Rhetorik, gefragt sind Krisenmanager. Und das Überraschende ist, wie mühelos dem Senator aus Chicago auch diese Rolle gelingt. An die Stelle der verbalen Höhenflüge des Winters sind kurze, kühle Sätze getreten. "Wir haben ein Schiff mit vielen Lecks. Wir müssen es in den Hafen schleppen. Darum geht es beim finanziellen Rettungspaket."
Lob von Bill Clinton
Im Jänner hatten ihn manche Experten noch zum Messias erklärt, ihm ein Schweben in Wolkenkuckucksheim vorgeworfen. Jetzt lobt ihn Bill Clinton für seine Neigung, gründlich nachzudenken, bevor er Entscheidungen trifft. Bevor sich Obama zur Finanzkrise äußerte, enthüllte der Ex-Präsident bei einem gemeinsamen Auftritt in Florida, habe er die Clintons um Rat gefragt. "Und wisst ihr, warum? Weil er wusste, dass es kompliziert war. Und bevor er etwas sagte, wollte er es verstehen. Die Art, wie er mit dieser Krise umging, zeigt, dass er ein sehr, sehr guter Entscheider sein wird." Es war derselbe Clinton, der im Winter noch davor gewarnt hatte, für diesen Grünschnabel zu stimmen - es wäre wie Glücksspiel.
Oder der halbstündige Werbefilm, der am Mittwochabend von sieben Sendern simultan ausgestrahlt wurde. Sicher, es ging auch darum, Obama als fürsorglichen Familienvater zu zeichnen, der seiner älteren Tochter Malia aus jedem einzelnen Harry-Potter-Buch vorlas. Es ging um goldgelbe Weizenfelder und wehende Sternenbanner. Aber die entscheidenden Sätze sprach Kathleen Sebelius, die Gouverneurin von Kansas, des Bundesstaats, der sprichwörtlich für die Mitte Amerikas steht. "Barack besitzt gesunden Menschenverstand, er hat diesen mittelwestlichen Stil. Seine Wurzeln liegen in Kansas. Das ist einer, der Probleme löst."
"Obama hat Glück", schreibt der US-Kolumnist Jonathan Alter. Wäre die Wall Street nicht 2008, sondern erst 2009 kollabiert, hätte er es zweifellos schwerer gehabt. So aber kann er zusehen, wie sich die Balance der Argumente zugunsten der Demokraten verschiebt, die schon seit längerem eine stärkere Rolle für den Staat fordern. Die konservative Regierung George W. Bushs bestätigt ihn sogar unfreiwillig darin. Henry Paulson, ein Finanzminister, an dem der Wall-Street-Stallgeruch haftet, erbittet 700 Milliarden Dollar an Staatshilfe, um angeschlagene Privatbanken zu retten. In diesem Umfeld wirkt John McCain mit seinen Obama-gleich-Sozialismus-Sprüchen wie einer, der die letzten sechs Wochen verschlafen hat. Ohne die Finanzkrise, räumen Obamas Berater hinter vorgehaltener Hand ein, läge ihr Mann in den Umfragen vielleicht gar nicht vorn.
Szenenwechsel. Mittwochabend, John McCain im Talk-Studio von Larry King. "Sind Sie besorgt?", wird er von der Legende mit den Hosenträgern gefragt. Besorgt sei wohl das falsche Wort, antwortet McCain. "Wir liegen jetzt um zwei oder drei oder vier Prozent hinten. Und wir haben noch sechs Tage, um das aufzuholen. Sorge ist es nicht, Sie wissen ja, ich liebe den Status des Underdogs. Ich würde diesen Status nur gerne loswerden, sobald die Wahllokale schließen." Sagt's, grinst und bekommt glänzende Kritiken. Das war wieder der alte McCain, der es liebt, sich selbst auf die Schaufel zu nehmen.
Es war derselbe McCain, den eine Runde handverlesener Gäste vor ein paar Wochen im Prunksaal des Waldorf-Astoria-Hotels zu Manhattan erlebte. Bei einem Dinner, dessen wichtigste Funktion darin bestand, beide Bewerber auf ihre Fähigkeit zur Selbstironie zu prüfen. Ja, sagte der 72-Jährige, er gebe gern den Eigenbrötler, der gegen die Parteidisziplin rebelliert. "Solch einen Maverick kann ich spielen, nur Messias - das ist für mich eine Nummer zu groß." Doch eigentlich komme er sehr gut aus mit Obama, auf den sich die Anspielung bezog. "Ich nenne ihn einfach den da. Und er nennt mich George Bush."
Rebell mit lockerer Zunge
Als Rebell mit lockerer Zunge hat der Senator aus Arizona die Vorwahl der Republikaner gewonnen. Die Anti-Bush-Stimmung spülte ihn nach oben, seine offene Art kam an. Während Rivale Mitt Romney den Arbeitern der Autowerke Detroits das Blaue vom Himmel versprach, verkündete McCain klipp und klar: So sei das nun mal in der Wirtschaft, alte Jobs verschwänden und neue entstünden.
Im September, als die Aktienmärkte einbrachen, wirkte er neben dem besonnenen Obama noch wie ein auf und ab springender Kobold. Spontan wollte er die erste TV-Debatte mit seinem Kontrahenten absagen, um in Washington das Rettungspaket für die Geldbranche zu retten. Dabei wussten alle, dass die beiden Wahlkämpfer beim Verhandeln eigentlich eher störten. Dann versuchte es McCain mit der Schlammschlacht. Bill Ayers, ein Bombenleger der späten Sechzigerjahre, heute Uni-Professor in Chicago, sollte als Symbol für Obamas Bande zu vermeintlich zwielichtigen Zeitgenossen herhalten. Es funktionierte nicht. Ayers' Vergangenheit ist Schnee von gestern.
Schließlich blies der Bomberpilot des Vietnamkrieges zur finalen Attacke - mit "Joe the Plumber", dem Helden der Mittelklasse, dem Installateur, der ein Unternehmen gründen will und der Obama grob als "sozialistischen" Steuererhöher skizziert. Der Haken: McCain räumte einmal selbst ein, von Wirtschaft verstehe er nichts. "Warum sollte er heute etwas davon verstehen?", fragen scharfzüngige Kommentatoren. Seine Spezialgebiete sind das Militär und die Außenpolitik. Darum aber geht es beim Endspurt zum Oval Office höchstens am Rande.
Ist es also gelaufen für Obama? Keiner bestreitet das so energisch wie der Protagonist selbst. Intern hat Obama seinen Stab angewiesen, so hart zu arbeiten, als läge er bei den Demoskopen um zehn Prozentpunkte hinter McCain. Zu Wochenbeginn, als ihn euphorische Fans schon als neuen Präsidenten feiern wollten, wiegelte er resolut ab. "Nein, nein, nein. Ich bin abergläubisch. Ich mag es nicht, die Küken zu zählen, bevor sie geschlüpft sind." (Frank Herrmann aus Washington/DER STANDARD, Printausgabe, 31.10./1.,2.11.2008)