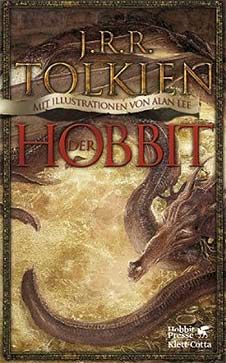
J.R.R. Tolkien: "Der Hobbit", illustrierte Ausgabe
Gebundene Ausgabe, 397 Seiten, € 23,60, Klett-Cotta 2009.
Mehr Gerüchte als gesichertes Wissen gibt es nach wie vor um die - zweiteilige oder vielleicht doch nur einteilige - "Hobbit"-Verfilmung durch Guillermo del Toro; geplanter Kinostart 2011/12. Und sollten alle diejenigen OriginalschauspielerInnen aus der "HdR"-Verfilmung, die auch am "Hobbit" Interesse bekundet haben, Platz finden, müsste del Toro tatsächlich die Zweiteiler-Variante mit eingefügten Episoden aus den Handlungsjahrzehnten zwischen "Hobbit" und "Herr der Ringe" ins Auge fassen: vom Hobbit-Quartett über "Aragorn" bis zu "Saruman" wären fast alle gerne wieder mit von der Partie, die es der Vorlage nach gar nicht sein könnten. - Aber das ist ohnehin nicht der Anlass der aktuellen Neuausgabe von "Der Hobbit": Klett-Cotta feiert das 40-jährige Jubiläum seiner Fantasy-Schiene "Hobbit-Presse" mit dem wohl für alle Zeiten zugkräftigsten Pferd im Stall. John Ronald Reuel Tolkien ist der bedeutendste Fantasyautor überhaupt, heißt es dementsprechend ohne jedes gschamige Understatement im Klappentext.
Ebensowenig wie der Autor bedarf die Geschichte vom Hobbit Bilbo, der aus einem Land, in dem Schilde nur noch zum Wiegen von Kindern und als Topfdeckel benutzt werden, auszog, um den Helden in sich zu entdecken, einer näheren Beschreibung. Kommen wir gleich zum Mehrwert der Neu-Ausgabe: Die liegt in den mittlerweile kanonisch gewordenen Illustrationen Alan Lees. 26 ganzseitige Farbtafeln vom Drachen Smaug bis zur Schlacht der Fünf Heere, dazu noch 41 Schwarzweißzeichnungen im Text. Optisch ist das so-weit-wie-nur-geht entfernt von den Zeichnungen Klaus Ensikats aus der ersten deuschen "Hobbit"-Ausgabe. Und ein weiterer Schritt in die Richtung, den "Hobbit" (das kleine ist ja schon vor langem entfallen) etwas erwachsener zu präsentieren.
Das ist in der Tat begrüßenswert, ändert freilich nichts daran, dass der "Hobbit" eben kein erster Teil einer "Herr der Ringe"-Tetralogie ist, sondern einen ganz anderen Grundton anschlägt. War der "HdR" eine veritable Saga, dann steht der "Hobbit" dem Märchen mindestens ebenso nahe. Nicht nur, weil sich die - durchaus blutige - Handlung ein wenig harmloser gibt und hauptsächlich fröhliche Spottlieder statt elbischer Elegien gesungen werden. Sondern auch aufgrund der Erzählweise: Immer wieder wird das Lesepublikum direkt angesprochen (Stellt euch sein Entsetzen vor!), dazu kommen formelhafte Erzählstrukturen - die gleichzeitig zu den Highlights des Romans zählen: Etwa Bilbos Rätselspiel mit Gollum oder sein späterer Dialog mit dem Drachen - oder Gandalfs gewitzter Abenteuerbericht im Hause Beorns, mit dem er nach und nach die gesamte uneingeladene Zwergenschar in dessen Haus einführt.
Die Übersetzung ist nach wie vor diejenige Wolfgang Kreges aus dem Jahr 1997 mit allen vieldiskutierten Stärken und Schwächen. Lieder und Gedichte sind mit sehr viel mehr Sorgfalt wiedergegeben als in der älteren Übersetzung, zudem ist die Terminologie mit dem "Herrn der Ringe" besser in Einklang gebracht (die 1957er Übersetzung von Walter Scherf setzte unter anderem Elben mit Gnomen gleich ...). Dafür sind einige Modernismen wie kicken oder Chef enthalten - doch darf man nicht vergessen, dass der "Hobbit" einer LeserInnenschaft des mindestens Vierten Zeitalters erzählt wird, das mit Begriffen wie Lokomotive oder Fußball etwas anfangen kann. Gewöhnungsbedürftig ist allenfalls die Anredeform "Sie", die durchgehend statt des altertümelnden "Ihr" verwendet wird, wie sich's viele von einem High Fantasy-Roman vielleicht erwarten würden. Und ob die Trolle, denen Bilbo unterwegs begegnet, nun Bill, Bert & Tom (Scherf) oder Hucki, Toni & Berti (Krege) heißen, spielt auch keine größere Rolle: erinnert in beiden Fällen mehr an ein Schlager-Trio als an die Olog-hai, die später durch den Ringkrieg stampfen werden. Man kann's nicht oft genug sagen: "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" sind zwei verschiedene Paar Stiefel - doch beide auf ihre Art zu Recht in den Kanon der Weltliteratur eingegangen.
... wird interessant sein zu sehen, wie sehr die Verfilmung den Grundunterschieden zwischen "Hobbit" und "HdR" Rechnung tragen wird. In jedem Fall dürfte es sich hier um die in Neueditionen gemessen letzte Chance handeln, sich die Geschichte von Bilbo Beutlin selbst zu visualisieren, ehe Guillermo del Toro es uns besorgt.
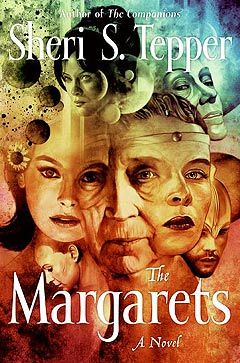
Sheri S. Tepper: "The Margarets"
Broschiert, 528 Seiten, Eos 2008.
So richtig durchgesetzt hat sich Sheri S. Tepper im deutschsprachigen Raum nie. Zwar wurde in den 90ern eine ganze Reihe Romane der Autorin aus New Mexico übersetzt (darunter die hervorragende Trilogie "Monströse Welten"/"The Arbai Trilogy"), danach ist sie aber irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Trotz eines beachtlichen Outputs. Ihr bislang letzter Roman "The Margarets" wartet wieder mit einigen Elementen auf, die typisch für Tepper sind: Von der sorgfältigen Charakterbeschreibung speziell der weiblichen Figuren bis zur ökologischen Botschaft, vom Auftauchen intelligenter Tiere bis zum Erzeugen einer dichten, latent unheimlichen Atmosphäre: Als ob sich die Figuren durch einen Nebel bewegten, aus dem sich die Umrisse dessen, was ihre Welt bestimmt, nur langsam herausschälen.
Vor der eigentlichen Handlung muss man aber erst einmal durch zwei Abschnitte durch: Erstens ein umfangreiches Glossar der handelnden Personen und Schauplätze. Etwas verblüffend darin die Vorab-Charakterisierung ganzer Alienrassen als dirty oder vicious - das klingt mehr nach einem schnell entworfenen Rollenspiel-Szenario als nach einem Roman. Danach ein in seiner Simplizität nicht minder seltsames Vorwort, in dem geschildert wird, wie Erdenmenschen in ferner Vergangenheit als blinde Passagiere eines Alienschiffs auf einen fremden Planeten gelangt sind. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich hier nicht um Teppers Erzählduktus handelt, sondern um den einer Romanfigur - des Gardeners - die die betreffende Episode wiedergibt. Und für die eigentliche Handlung wird diese Episode noch entscheidend sein.
Blende ins 21. Jahrhundert: Das Mädchen Margaret wächst in einer Kolonie im Mars-Orbit auf. Die einengende Umgebung an Bord der Phobos-Station hat zu einer allgemeinen Nur-nirgendwo-anecken-Einstellung geführt; kein Wunder, dass Verstopfung die verbreitetste Krankheit ist. Margaret schafft sich ihre Freiräume im Inneren: In Form imaginärer FreundInnen bzw. Varianten ihrer eigenen Persönlichkeit: Die Königin, die Heilerin, die Spionin, die Schamanin, die Linguistin, der (männliche) Krieger und die Telepathin. Noch leben diese Personae nur in ihrer Vorstellung. Das ändert sich, als die Kolonie aufgelöst wird und Margaret mit ihrer Familie zur überbevölkerten und umweltverseuchten Erde zurückkehren muss. Große Veränderungen drohen: Das irdische Biom steht vor dem endgültigen Kollaps - doch ausschließlich wie eine Rasse mit ihrer Umwelt umgeht, bestimmt, ob man in der Galaxis als (semi-)civilized, barbarians oder gar als animals eingestuft wird. Und "Barbaren" wird kein Selbstbestimmungsrecht zugestanden; im Orbit warten bereits die Schiffe der Handelsbündnisse der Omnionts und der Mercans darauf, die Ressource Erde auszubeuten.
Per Vertrag mit den Außerirdischen werden Massen überzähliger Menschen für 15 Jahre in die Quasi-Sklaverei auf anderen Planeten abgegeben. Während Margaret in der Warteschlange vor dem Weltraumlift auf ihren Abtransport wartet, sieht sie ihr Ebenbild in Richtung eines anderen Raumschiffs verschwinden: Es ist einer von mehreren Wendepunkten in Margarets Leben, an denen eine ihrer Alternativpersönlichkeiten körperliche Gestalt annimmt. Sieben werden es letztlich sein, die auf einem Heptagramm von Planeten sieben parallele und zunehmend miteinander verwobene Lebenswege beschreiten. Tepper schafft damit ein ausgeklügeltes Puzzle, das sich nach und nach zusammensetzt: Motive und Figuren aus dem Leben der einen Margaret tauchen in dem einer anderen ebenfalls auf, eine Gefahr für die Welt der einen hat in der einer anderen ihren Ursprung - und alles läuft letztlich in einer Bedrohung für die gesamte Menschheit zusammen. Spannung bezieht der Roman bis zuletzt aber ebenso sehr aus der Frage, wie real bzw. imaginär die Existenz der verschiedenen Margarets nun wirklich ist.
Als Minuspunkt bleibt die ganze Spezies über einen Kamm scherende Darstellung der "bösen" Aliens - und deren Rachemotiv für den geplanten Genozid an der Menschheit ist, fremdartige Wertvorstellungen hin oder her, letztlich etwas lächerlich. Fast zwangsläufig wird dies zu einer ebenso undifferenzierten (um nicht zu sagen: kitschigen) Problemlösung führen. Und apropos Kitsch: Katzen kommen aus dem Weltraum ... das geht dann doch eher auf einen Anfall von Tanten-Esoterik als auf eine glänzende schriftstellerische Idee zurück; für die Gesamthandlung spielt es allerdings zum Glück keine große Rolle. - Dass unter dem Strich dennoch ein lesenswertes Buch übrig bleibt, liegt einmal mehr an Teppers hohem stilistischem Vermögen. Ein Roman für alle, die gerne mal Science Fiction à la Jo Clayton oder Marion Zimmer-Bradley lesen, in der auch spirituelle bzw. übernatürliche Elemente eine Rolle spielen.

Stephen Hunt: "Das Königreich der Lüfte"
Broschiert, 780 Seiten, € 16,50, Heyne 2009.
Das ist mal definitiv kein Buch, das man sich aufs Nachtkästchen legt und noch gepflegt ein paar Seiten durchblättert, während man schon halb am Wegbüseln ist - genausogut könnte man versuchen auf einen durchrauschenden Intercity aufzuspringen. Atemlosigkeit ist das vorherrschende Tempo in "The Court of the Air", mit dem der in London lebende Autor Stephen Hunt 2007 nach über einem Jahrzehnt zum Langformat zurück gekehrt ist. Und was für ein rauschendes Comeback: Ehe man sich noch an einen irrwitzigen Schauplatz gewöhnt hat, wird man schon in den nächsten geschmissen, im Schnelltakt folgt ein Massaker auf das andere. Ein Wachrüttler-Buch also, keine Einschlafhilfe.
Zur Handlung: Vor dem in jeder Beziehung ausufernden Steampunk-Setting des Königreichs Jackals werden die beiden Hauptfiguren Oliver Brooks und Molly Templar, zwei Teenager kurz vor der Volljährigkeit, aus ihrem bisherigen Leben gerissen. Zwei Gemeinsamkeiten haben sie: Zum einen sind beide Waisen - Molly wird vom Armenhaus der Hauptstadt Middlesteel als Arbeiterin "ausgeliehen" (zuletzt an ein Bordell), Oliver lebt bei seinem Onkel im Städtchen Hundred Locks - und beide müssen erleben, wie alle Menschen in ihrer Umgebung von Unbekannten ermordet werden. Was mit der zweiten Gemeinsamkeit zusammenhängt: In beider Vergangenheit schlummern dunkle Punkte. Wer Molly einst vor der Tür des Waisenhauses abgelegt hat, ist nicht eruierbar - er scheint ihr aber ein seltenes Talent vererbt zu haben. Und Oliver verbrachte als Kind vier Jahre im Irrnebel, einem natürlichen Phänomen, das den davon befallenen Menschen übernatürliche Kräfte verleiht oder/und sie in "Monster" verwandelt, die unbarmherzig weggesperrt werden. In jedem Fall begegnet man ihnen mit größtem Misstrauen. Als Registrierter hätte Oliver also keine strahlende Zukunft zu erwarten - aber das erledigt sich ohnehin, als er die Flucht vor den Mördern antreten muss.
Oliver und Molly fliehen auf getrennten Wegen und begegnen dabei schillernden Charakteren wie dem berüchtigten Stave, einem Agenten des in der Troposphäre schwebenden Wolkenrats, der über Jackals' geheiligten Parlamentarismus wacht, der aber sein eigenes Süppchen zu kochen scheint. Oder dem Groschenheft-Reporter Silas Nickleby und einer Menge Figuren, die glattweg dessen schundigen Publikationen entsprungen sein könnten: etwa die muskelbepackte Archäologin Amelia Harsh, der mechanische Querdenker Kupferspur, die sprechende Waffe Lord Drahtbrand oder der alte Haudegen Kommodore Black. Denn neben Menschen leben auch andere intelligente Spezies in Jackals - darunter die Dampfmänner, autonome "Roboter", die mit Koks befeuert werden und in Sachen Moral und Spiritualität den organischen Weichkörpern weit voraus sind. Dass Jackals unter seiner inneren Vielfalt nicht zusammen bricht, dafür sorgen einerseits die Luftschiffe der Königlich-Aerostatischen Marine und andererseits gelebter Parlamentarismus, der selbst Oliver Cromwell erstaunt hätte: Einen König hält man sich nur, um ihn dem Volk regelmäßig zum Steinigen vorführen zu können; und damit er nicht nach der Macht greifen kann, werden ihm traditionell die Arme abgesägt.
Nun aber geht das ganze System den Bach runter: Ein bestreiktes Viertel wird bombardiert, Gewerkschafter in den Gasminen ermordet und Arbeiter verschleppt, die Flottenoffiziere der Luftmarine werden bei einem Galadiner abgeschlachtet und in den unterirdischen Vierteln Middlesteels breitet sich eine pervertierte Form des Marxismus - pardon: Carlismus - aus, die Menschen zwecks vollendeter Gleichmacherei in hybride Fleischmetaller umwandelt. Und hinter all diesen vermeintlichen Einzelereignissen - die Bluttaten rund um Oliver und Molly inklusive - steckt anscheinend ein einziger großer Plan. Hoffnung, dagegen zu bestehen, wird den ProtagonistInnen nicht einmal von göttlicher Seite gemacht, im Gegenteil: Oliver wird von einem engelhaften Wesen verkündet, dass man im Himmel angesichts der Ausbreitung des Bösen in der Welt längst an deren "Zwangsräumung" denkt - kurz: die Auslöschung allen Lebens, um Platz für einen Neustart zu schaffen. Ein doppelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Mutanten, Magier und Mechanische, industrielle und soziale Revolutionen, übernatürliche Wesen und physikalisch unmögliche Ereignisse (wie die Schwebbeben, bei denen Stücke aus der Erdkurste brechen und mit allem, was darauf lebt, in die Atmosphäre entschweben): Der Mix erinnert stark an China Mievilles "New Crobuzon"-Romane, mag Hunt auch nicht ganz an dessen sprachliche Wucht und politische Schärfe herankommen. Auch trägt Jackals - siehe die starke Betonung des Parlamentarismus oder die zahlreichen Anspielungen an Charles Dickens - viel deutlicher erkennbare Züge des Viktorianischen England als New Crobuzon. Und dennoch: Sollte Hunt jemals ernstlich behaupten, er hätte sich von Mieville nicht inspirieren lassen, müsste er sich hinterher den Mund mit Kernseife auswaschen. Andererseits: Wen juckt's. Angesichts all der verkappten Mittelerden, Ozeaniens und Sternenföderationen ist das nicht die abgewetzteste Kulisse. Da kann sich ruhig noch der eine oder andere Autor mehr drin austoben - vorausgesetzt er liefert eine ähnlich rasante Erzählung ab wie diese, auf die im Herbst übrigens mit "Das Königreich jenseits der Wellen" schon die nächste folgt. Mit Amelia Harsh als neuer Hauptfigur. Ein Knaller!
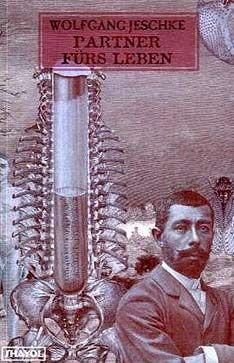
Wolfgang Jeschke: "Partner fürs Leben"
Broschiert, 192 Seiten, € 17,40, Shayol 2008.
Sieben Erzählungen von Herausgeberlegende und Nebenerwerbsschriftsteller Wolfgang Jeschke sind in dieser Sammlung enthalten - mehr als die Hälfte des Volumens entfällt allerdings, zum Glück, auf die wunderbare Novelle "Meamones Auge" aus dem Jahr 1992. Schauplatz des Geschehens sind zwei Monde eines Riesenplaneten, die diesen auf nahezu derselben Bahn umkreisen: Confringet ist von menschlichen Siedlern bewohnt, Conteret dient als Anbaufläche für Genetically Originated Devices, kurz GODS. Mit Ackerbau und Viehzucht im klassischen Sinne hält man sich in der Fernzukunft nämlich nicht mehr auf - statt dessen werden ganze Ökosets aus dem Boden gestampft, um das benötigte Nahrungsprotein zu gewinnen. Konzerne mit durchaus bekannten Namen (Sandoz, Bayer, Dow ...) erschaffen komplette künstliche Nahrungsketten und setzen sie im gewählten Biotop aus: Jedem Glied der Kette werden dafür exakte genetische Befehle in die DNA eingebaut, wann Zeit zu fressen ist - und wann es sich dem nächsthöheren Räuber vors Maul zu werfen hat. Die höchstentwickelten Organismen schließlich werden von den menschlichen Erntemannschaften eingesackt.
Jeschke führt damit die Ineffizienz unserer Fleischwirtschaft (immerhin gibt es genug Studien zum Beleg, wie viele Pflanzen weniger wir anbauen müssten, wenn wir vegetarisch lebten) bis ins letzte Extrem weiter. Dass die Chimärendesigner der Konzerne auch menschliche DNA verarbeiten, ist auf Confringet allgemein bekannt und bekümmert niemanden. Ebensowenig wie die Tatsache, dass die höchstentwickelten GODS auf Conteret einen IQ von 150 haben sowie ein eigenes Geschichtsbewusstsein und Religion entwickeln. Philosofaseleien nennt es einer der Adeligen von Confringet verächtlich, und überhaupt: Ist doch praktisch - glauben sie erst an einen Messias, kann man sie umso leichter dem Leben nach dem Tod zuführen ... - Abwechselnd erzählt aus den Perspektiven der menschlichen BewohnerInnen des Systems und ihrer künstlichen Schöpfungen, setzt sich "Meamones Auge" zu einem grausigen Mosaik zusammen. Und dennoch kann man den unbarmherzigen Abläufen in einem durchdesignten Ökosystem, das nichts dem Zufall überlässt, eine schreckliche Schönheit nicht absprechen.
In der Science Fantasy angesiedelt ist "Das Geschmeide", das aber vor einem ähnlichen Hintergrund spielt wie "Meamones Auge": Waren es auf Confringet die Nachkommen von MalteserInnen, so gleiten hier französischstämmige Menschen in Windbarken durch die Luftozeane des Planeten Cartesius, den man sich mit einer einheimischen Kultur teilt. Wiedergutmachung für einen Diebstahl führt die Protagonisten hinauf zu einem Bergkloster der Indigenen, welches sich als tief mit deren 100.000 Jahre alter Kultur verwobener Organismus entpuppt. - Down-to-Earth im Vergleich dazu die titelgebende Geschichte "Partner fürs Leben" über einen zynischen Creutzfeldt-Jakob-Patienten, der mit den Organen seines "Partners" - eines armen Schluckers irgendwo in Asien - versorgt wird. Langsam gleitet dabei seine Ich-Perspektive in die seines Spenders hinüber.
Es sind auch einige kürzere Erzählungen mit geringem Wow!-Faktor enthalten - allen voran das wohl satirisch gemeinte "post-OP" über jemand, der in einem Krankenhaus aufwacht, in dem einfach keine Deutschen aufzutreiben sind. Schön daher, dass allen Erzählungen ein Kommentar Jeschkes zur jeweiligen Entstehungsgeschichte hinzugefügt wurde - das rückt manche Erzählung in ein neues Licht und zeigt einmal mehr, in welch unerwarteten Nischen ein SF-Autor Platz finden kann: "post-OP" ging an den in Berlin lebenden US-Journalisten Eric T. Hansen, der mit großer Liebe zu seinem Gastland über Deutschland-Klischees publiziert. "Lucia" war Jeschkes Beitrag zu einer Anthologie eines Materialforschungsunternehmens(!), "Der Geheimsekretär" schließlich eine Silvestergeschichte für die Millenniumsausgabe einer Schweizer Zeitung. Jeschkes darin präsentierte Lösung für alle dringenden Schweizer Probleme: Antigravitationstechnologie, der Hub.
Alles in allem ein lohnender Kauf, alleine schon wegen "Meamones Auge". Ein weiterer Band der Werkausgaben Wolfgang Jeschkes wurde bei Shayol ebenfalls herausgegeben: "Der Zeiter" erschien bereits 2006.
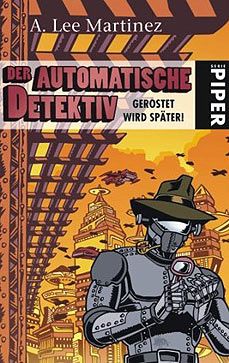
A. Lee Martinez: "Der automatische Detektiv"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Piper 2009.
Der Texaner A. Lee Martinez hat sich darauf spezialisiert Genres und ihre Klischees durch den Kakao zu ziehen - siehe "Diner des Grauens" und "Die Kompanie der Oger". Für "The Automatic Detective" hat er sich gleich zwei vorgenommen: die Science Fiction und den Detektivroman der 40er und 50er Jahre - und letzteres spielt sowohl für das Setting als auch für die Charakterisierung der Haupt- und Nebenfiguren eine entscheidende Rolle.
Mack Megaton ist der klassische Fall von harte Schale, weicher Kern - viel härter könnte die Schale auch gar nicht sein, immerhin handelt es sich bei Mack um einen ehemaligen Kampfroboter, der nun als Taxifahrer seine Stromrechnung finanziert. Die haarsträubenden Auswüchse seiner Umwelt - Empire City, die Stadt, die niemals funktioniert - betrachtet Mack durch eine sichere Sarkasmus-Linse. Aber natürlich sitzt bei ihm die Energiezelle am rechten Fleck, und als seine mutierten Nachbarskinder entführt werden - eines geschuppt und geschwänzt, eines hellseherisch begabt, aber beide allerliebst -, muss er sich endgültig seiner Sentimentalität ergeben. Der Taxifahrer wird zum Detektiv.
Trotz eines Freier-Wille-Glitch, der Mack die künftige Anerkennung als vollwertiger Bürger einbringen dürfte, ist es um Macks soziale Kompetenz noch nicht allzu üppig bestellt: Sein bester (und einziger) Freund ist ein Jane Austen lesender Gorilla, und als der eiserne Junggeselle im Zuge seiner Ermittlungen auf das Partygirl Lucia Napier trifft, bringt diese seine Schaltkreise gehörig durcheinander. Erst recht, als er feststellen muss, dass sie nicht einfach die Paris Hilton von Empire City ist, sondern eine hochintelligente Roboter-Konstrukteurin; und technophil obendrein. Love interest-Alarm ist angesagt, auch wenn noch in den romantischsten Szenen Macks eingebaute Uhr unbeirrt weiter tickt: Sie bewundern gemeinsam die schöne Aussicht (70 Sekunden), sie umarmt ihn (130 Sekunden) ... und wen das schon an "Futurama" erinnert, der wird sich durch die ganz alltäglichen Phänomene im chaotischen Empire City in seinem Eindruck bestätigt sehen: Durch die Luft und über den Boden flitzen hunderterlei abstruse Verkehrsmittel, im heruntergekommenen Viertel Warpsville sorgen Fässer mit radioaktivem Abfall für strahlende Straßenbeleuchtung und regelmäßig lässt giftiger Regen spontane Mutationen ins Kraut schießen. Wundere sich keiner, wenn er nach einem Regentag ganzkörperbehaart der Dusche entsteigt ...
Der auch als Hörspiel erhältliche Roman erweckt den Eindruck, als hätte er schon vor 50 Jahren geschrieben worden sein können - allerdings wird schnell klar, dass Martinez dies ganz bewusst so angelegt hat, um mit "zeitgemäßen" Versatzstücken spielen zu können: Jazz ist das neue heiße Ding in Empire City, und durch die halblegalen Clubs, in denen er gespielt wird, spazieren noch echte Zigarettenmädchen. Mack trägt Trenchcoat und Krawatte - wenn er nicht gerade bei seiner Psychotherapeutin auf der Couch liegt (Psychoanalyse als Motiv ist heute vielleicht ein wenig aus der Mode gekommen, war aber um die Jahrhundertmitte ein recht beliebtes Thema - siehe etwa Philip K. Dicks "Simulacra"). Ganz besonders aber merkt man das rekonstruierte Zeitkolorit an der Zeichnung der Charaktere: Jeder Mann ist ein harter Kerl. Und jede Frau gibt sich wimpernklimpernd kokett - unabhängig von ihrem IQ, Beruf, ihrer Spezies ... oder ob sie aussieht wie das Monster aus der Schwarzen Lagune. Guys and Dolls eben. Schweren Tiefgang hat das Ganze naturgemäß nicht, aber Spaß macht es allemal.

Christian Kracht: "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten"
Gebundene Ausgabe, 148 Seiten, € 17,50, Kiepenheuer & Witsch 2008.
Kiepenheuer & Witsch also wieder - derselbe Verlag, der im vergangenen Jahr Michael Chabons "Die Vereinigung jiddischer Polizisten" auf Deutsch herausbrachte, hat kurz danach einen weiteren Alternativweltroman veröffentlicht. Wieder von einem Autor, der ursprünglich nicht aus der Phantastik kommt, dem Abgrenzungen aber offenbar schnuppe sind. Und wieder führte das in der Literaturkritik zum erwartbaren Zirkus aus Verrenkungen, (Genre-)Wortvermeidungen und Rätselei über das Motiv für den Roman; mehrheitlich scheint man/frau sich im Feuilleton diesmal mit Nicht-Gefallen abgesichert zu haben.
Handlungsprämisse ist letztlich eine Naturkatastrophe, wie sie in dieser Form in unserer Welt nicht eingetreten ist: 1908 fackelte der Tunguska-Meteorit nicht nur einige sibirische Wälder ab, sondern verseuchte ganz Russland mit seinem Fallout. Wenig Anreiz also für Lenin, 1917 aus dem Schweizer Exil in seine Heimat zurückzukehren - statt dessen startete er die Revolution in seinem Gastland. Kracht verweist im Lauf des Textes auf einige reale Episoden der Schweizer Geschichte, die deren durchaus revolutionäres Potenzial unterstreichen und das Entstehen der Schweizer Sowjetrepublik als nicht gar so abwegig erscheinen lassen, wie der Gedanke auf den ersten Blick scheint. Allerdings ist die Entwicklung mittlerweile ausgeufert: Die SSR umfasst den gesamten Alpenraum bis hinüber nach Triest und befindet sich in einem Dauerkrieg mit der faschistischen Allianz aus Deutschland und England. 96 Jahre hält dieser Krieg inzwischen an - niemand lebt mehr, der sich noch an Friedenszeiten erinnern könnte.
Kracht zeichnet das Bild einer aus dem Ruder gelaufenen Welt. Unvertraut sind nur die globalen Akteure: Während sich die Amexikaner vom Rest der Welt abgeschottet haben, sind Mächte wie das Großaustralische Reich oder Korea auf den Plan getreten, an die Türen Europas klopfen die Sinti-Reiterarmeen Hindustans. Bekannt wirken hingegen die Auswirkungen des Großmächtekonflikts: Die SSR hat die alten Kolonialherren aus Ostafrika vertrieben und die Region mit einer europäischen Infrastruktur versorgt; goldene Dörfer und goldene Städte sollten gebaut und die Bevölkerung im Sinne des revolutionären Gleichheitsgedankens erzogen werden. Gleichheit bedeutet aber auch, dass die dortige Bevölkerung für die nicht enden wollenden Kriege der Schweiz rekrutiert wird. Das Spannungsfeld drückt sich in zwei kurz aufeinander folgenden Sätzen über das politische Selbstverständnis der Eidgenossen aus: Die Stärke der SSR war ihre Menschlichkeit, eine Seite weiter: Er war der Sinn und Zweck unseres Lebens, dieser Krieg.
Eingezogen wurde einst auch der Protagonist des Romans: "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" folgt ihm, einem Parteikommissär, zunächst auf seiner winterlichen Wanderung durchs gerade erst von Deutschland zurückeroberte Neu-Bern. Der zunehmend traumartige Trip, vom ehemaligen Pop-Literaten Kracht in kurzen, eindringlichen Impressionen geschildert, zieht räumlich und zeitlich immer weitere Kreise und führt schließlich in die surreale Welt des Réduit: Ein gigantisches Netzwerk unterirdischer Stollen und Festungsanlagen, die die gesamte Großschweiz umgeben und in der sich eine dekadente Parallelgesellschaft entwickelt hat. Wie ein fleischgewordenes Gegenstatement zum Schlagwort vom Krieg als "Vater aller Dinge" gibt es keine Weiterentwicklung mehr, es herrschen Stillstand und Verfall.
Teilweise macht der Roman einen hermetischen Eindruck, nicht alles wird aufgeklärt (etwa warum Menschen Steckdosen in ihre Körper implantiert haben ...) - und doch bleibt alles in seiner Bildwirkung stimmig. "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" ist ein ebenso ernüchternder wie glänzend geschriebener Abgesang auf politische Utopien und missionarische Zivilisationsentwürfe

David Grashoff (Hrsg.): "Disturbania"
Broschiert, 224 Seiten, € 13,30, Atlantis 2008.
Alle bislang hier besprochenen Anthologien waren entweder englischsprachige oder sind bei Kleinverlagen erschienen - in diesem Fall hat sich das Haus Atlantis des Formats angenommen, das die großen Verlage nur noch als Kassengift zu betrachten scheinen. 17 Kurzgeschichten von Science Fiction über Urban Fantasy bis zum Horror, fast ausschließlich von deutschsprachigen AutorInnen, sind enthalten. Großstadmoloche lautet das Generalthema - wobei viele Erzählungen aber relativ frei mit der Vorgabe eines städtischen Settings umgehen. Unter den bekannteren Namen finden sich "Trolle"-Autor Christoph Hardebusch mit der recht durchschnittlichen und an "Twilight Zone" erinnernden Episode "Zeitenwechsel" und Christoph Marzi, der hier in zweifach untypischer Form vertreten ist: Zum einen mit dem Gedicht "Die träumende Stadt", zum anderen als Übersetzer für die Geschichte "Tranquil Gardens" der Autorin Aino Laos über eine von Androiden in Schuss gehaltene Neubausiedlung für glückliche Jungfamilien.
Vom Aufbau am interessantesten sind zwei Erzählungen, die sich jeweils zu einem Moebius-Band winden: Fabian Mauruschats "Sendedurchlauf" über einen Serienkiller auf selbsternannter kultureller Mission und Oliver Plaschkas "Solets Stimme", das außerdem stilistisch um einiges geglückter ist: Auf einer zukünftigen Erde, die es sich als schwächerer Partner einer interplanetaren Freihandelszone gefallen lassen muss ausgeplündert zu werden, wird der Protagonist von einer Stimme aus dem Nirgendwo verfolgt. Nicht nur die Stimme, sondern auch ein Hauch von James Tiptree, Jr. liegt da in der Luft - vielleicht folgt irgendwann mal eine längere Fassung, Ideen wären da.
Begegnungen der faustischen Art haben die Hauptfiguren in den Richtung Horror gehenden Erzählungen: Sei es mit einem höchst belesenen Muskelprotz, der im Fitnesscenter "unkonventionelle" Lösungen für zwischenmenschliche Probleme anbietet ("Sportsfreund" von Torsten Sträter), dem freundlichen kleinen Herrn Ephraim Rabe, der einen frisch Ermordeten mit seinem Gerede über böse Wesen in der Nacht einlullt ("Seelenlos" von Herausgeber David Grashoff) - oder mit Feuerwehrmann George, der in einem brennenden Haus auf jemanden trifft, der sich dort buchstäblich wie in seinem Element fühlt ("Feuerteufel" von Christian Endres). Erwähnenswert auch "Hand drauf!" von André Wiesler über Juraj, Versorger einer dreiköpfigen Familie - eine handlose Familie zwar, aber glücklich - und sein blutiges Tage- bzw. Nächtewerk. Stilistische oder inhaltliche Revolutionen bietet allerdings keine der Geschichten.
Tobias Bachmann hat die Vorgabe vom Großstadtmoloch in Form der zwischen Moderne und 30er-Jahre-Düsterexpressionismus angesiedelten Stadt Sagunth am ernstesten genommen. Allerdings verstört er mit seinem Gothic-Plot über einen misanthropischen Killer kaum mehr als mit einer Amok laufenden Beistrichsetzung - das geht auch über das Maß hinaus, das man Kleinverlagen in Sachen Lektorat eher zugesteht als den großen, vollausgestatteten Konkurrenzhäusern. Gelungener ist da schon Michael Schmidts "Oststadt-Silbermond", das vor einem ähnlich zeitlosen Setting die Balance hält, verschiedenste Motive anzureißen und nicht allzuviel zu erklären. Ein Positivum noch zum Schluss: "Menschenmüll" von Marcus Richter entfaltet sich als seltsames Märchen von einem magischen Wesen, das aus Abfällen entsteht und mit den Illusionen, die es aus seiner Substanz erschafft, Menschen wie eine fleischfressende Pflanze in sein Inneres lockt. Seltsam deshalb, weil am Ende offen bleibt, ob nun etwas Böses zerstört oder etwas Wunderbares verloren wurde.
Viele der Erzählungen sind nur um die zehn Seiten lang - und weil man ohnehin nie mehr als eine oder zwei Kurzgeschichten auf einmal lesen sollte, legt man sich das Ganze am besten aufs Nachtkästchen, um zwei Wochen lang den Tag mit einer Bösenachtgeschichte zu beschließen.
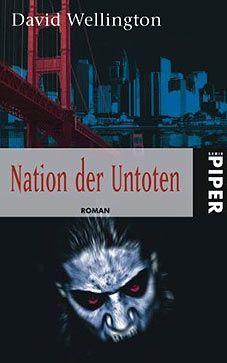
David Wellington: "Nation der Untoten"
Broschiert, 382 Seiten, € 9,20, Piper 2009.
Pfiffig gemacht von David Wellington, Teil 2 seiner "Monster Trilogy" als Prequel anzulegen. Da derzeit reichlich Zombie-Romane auf dem Markt sind und sich die Plots zwangsläufig ähneln, umging der US-Autor unerwünschte Déjà vu-Effekte mit einem Teil 1 ("Stadt der Untoten", hier der Rückblick), in dem die Zombieseuche den Planeten längst überrannt hat und die Handlung sich vor diesem neuen Status quo anderen Aspekten widmen kann. Doch wer Teil 1 gelesen hat und durch Wellingtons Schreibstil auf den Leichengeschmack gekommen ist, der wird nun auch geneigt sein, sich rückwirkend die bekannten Topoi von ersten unerklärlichen Attacken, militärischen Abwehrmaßnahmen und unaufhaltsamer Ausbreitung der Epidemie zu Gemüte zu führen. Darauf wird sich "Nation der Untoten" aber, soviel sei gleich zu Beginn gesagt, nicht beschränken. Und dass Wellington Wert auf Abgrenzung legt, illustriert auch ein Running Gag, der sich durchs ganze Buch zieht: Das "Z"-Wort wird nämlich tunlichst vermieden - statt dessen ist von Toten, Untoten oder gar Ghuls die Rede - und als es einmal in einem Funkgespräch doch fallen will, wird der Kontakt nach dem dritten Buchstaben schleunigst abgewürgt.
"Nation der Untoten" ("Monster Nation") fokussiert auf drei Personen: Der 61-jährige Captain Bannerman Clark von der Nationalgarde Colorados wird mit einem kannibalistischen Aufstand im Hochsicherheitsgefängnis "Supermax" konfrontiert - einem der ersten bekannt werdenden Fälle der heraufziehenden Epidemie. Clark und seine Suche nach dem "Patient Zero" stehen stellvertretend für die Anstrengungen zur Eindämmung der Katastrophe. - Dick Walters von der Nationalen Gesundheitsbehörde hingegen, der Hinweisen auf eine neue Nutztierseuche nachgeht, wird per Biss für die Gegenseite rekrutiert ... und spielt im Folgenden eine ebenso makabre wie schlagkräftige Rolle.
Die zentrale Figur aber ist "Nilla" - jene junge Yoga-Lehrerin, die bereits in Teil 1 kurz erwähnt wurde: Schon zu Beginn der Romanhandlung infiziert, hat sie ihr Gedächtnis verloren und befindet sich in einem eigenartigen geistigen Schwebezustand. Wie der dämonische Gary in Teil 1 konnte sie durch eine glückliche Fügung ihr Gehirn vor dem Verfall bewahren und damit dem Schicksal entgehen, zum geistlosen Durchschnittszombie abzusinken. Was ihr nicht zuletzt den fundamentalen Konflikt zwischen dem Dauerhunger ihrer neuen Existenzform und ihrem freundlichen Grundcharakter einbrockt. Während die Ausbreitung der Seuche über die USA anhand von Newsflashes und Splittereindrücken (schön das Graffito Jesus kommt und frisst dein Bein) gleichsam als Hintergrundrauschen abläuft, macht Nillas Odyssee die eigentliche Handlung des Romans aus. Und die Frage, für welche Seite Nilla sich letztlich entscheiden wird, den Dreh- und Angelpunkt. Freier Wille versus Bestimmung: eine durchaus ungewöhnliche Verquickung mit der Zombie-Thematik, von der sich Wellington aber ohnehin immer weiter entfernt.
"Nation der Untoten" liefert eine Reihe weiterer Hinweise auf den Hintergrund der Seuche, in dem sowohl wissenschaftliche als auch übernatürliche Faktoren eine Rolle spielen. Nilla sieht Lebende und Tote von goldener respektive schwarzer Energie durchflutet - und sie begegnet auch dem wiederauferstandenen keltischen Druiden Mael, der schon in Teil 1 seinen Auftritt hatte und der Nilla noch mehr im Nacken sitzt als seinerzeit Gary. Selbstgefällig verkündet der bronzezeitliche Hassprediger alte Zöpfe von der Schlechtigkeit der modernen Welt und wie die Erde vom Menschen "gereinigt" werden müsse ... und sollte er Nilla nicht überzeugen, hat er ja immer noch ein Eisen im Feuer: Das wird in jedem Fall im abschließenden Teil 3, der zwölf Jahre nach den bisherigen Geschehnissen spielt, gezückt.
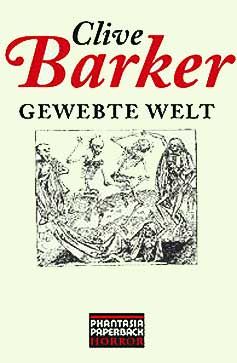
Clive Barker: "Gewebte Welt"
Broschiert, 686 Seiten, € 23,60, Edition Phantasia 2008.
1987 geschrieben und 1992 mysteriöserweise unter dem Titel "Gyre" zum ersten mal auf Deutsch erschienen, stammt "Weaveworld" aus Clive Barkers bester und produktivster Phase. Unglaublich, was der Engländer zwischen 1984 und 1990 alles veröffentlicht hat: Von den "Books of Blood" über "Damnation Game" und die "Hellraiser"-Vorlage bis zu "Cabal" und "The Great and Secret Show". Knapp zwei Jahrzehnte später ist "Weaveworld" unter passenderem Titel und in überarbeiteter Übersetzung noch einmal herausgegeben worden - unter Barkers guten Romanen einer der allerbesten und eine unbedingte Empfehlung.
Viel zufälliger als der 26-jährige Versicherungsangestellte Cal Mooney aus Liverpool kann man nicht aus seinem Alltag gerissen und in eine neue Welt eingeführt werden: Auf der Jagd nach einer entflogenen Zuchttaube stürzt er von einem Haus auf einen ausgebleichten Teppich, den Möbelpacker im Hof ausgebreitet haben - und erhascht damit einen ersten Blick auf die Fuge. - Ich habe das Wunderland gesehen, wird ihm danach nicht mehr aus dem Kopf gehen, und Cal setzt alles daran die Fuge wiederzusehen. Zu ihm stößt Suzanna Parrish, die als Enkelin der letzten Bewahrerin des Teppichs ein unerwartet verantwortungsvolles Erbe antreten muss. Denn die Fuge ist das letzte Rückzugsgebiet eines zauberisch begabten Teilzweigs der Menschheit, des Sehervolks: Von Grund auf anarchisch und den regelsüchtigen Menschen - die sie verächtlich Cuckoos nennen - misstrauend, lebten sie über die Jahrtausende hinweg an den Rändern der Gesellschaft, bis sie im Jahr 1896 ihre letzte Fluchtmöglichkeit antraten und die Fuge schufen: Ein wildes Sammelsurium aus den Resten ihrer einstigen Heimatgebiete, durch Magie zu einer chaotisch-paradiesischen Einheit verwoben, deren Ankerpunkt in der Realität Suzannas Teppich ist.
Unversehens werden die Seher aus ihrem fast 100-jährigen Schlaf gerissen, als der Teppich in unbefugte Hände gerät: Die Renegatin Immacolata hat den Sehern Rache geschworen, nachdem diese ihren Herrschaftsanspruch ablehnten. Gemeinsam mit dem raffgierigen Händler Shadwell - einem Menschen - und einigen nicht-menschlichen Geschöpfen von erlesener Widerwärtigkeit macht sie sich an die Vernichtung der Fuge. Cal und Suzanna stellen sich ihnen entgegen und werden dabei mit einem neuen Feind konfrontiert: dem faschistoiden Polizisten Hobart, der mit Shadwell eine verheerende Allianz eingeht. Und den Sehern steht nicht nur ein gezielt eingesetzter heiliger Krieg bevor - auch die Geißel, jenes übernatürliche Wesen, vor dessen Vernichtungsfeldzug sie sich ursprünglich in die Fuge geflüchtet haben, wird neuerlich heraufbeschworen.
"Weaveworld" bietet Barker at his best: Dessen Ursprünge im Horror klingen noch in zahlreichen blutigen Szenen nach - zugleich war der Roman ein erster großer Schritt in Richtung Fantasy. "Weaveworld" ist aber noch deutlich kompakter als das spätere Opus magnum "Imajica", das neben aller Größe eben auch die typischen Schwächen des Breitwand-Formats zeigt. Und wie im handlungsbezogen fast parallelen "Cabal" und auch schon in einigen Geschichten der "Books of Blood" geht es um eine faszinierende Subkultur, die sich in den Zwischenräumen der Mainstreamgesellschaft verbirgt. (Nebenbei gesagt war es spannend zu sehen, wie viele überraschte Reaktionen Barkers Coming-out in den 90ern hervorrief ...) Und auch wenn im Hintergrund eine höllische/himmlische Entität wie die Geißel schwebt - wie in "Cabal" geht auch hier die eigentliche Gefahr von Menschen aus: In Umkehrung der üblichen Horror-Prämisse bringt nicht das Eindringen der übernatürlichen Welt in die unsere das Verhängnis über uns - die Bedrohung sind wir.
Wie schon gesagt: eine unbedingte Empfehlung!
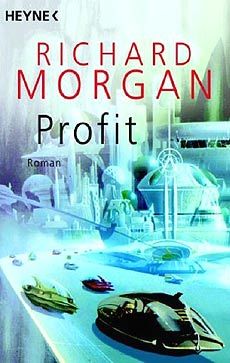
Richard Morgan: "Profit"
Broschiert, 574 Seiten, € 9,20, Heyne 2006.
Ein Nachtrag aus doppeltem Grund: Zum einen deshalb, weil "Profit" (im Original: "Market Forces") angesichts der allseits beliebten Takeshi Kovacs-Romane von Richard Morgan ein wenig untergegangen ist. Hauptsächlich natürlich aber, weil uns die Folgen des untherapierten Wirtschaftswahnsinns seit Monaten in Atem halten - da bietet sich die Morgansche Weiterdenkung als Lesestoff einfach an.
Mitte des 21. Jahrhunderts hat die globalisierte Gesellschaft eine Reihe von Domino-Rezessionen überstanden und ist endgültig in zwei Teile zerfallen: Die Konzernwelt der Anzugträger, die sich von politischer Kontrolle losgelöst hat und nicht nur ihr eigenes System reguliert, sondern auch die Vorgänge auf der internationalen Bühne bestimmt; Staaten als Akteure haben weitgehend ausgedient. Der zweite, wesentlich größere, Teil der Welt ist der der Verlierer: Wo es weder Autos noch ein ausreichendes Gesundheitssystem gibt - und schon gar keine Möglichkeit zu politischer Partizipation. Gezielt aufrecht erhaltene Armut und Ungebildetheit garantieren eine ungebrochene Versorgung des Systems mit billiger Arbeitskraft, Abnahmemärkte für Nahrungsmittelüberschüsse und das Ausbleiben von Widerstand gegen die Auslagerung von Giftmüll. "Glauben Sie wirklich, wir könnten es uns leisten, dass die Entwicklungsländer sich entwickeln?", verfällt Morgan aus dem Mund eines Managers mal kurz ins Predigen. - Soweit ist das alles ja noch gar nicht vom Heute entfernt. Nur dass in "Profit" die Dritte Welt mittlerweile vor der Haustür liegt, in Form der verelendeten Zonen, die in neoliberalen Ländern wie Großbritannien die abgesicherten Glaspaläste der Manager umschließen.
Zum Ausgleich für solche Pamphlet-artige Kritik am real existierenden Weltwirtschaftssystem hat sich Morgan eine wegen ihres Trash-Charakters geniale Illustration für die Brutalisierung der Manager-Welt einfallen lassen: Steht eine Ausschreibung für eine Beförderung oder einen neuen Etat an, liefern sich die Konkurrenten auf den weitgehend leeren Straßen "Mad Max"-artige Autoduelle mit tödlichem Ausgang. Chris Faulkner, Hauptfigur des Romans, kann dabei von dem Vorteil zehren, dass ihm seine Frau Carla, eine Mechanikerin, einen nahezu unverwüstlichen Saab-Spezial zurechtfrisiert hat. Für den Nahkampf wird ihm von seinem Unternehmen eine Handfeuerwaffe zur Verfügung gestellt - die allerdings auch zum Einsatz kommt, als Chris sich mit seinem Kumpel Mike Bryant - ganz "privat" - auf einen blutigen Rachefeldzug durch die Zonen begibt; "American Psycho" lässt grüßen.
"Profit" lebt, abgesehen vom ökonomischen Horrorszenario, von der Bruchlinie, die sich durch Chris' Psyche zieht. Er ist selbst in einer der Zonen aufgewachsen - nun wird er zum heißen neuen Aufsteiger im Konzern Shorn Associates, der auf Conflict Investment setzt: Shorn beliefert die Kontrahenten der unzähligen regionalen Konflikte des 21. Jahrhunderts mit Waffen und Infrastruktur - weltanschauliche Erwägungen spielen dabei keine Rolle. Man setzt auf den jeweils aussichtsreichsten Kandidaten, der im Gegenzug einen Anteil am BIP seines Landes garantiert. Kleine Kriege! lautet der traditionelle Trinkspruch bei Shorn, und das ist nicht einmal mehr zynisch. - Auf der anderen Seite wird Chris von seiner Frau dazu gedrängt auszusteigen und zu den Ombudsmännern der UNO zu wechseln - auch wenn diese weitestgehend machtlos ist und nur noch von wenigen sozialstaatlichen Relikten wie Skandinavien und Kanada getragen wird. Als Chris auch noch von einem seiner Kunden, dem Guerilla-Führer Barranco aus der North Andean Monitored Economy ("Kolumbien" sagt niemand mehr), attestiert wird, er habe in sich etwas Ehrenwertes, explodiert der lange schwelende seelische Konflikt endgültig an die Oberfläche.
Nachdem sich heute die gesamte Welt endlich in die Richtung dreht, die Milton Friedman sich immer gewünscht hat, sehen wir spätestens seit letztem Jahr auch, wohin sie sich dabei dreht. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das große Umdenken einsetzt und Morgans Vision im Nachhinein als gruseliges Exotikum dastehen wird ... oder ob wir nur gerade in die Phase der Domino-Rezessionen eintreten. Der Epitaph über einer solchen Entwicklung kommt in "Profit" schon früh in Form einer launigen Firmenansprache: "Man hat es als riskant bezeichnet, man hat es als unpraktikabel bezeichnet, und man hat es als unmoralisch bezeichnet. Kurzum, es machen sich immer wieder die gleichen, ewig nörgelnden Stimmen vernehmlich, die die freie Marktwirtschaft zeit ihres Bestehens hat mit sich herumschleppen müssen. Aber wir haben gelernt, solche Stimmen zu ignorieren."
... soviel zu den Auswüchsen des Westens (oder genauer gesagt eigentlich Nordens) - beim nächsten Mal wird es zum Ausgleich in den Wilden Osten gehen. (Josefson)