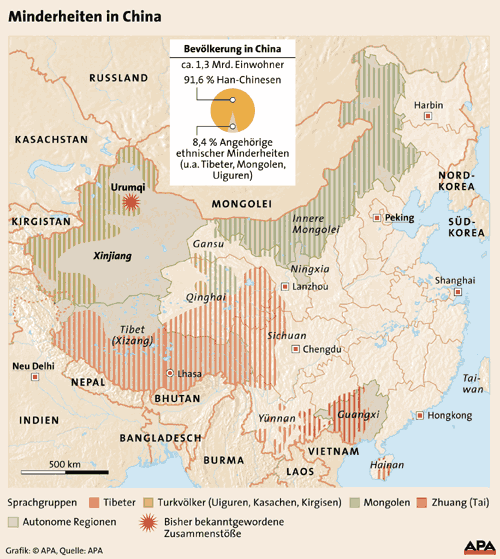
Peking/Wien - In China leben 56 anerkannte nationale Minderheiten, die laut amtlichen Angaben zusammen 8,4 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. 91,6 Prozent sind Han-Chinesen (Volkszählung 2005). Bei der in den frühen 1950er Jahren vorgenommenen Klassifizierung der zu zwölf Sprachfamilien gehörenden "Nationalitäten" (shaoshu minzu) orientierte man sich an den in der Sowjetunion unter Stalin entwickelten Kriterien. Von den zahlenmäßig größten Minoritäten mit stark religiös geprägter Identität sind die Mongolen, die Tibeter und das muslimische Turkvolk der Uiguren historisch und kulturell eigenständige Nationen. Die Entladung antichinesischer Ressentiments wie zuletzt in Tibet und Xinjiang war immer dann besonders explosiv, wenn sich das Streben nach Selbstbestimmung mit religiösen Momenten verband.
Nach der kommunistischen Machtübernahme und der Errichtung der Volksrepublik China 1949 wurden in den nordwestlichen und südwestlichen Randgebieten fünf sogenannte Autonome Regionen auf Provinzebene geschaffen: die Innere Mongolei, Xinjiang (Sinkiang) für die uigurische Nationalität Ostturkestans, Guangxi für die weitgehend assimilierte Zhuang-Nationalität, Ningxia für die muslimische Hui-Nationalität und Tibet (Xizang). Die autonomen Regionen gehören zu den Armenhäusern und Konfliktherden Chinas. Separatistische Rebellionen wurden mehrfach militärisch niedergeschlagen.
Die geltende Verfassung von 1982 definiert China als "multinationalen Einheitsstaat", die autonomen Regionen sind "untrennbare und unveräußerliche" Teile der Volksrepublik. Auf dem Papier räumt das 1984 erlassene Gesetz über die regionale Autonomie den nationalen Minderheiten umfangreiche Freiheiten ein. Doch wegen des Fehlens eines unabhängigen Rechtssystems hängt die Durchsetzbarkeit der Autonomiebefugnisse gänzlich von der Parteilinie ab, die auf Nivellierung ethnischer Unterschiede abzielt. So haben die regionalen Selbstverwaltungsorgane keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Massenansiedlung von Han-Chinesen. Die Pekinger Zentrale misstraut nichtchinesischen Kadern, die regionalen Parteichefs sind ausnahmslos Han-Chinesen.
Das alte kaiserliche China verstand sich als kultureller Mittelpunkt der Welt, die Herrscher anderer Völker galten als tributpflichtige Vasallen. Ein Ziel der konfuzianischen Staatsdoktrin war die gewaltfreie Assimilierung der nichtchinesischen Völker nach dem Verwandtschaftsprinzip: Von den "Kindern" werden Respekt und Loyalität gegenüber dem "erziehenden" Vater und der Gesamtfamilie erwartet. Ihr historisch-materialistisches Weltbild stellte für die chinesischen Kommunisten kein Hindernis dar, an die traditionellen Vorstellungen anzuknüpfen. Mit der marxistischen Einstufung der Gesellschaften (Ur-, Sklavenhalter-, feudalistische, kapitalistische und sozialistische Gesellschaft) beanspruchten auch sie die patriarchalische Aufgabe, die nichtchinesischen Randvölker zu zivilisieren und zu sinisieren. Der kommunistische Staat legte fest, was für die nationalen Minderheiten nützlich, "gesund" und fortschrittlich ist, und was nicht.
Nach den extremen Formen von Unterdrückung und Zwangsassimilierung in der Zeit der "Kulturrevolution" (1966-76) hat die Reformpolitik der vergangenen Jahrzehnte eine ethnische Renaissance bewirkt. Gleichzeitig vertiefte sich die Kluft zwischen armen und wohlhabenden Landesteilen, das Entwicklungsgefälle nahm zu. Die kommunistische Führung hat ihre Entschlossenheit bekundet, ethnisch-religiöse Konflikte im Keim zu ersticken. Die Taktiken der Pekinger Minderheitenpolitik reichen von einem geduldig werbenden Beschwichtigungskurs bis zu Zwangsmaßnahmen, Unterdrückung und brutaler Niederschlagung von Freiheitsbestrebungen. In Xinjiang ist es seit 1990 immer wieder zu blutigen Unruhen gekommen. Zahlreiche "Konterrevolutionäre" wurden hingerichtet, Hunderte von Moscheen und Koranschulen geschlossen. Gegen pro-chinesische uigurische Funktionäre wurden Attentate verübt, der Imam der Großen Moschee von Kashgar fiel einem Mordanschlag zum Opfer.
Neben den Uiguren leben auch Kasachen, Kirgisen und Tadschiken unter chinesischer Herrschaft. Der Umstand, dass ihre Landsleute in den früheren Sowjetrepubliken Zentralasiens selbstständig geworden sind, hatte die Unruhe in Xinjiang weiter verschärft. In der Region, in der sich Chinas Atomanlagen und Raketenabschussbasen befinden, erstarken panislamische und irredentistische Strömungen, wie die kommunistischen Behörden offen zugeben. Die Partei-Medien prangerten den "Missbrauch der Religion für die Propagierung von Panislamismus und Panturkismus" an und ließen durchklingen, dass örtliche Kader gegen diese Ideen nicht immun wären. Peking hatte 1996 Sondertruppen nach Xinjiang verlegt und eine groß angelegte Anti-Separatismus-Kampagne in Gang gesetzt. Auch in der zentralchinesischen Provinz Henan kam es zwischen Angehörigen der muslimischen Hui-Minderheit und Han-Chinesen zu schweren Zusammenstößen. (APA)