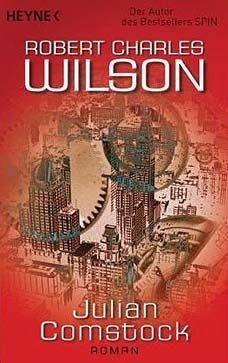
Robert Charles Wilson: "Julian Comstock"
Broschiert, 670 Seiten, € 9,20, Heyne 2009.
Das ist mal wieder so ein Fall, wo ein grandios gutes Buch unter den Erwartungen der LeserInnen leiden könnte. Also am besten alles vergessen, was man vom (wahl-)kanadischen Star-Autor Robert Charles Wilson bislang gewohnt war, zurücklehnen und genießen - der Meister der Ideen-SF hat sich diesmal nicht für kosmophysikalische Phänomeme interessiert und statt dessen ein Experiment gewagt. Wilson ist ein bekennender Fan von Abenteuerromanen aus dem 19. Jahrhundert - auch solchen der schundigeren Art. Gewidmet hat er "Julian Comstock" William Taylor Adams, der als "Oliver Optic" einige Jugendromane verfasste, und der Ich-Erzähler von "Julian Comstock" hat sich ein Gutteil seines Weltbilds aus den ähnlich gestrickten Abenteuergeschichten des fiktiven Autors Charles Curtis Easton zusammengezimmert. Der Roman ist in fünf Akte unterteilt und etabliert bereits im launigen Vorwort den speziellen Tonfall zwischen Draufgängertum und augenzwinkernder Großmäuligkeit, in dem damals so gerne erzählt wurde.
Wir befinden uns mitten im 22. Jahrhundert - doch sieht man von den imposanten Stahlskeletten in Manhattan und den längst überwucherten Müllhalden ab, würde man's nicht merken. Die Säkularen Alten - mit anderen Worten: wir - haben den Karren in den Dreck gefahren, das Ende des Öls und der Niedergang der Städte liegen lange zurück und die Welt hat sich auf einem neuen/alten Niveau eingependelt, das dem 19. Jahrhundert zum Verwechseln ähnlich sieht. (So ähnlich, dass von Anfang an klar ist: Hier geht es nicht um eine plausible Zukunftskonstruktion, sondern um ganz etwas Anderes.) Es ist eine auf den ersten Blick idyllische Welt der Getreidemühlen und Brombeerbüsche, der Pferdedroschken und Pfeifenraucher. Aber auch eine der strengen Klassendreiteilung in Aristokraten bzw. Eupatriden, freie aber wenig begüterte Pächter und abhängige Arbeiter ... oder um ein Wort aus der Vergangenheit zu nehmen: Sklaven. Und eine Welt der Prüfsiegel auf Bücher und des rigorosen Vorgehens gegen Häresien. Worunter zumindest in den Vereinigten Staaten, die nun auch weite Teile Kanadas umfassen, alles fällt, was dem Dominion of Jesus Christ on Earth widerspricht.
Titelfigur ist der zu Beginn des Romans 17 Jahre alte Neffe des US-Präsidenten, der vor seinem recht monarchisch regierenden Onkel ins Exil gerettet werden musste: in den Bundesstaat Athabaska im Nordwesten des Kontinents. Doch erzählt wird sein Werdegang und Aufstieg zur legendenumrankten Gestalt aus der Sicht seines besten Freundes, des gleichaltrigen Athabaskaners Sam Hazzard. Gemeinsam fliehen sie vor der Zwangsrekrutierung, werden aber aufgegriffen und mit der Armee in den östlichen Bundesstaat Labrador geschickt, wo die fürchterlichen und aggressiven Mitteleuropäer seit Jahrzehnten den Amerikanern Gebiete streitig machen. Trotz der allseits bekannten Grausamkeit und Gottlosigkeit Mitteleuropas erzeugt dieses Fürstentum in seinen Untertanen dennoch so etwas wie "Patriotismus" (der dem wirklichen zum Verwechseln ähnlich sieht), resümiert Sam in einer der zahlreichen Fußnoten zum Gaudium gerade heimischer LeserInnen. Durch seine Schilderungen (aber auch durch Auslassungen und Verdrängungen) wird Sam glänzend charakterisiert. Vom naiven und im Grunde systembejahenden Jungen - ein Charakterzug, den er nie ganz verlieren wird - wandelt er sich allmählich zum reifen und kritischer denkenden Menschen. Julian hingegen bleibt selbst für seinen besten Freund weitgehend ein Mysterium, trotz all der gemeinsamen Erlebnisse, die sie in den weiteren Akten nach New York, in einen neuerlichen Kriegszug und schließlich wieder in die neue Hauptstadt der USA zurückführen. Dabei verbindet die beiden sogar der gemeinsame Traum vom Schreiben: Während Sam seine Kriegserlebnisse dazu nützt, seinem eingangs erwähnten literarischen Vorbild Charles Curtis Easton nachzueifern, arbeitet Julian an der Verwirklichung seiner großen Vision: der filmischen Umsetzung seines Werks "The Life and Adventures of the Great Naturalist Charles Darwin".
Wilson hat mit "Julian Comstock" (im Original mit dem Zusatz "A Story of 22nd Century America" versehen) so etwas wie den großen amerikanischen Abenteuerroman alter Prägung geschrieben - und ermöglicht uns wie einem Leser unserer Ururureltern-Generation die (Wieder-)Entdeckung der Welt. Und indem Wilson die Zukunft als Zwillingsschwester der Vergangenheit schildert, kann er zugleich satirische Schlaglichter auf die Gegenwart werfen: Auf eine US-Präsidentschaft als Familienangelegenheit etwa oder eine nach einer christlich geeinten Welt strebende Regierung. Oder auch subtiler: Nur zu gerne mokieren sich die Figuren in "Julian Comstock" über die zerstörerische Verschwendungssucht der Säkularen Alten - und lassen selbst die dreckschleudernde Kohlewirtschaft wieder aufleben, mit der die Raubbau-Gesellschaft überhaupt erst ihren Anfang nahm. - "Julian Comstock" - an dieser Stelle gebührt auch dem Übersetzer Anerkennung - sprüht vor Humor; nicht nur, aber gerne von der spöttischen Art. Und über jeder Seite schwebt der Geist von Mark Twain.
Bemerkenswert aber auch der Grundzug von Gutmütigkeit und Optimismus, der nicht einmal in der Beschreibung von Kriegsgräueln verloren geht. Und einige Momente sind besonders berührend. Zum Beispiel wenn Sam sein längst zerfleddertes Exemplar eines verbotenen Buchs der Alten hervorkramt: "A History of Mankind in Space", das er auf all seinen Reisen bei sich trägt. Oder wenn Julian sein humanistisches Glaubensbekenntnis formuliert: Ich wünsche mir eine Bibel, in der die Früchte vom Baum der Erkenntnis den Samen der Weisheit enthalten und das Leben für die Menschen schöner machen und nicht schlimmer. Ich wünsche mir eine Bibel, in der Isaac vom Opferstein aufspringt und Abraham an die Kehle fährt, um ihn für die elende, blutige Sünde des Gehorsams zu bestrafen. Nicht zuletzt sucht der Roman damit im Jahr 2174 nach der Antwort auf eine Frage, die 2009 eindeutig verneint werden muss: Kann ein Atheist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden?
"Julian Comstock" ist der vielleicht beste Phantastik-Roman des Jahres. In die Top Ten gehört er allemal.
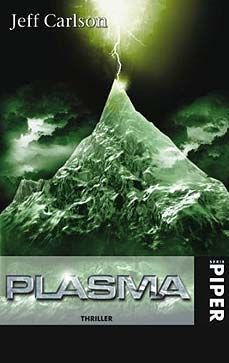
Jeff Carlson: "Plasma"
Broschiert, 409 Seiten, € 9,20, Piper 2009.
Alles hin, hin, hin singen Ja, Panik auf ihrem neuen Album - und in Jeff Carlsons "Plague"-Trilogie gilt dies zumindest für alles unter einer Seehöhe von drei Kilometern. Unterhalb dieser biologischen Demarkationslinie haben Nanobots bzw. Nanoviren (ein paar Mal ist sogar von "subatomaren Teilchen" die Rede, aber da sind entweder dem Autor oder der Übersetzerin die Gäule durchgegangen) alles endotherme Leben ausgelöscht; inklusive dem größten Teil der Menschheit. Ausbruch und Ablauf der Maschinenpest werden in Teil 1 ("Plague Year"; deutsch: "Nano") geschildert, hier der Rückblick. "Plague War" (der deutsche Titel bleibt im Versuch die Ein-Wort-Produktlinie fortzusetzen mysteriös) setzt unmittelbar an diesen Ereignissen an.
Zu Beginn stolpern die drei ProtagonistInnen, die am Ende von Teil 1 den Prototyp eines Impfstoffs gegen die Maschinenpest sichern konnten, einigermaßen immunisiert über den Teppich von Skeletten, der das nördliche Kalifornien bedeckt. Bereits hier werden sie mit den beiden Hauptbedrohungen des zweiten Romans konfrontiert: Gigantischen Insektenschwärmen, deren Vermehrung von keinem Wirbeltier mehr gestoppt wird, und den Truppen der Regierung der Rest-USA, die sich in Colorado eingeigelt hat und von globaler Hegemonie träumt - der Besitz des Impfstoffs wäre die dafür notwendige Voraussetzung. Doch die Wissenschafterin Ruth Goldmann, die den Pestausbruch an Bord der ISS überstanden hat, der junge Ex-Pistenwächter Cam Najarro und Army-Spezialist Mark Newcombe sind entschlossen, das Vakzin an alle Überlebenden zu verteilen. Noch zumindest.
Trotz äußerer Bedrohungen fokussiert Carlson in Teil 2 stark auf die Chemie innerhalb des Trios, die von Rivalitäten und Misstrauen geprägt ist. Cam ist scharf auf Ruth und interpretiert jede ihrer Gesten als Zeichen der Zuneigung. Ruth hingegen verspürt gegenüber Cam eine Mischung aus Anziehung, Angst und - angesichts seiner seuchenbedingten Entstellungen - Ekel; Mark wiederum, den "perfekten Soldaten" betrachtet sie mit größtem Misstrauen. Mark selbst bleibt - ob erzählerisches Manko oder Absicht des Autors - blanko; ihm wird kein Innenleben zugestanden, und später wird er auch ohne große Zeremonie beiseite geschoben werden.
Im Hintergrund ihrer Überlebenssafari wandelt sich indessen die Welt im Jahr 1 nach der Seuche. Militärische Allianzen werden geschmiedet und gebrochen, ein - siehe Originaltitel - zweiter amerikanischer Bürgerkrieg mit neuen Massenvernichtungsswaffen hebt an und zieht auch Rest-Kanada mit hinein. Erst als Invasoren aus Europa und Asien einfallen, raufen sich die Kriegsparteien wieder zusammen. Warum sich die Eroberer auch nach Erbeutung impfstoffhältigen Bluts die ganze Invasionsarbeit antun und nicht einfach ihre eigenen leergefegten Kontinente wiederbesiedeln, wird freilich nicht so ganz klar. Wie auch Ruth widersprüchlich handelt: Jedenfalls findet sie es geradezu unausweichlich, nach Rückkehr in die "Zivilisation" umgehend an der Entwicklung einer neuen Nano-Waffe, der Schneeflocke, zu forschen. Millionen von Menschen brauchten die Schneeflocke, um am Leben zu bleiben. Und Millionen von Menschen würden wegen der Schneeflocke sterben. Sie trug die Verantwortung für den Massenmord an den Eindringlingen und für die Errettung des eigenen Volks - irgendwie beißt sich das mit Ruths Agieren am Ende von Teil 1.
Insgesamt gesehen ist "Plasma" ein typischer zweiter Teil einer Trilogie: Es ist jede Menge los und es geht wenig wirklich voran. Dennoch wird es spannend sein zu erleben, wie die "Plague"-Trilogie enden wird. Der abschließende Roman "Infekt" ("Plague Zone") soll 2010 erscheinen.
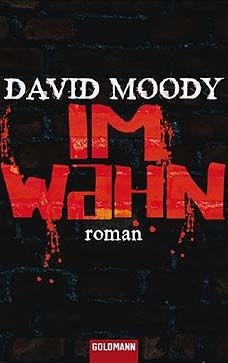
David Moody: "Im Wahn"
Broschiert, 316 Seiten, € 8,20, Goldmann 2009.
Der Engländer David Moody hat's offenbar - siehe etwa die sehr gute Zombie-Reihe "Autumn" - mit sozialen Seuchen; der Eigenverlag, den er eine Zeitlang betrieb, hieß passenderweise Infected Books. Auch in "Im Wahn" ("Hater") breitet sich ein gewaltsames Massenphänomen aus: In diesem Falle sind es Amokläufe, die aus dem Nichts kommen und ganz normale BürgerInnen betreffen. Gleich zu Beginn heißt es: Zuerst war sie nur ein beliebiges Gesicht auf der Straße, unauffällig und unscheinbar und so irrelevant für ihn wie alle anderen auch. Aber an dieser speziellen Frau kam ihm etwas anders vor, das ihn mit Unbehagen erfüllte. Doch ist dies nicht die Beschreibung der ersten Amokläuferin, sondern des ersten Opfers. Die Medien werden den Täter und die vielen, die es ihm später gleichtun, als Hasser bezeichnen - doch Augenzeugen berichten, die Betreffenden machten während ihrer Tat den Eindruck, unter Todesangst zu stehen. Und es sind solche Perspektivenwechsel, die "Im Wahn" zu etwas Besonderem machen.
Der Hauptstrang der Erzählung wird im Präsens aus der Ich-Perspektive Danny McCoynes, der in der Abteilung für Strafzettelbearbeitung der Gemeinde jobbt, geschildert. Danny fühlt sich unzufrieden und unterfordert, blickt mit Verachtung auf seine KollegInnen und steht unter Dauerstress - zuhause mit Freundin Lizzie und den drei Kindern herrscht auch nicht gerade eitel Wonne. Im Grunde wirkt Danny wie ein wandelnder Amokläufer-Bausatz - doch Vorsicht, Moody mag Überraschungen. Mehrfach wendet er den uralten aber stets funktionierenden Schocker-Trick an, eine Szene aufzubauen, die auf die erwartete Gewaltexplosion hinauszulaufen scheint ... um dann an ganz anderer Stelle zuzuschlagen. Dafür lässt er einmal sogar die Folkrock-Veteranen The Men They Couldn't Hang zum Celebrity Death Match antreten, der Mann hat Humor!
Mit der inflationären Zunahme an Bluttaten wächst in der Gesellschaft die Hysterie. Man traut sich in der Öffentlichkeit nicht mehr anderen in die Augen zu schauen, um nur ja niemanden zu provozieren; zugleich kursiert der Verdacht, die Regierung wisse mehr (wozu Moody geschickt Indizien ausstreut, die aber genausogut Nebelkerzen sein könnten). Und wenn die panische Bevölkerung sich gleichzeitig Fragen wie Haben Terroristen etwas in die Atmosphäre gesprüht? und Fürchten sich die Leute vor etwas, das gar nicht existiert? stellt, denkt man unwillkürlich an Michael Moores "Bowling for Columbine" und die darin enthaltenen Abschnitte über mediale Angstmache. Was schon intelligent genug wäre, doch Moodys eigentlicher Coup geht noch einmal ein Stück weiter: Der besteht darin, dass er Bilder, wie man sie aus Zombie- und anderen Menschen-versus-dehumanisierte-Artgenossen-Szenarien kennt, mit solchen aus der Shoa verbindet. Ein gewagtes Spiel mit Perspektiven, das einen atemberaubend perfiden Effekt ergibt und den eigentlichen Schock-Wert des Romans ausmacht.
Apropos Infektion: Angesteckt von der Fantasy soll "Hater" angeblich erster Teil einer Trilogie sein - mal sehen, ob es noch dazu kommt, immerhin ist der Roman schon 2006 erschienen. Wäre im Grunde auch gar nicht erforderlich, denn das Ende in der bestehenden Form hat seine Qualitäten. Zunächst steht ohnehin die Verfilmung von "Hater" auf dem Fahrplan, durchgeführt von Genre-Starregisseur Guillermo del Toro. Der seinerseits übrigens vor kurzem mit seinem ersten Roman vorstellig geworden ist: "The Strain" ("Die Saat"). Demnächst an dieser Stelle.

Peter F. Hamilton: "Träumende Leere" + "Schwarze Welt"
Broschiert, 493 bzw. 381 Seiten, jeweils € 12,40, Bastei Lübbe 2009.
Wenn man zwei Bücher kaufen muss, um einen Roman lesen zu können, der dafür dann zwei bis drei Geschichten zum Preis von einer bietet, am Ende aber trotzdem keine abgeschlossene Geschichte bilden wird ... dann ist es gar nicht so leicht zu berechnen, ob man als Käufer pari aussteigt. In jedem Fall sollten diese beiden Titel gemeinsam gelesen werden, da sie zusammen den 2007 erschienenen Originalroman "The Dreaming Void" bilden. Wo andere Verlage einer "Was, nur 500 Seiten? Das können wir nicht verkaufen, hängen wir noch eine Novelle dran"-Philosophie zu folgen scheinen, splittet Bastei ganz gerne mal einen längeren Roman auf; beide Herangehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile.
Übersichtlichkeit ist das große Stichwort für "The Dreaming Void", denn der britische Star-Autor pflanzt hier ein ordentliches Dickicht an - und zwar auf allen Ebenen. Zunächst zum Hintergrund: Angesiedelt ist der Roman im Commonwealth-Raum, den Hamilton vor einigen Jahren zu entwickeln begonnen hat. Über zahlreiche Sternensysteme verteilt, hat die Menschheit angefangen sich in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Advancer werten Geist und Körper durch Implantate auf, Higher gehen noch einen Schritt weiter ins Posthumane und entschließen sich zum Download in ANA, das Advanced Neural Activity System, das in den Quantenraum um die Erde eingebettet ist und den bislang größten Sprung in Richtung postphysische Existenz darstellt. Ideologisch sind sich die beiden Kulturen nicht recht grün, und auch ANA selbst stellt keine geschlossene Einheit dar, sondern setzt sich aus höchst unterschiedlichen Gruppen zusammen. Jede davon hat ihre eigenen Vorstellungen, wie die weitere Evolution der Menschheit auszusehen habe und technologisch zu forcieren sei, und setzt ihre jeweiligen AgentInnen ein, um dies durchzusetzen. Und auch abseits dieser Konfliktlinie verschwimmen längst die Konturen des Menschlichen: Wer stirbt, kann mittels implantiertem Memory-Chip und einem neugeklonten Körper dem Relifing unterzogen werden. Planetare Gaiafields ermöglichen die empathische Verschmelzung beliebig vieler Individuen - und eine Sonderform davon sind die Multiplen, die einen Geist auf viele Körper verteilen. Auch sie halten sich für die evolutionäre Zukunft der Menschheit - und es ist dieser Wettstreit der Biotech-Ideologien, der sich unter der eigentlichen Handlung als das große Generalthema der neuen Hamilton-Romane entfaltet.
Hamiltons posthumanes Mosaik erinnert stark an Neals Ashers Polis-Universum - und noch in einem anderen Punkt ähneln sich die beiden Autoren: Beide bringen gerne Verweise auf frühere Werke ein (was noch einmal unterstreicht, dass die SF-Schiene von Bastei Lübbe stark von Reihen geprägt ist). Das geht hier bis zur Wiederkehr früherer Charaktere wie Paula Myo und "The Cat" aus den Romanen "Pandora's Star" und "Judas Unchained". Deren Handlung spielte sich zwar ein gutes Jahrtausend vor den aktuellen Ereignissen ab, doch sind die Menschen in all ihren verschiedenen Ausformungen inzwischen so langlebig, dass bei einem stinknormalen Meeting ganze historische Epochen aufeinander treffen können und so gleichzeitig nebeneinander liegen wie die virtuellen Welten im Inneren ANAs. Ein reizvoller Effekt. Nichtsdestotrotz versteht es Asher etwas besser als Hamilton Verweise auf Früheres so einzubauen, dass man nicht das Gefühl hat, wegen Wissenslücken den Zusammenhang nicht mehr zu erfassen.
Was zum nächsten Teil des Dickichts führt, den Hauptpersonen: Bis ins zweite Drittel von "Träumende Leere" hinein werden laufend neue Kapitel-tragende Charaktere eingeführt. Etwa Ethan, der neugewählte Führer der religiösen Bewegung Living Dream: Er plant mit seinen AnhängerInnen einen Pilgerzug ins Zentrum der Milchstraße, wo man das vermeintliche Riesen-Black Hole als künstliches Mini-Universum identifiziert hat. Einige Alien-Rassen fürchten, dass ein Durchbrechen des Walls um diesen als Leere bezeichneten Raum katastrophale Auswirkungen haben wird, und auch innerhalb der Menschheit sprechen sich zahlreiche Stimmen gegen das Projekt aus. Dennoch wird weder auf das rätselhafte Phänomen an sich noch auf den Pilgerzug - immerhin der beworbene Aufhänger des Romans - sonderlich eingegangen. Erst mal verfolgen wir mit, wie die VertreterInnen verschiedenster Fraktionen aktiv werden: So der HighTech-Agent Aaron, der mit dem Living Dream-Mitglied Corrie-Lyn auf die Suche nach dem Träumer Inigo geht; dessen Visionen von der Leere hatten den Pilgerzug überhaupt erst ausgelöst. Oder der Physiker Troblum, die ANA-Agentin Justine Burnelli (ebenfalls aus früheren Romanen übernommen) oder der "Delivery Man", der in London inmitten einer Familie lebt, die dem Werbefernsehen des 20. Jahrhunderts entsprungen scheint, der für seinen Tagesjob aber auf interstellare Missionen geht. Etwas abseits von all diesen Figuren steht die Kellnerin Araminta, die nach Trennung und unerwarteter Erbschaft in ein neues Leben startet, dem wir in all seiner Banalität recht ausführlich folgen dürfen. Erst mit "Schwarze Welt" wird klar, wie sich Araminta in die Rahmenhandlung einfügen wird.
Praktisch völlig losgelöst von dieser Ebene spielen sich die als "Inigos Traum" bezeichneten Kapitel ab, die zwischen die übrigen gestreut sind. Sie schildern das Leben auf einer Welt in der Leere und kreisen um den jungen Menschen Edeard. Als Eiformer vermag er es, dem ungeschlüpften Nachwuchs von als Defaults bezeichneten Tieren mittels geistiger Kräfte beliebige Gestalt zu verleihen. Später zieht er in die offenbar nicht für Menschen gebaute Stadt Makkathran, deren Gebäude aus einem Material bestehen, das ebenfalls nur mit telekinetischen Kräften bearbeitet werden kann: Interessante Ideen für etwas, das im Prinzip einen eigenständigen Fantasy-Roman darstellt, der in die SF-Rahmenhandlung eingewoben wurde. Später, als Edeard sich der Stadtwache anschließt, mündet das Ganze mehr und mehr in eine Coming-of-Age-Geschichte, die sich leider etwas zu ziehen beginnt. - Und vollkommen offen bleibt zumindest in diesen beiden Büchern, warum die Traumvisionen von Edeards Leben - in einer zumindest für Commonwealth-Verhältnisse von Entbehrungen und Gewalt geprägten Welt - derartige spirituelle Strahlkraft entfalten sollen, dass Millionen Menschen sich dafür ins Ungewisse stürzen wollen.
So weit, so kompliziert. Man kann Hamilton blind vertrauen, dass er all die aufgedröselten Handlungsfäden noch gekonnt zusammenführen wird: "The Dreaming Void" ist ja nur der erste Teil einer Trilogie (in der Übersetzung dann wohl Sextalogie). Und all diejenigen, die im Amazon-Forum über Basteis Aufsplitten des Originals geschimpft haben, werden am Schluss von "Schwarze Welt" ernüchtert feststellen, dass der Gesamtroman um keinen Deut abgeschlossener ist als seine "erste Hälfte". Was bei Hamilton ja nichts Neues ist. Wer ins "Void"-Epos einsteigt, sollte sich also bewusst machen, dass er sich auf ein Langzeit-Projekt einlässt.
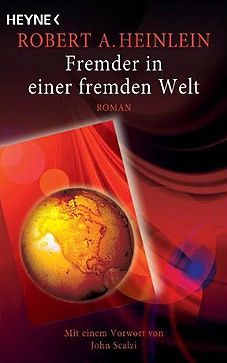
Robert A. Heinlein: "Fremder in einer fremden Welt"
Broschiert, 652 Seiten, € 11,30, Heyne 2009.
In der famosen Heyne-Reihe "Meisterwerke der Science Fiction" ist dies sage und schreibe der erste Roman von Robert A. Heinlein - immerhin einer der erfolgreichsten und (vor allem in den USA) populärsten SF-Autoren aller Zeiten. Zugleich einer der umstrittensten - und im 1961 erschienenen, Hugo-prämierten, "Stranger in a Strange Land" wird Heinlein seinem Ruf in beiden Aspekten gerecht. Da damals Romane nicht nur kurz sein durften, sondern sogar mussten, wurde die Erzählung seinerzeit erheblichen Kürzungen unterworfen. Dies ist die Übersetzung der erst posthum veröffentlichten Uncut-Version.
"Fremder in einer fremden Welt" ist Valentine Michael Smith, Sohn zweier Angehöriger der ersten Mars-Expedition, der nach dem Tod seiner Eltern von den Ureinwohnern des roten Planeten aufgezogen wurde. Der anfängliche Rückblick auf diese Expedition und auf welch haarsträubende Weise sie zusammengestellt wurde, zeigt in seinem herrlich schnoddrigen Stil, warum Heinlein derart erfolgreich war. Auch in der Folge glänzt der Roman, der stark von Dialogen geprägt ist, mit Witz und hohem Tempo. Und ebendiese Dialoge sprühen nur so vor Esprit und Dreistigkeiten, als wären sie einer Screwball Comedy entnommen. Selbst philosophische Betrachtungen sind so gut in die jeweilige Situation eingebettet, dass der Schwung erhalten bleibt. - Auf den Mars setzt der Roman übrigens keinen Fuß; die Ereignisse beginnen damit, dass Smith von einer zweiten Expedition zur Erde zurückgebracht wurde und sich nun in eine chaotische Welt hineingeworfen sieht, die mit seiner marsianischen Erziehung nicht im geringsten kompatibel ist. Den Clash der Weltanschauungen machte Heinlein dabei anschaulicher, als es sogar vielen heutigen AutorInnen mit ihren Alien-Pappkameraden gelingt. Bekanntestes Beispiel für Smiths fremde Denkungsart ist wohl das Wort grok, das im Englischen eine Zeitlang zum Mode-Verb wurde und ungefähr "etwas so umfassend verstehen, dass man mit ihm eins wird" bedeutet. Über den genauen Inhalt rätseln die Romanfiguren jedenfalls über die gesamte Länge des Buchs.
Als - für ihn völlig bedeutungslos - Erbe des größten irdischen Privatvermögens und aus formaljuristischen Gründen sogar "Besitzer" des Mars weckt Smith Begehrlichkeiten und wird zunächst zum Spielball eines politisch-ökonomischen Tauziehens. Mithilfe der Krankenschwester Jill Boardman flüchtet Smith aus dem Spital, in dem er gefangen gehalten wird, auf das Anwesen Jubal Harshaws, des schillerndsten Charakters des Romans: Populärer Autor, Jurist und Bonvivant, gleichermaßen gönnerhaft, überdreht und mitfühlend weise, vereinigt er unzählige Widersprüche in sich, lässt den konservativen Bildungsbürger ebenso raushängen wie den revolutionären Freigeist, äußert einige problematische Ansichten zur Demokratie und hält andererseits die Bürgerrechte hoch; in vielen Passagen scheint er die polternde Stimme Heinleins selbst zu verkörpern. Unter Jubals Fittichen erhält Smith seine Einführung in die menschliche Kultur - und im Zuge der wechselseitigen Annäherung kann er allmählich auch in Worte fassen, was ihn daran stört. Und Heinleins Charaktere sind Menschen der Tat - Smith wird sich also nicht geknickt auf den Mars zurückziehen, sondern beschließt die Dinge auf Erden zu ändern. Dazu stehen ihm auch einige Kräfte zur Verfügung, die sich erst nach und nach herausschälen: So kann er Dinge um neunzig Grad zu allem anderen drehen und damit einfach aus der Welt verschwinden lassen - und ganz beiläufig wird erwähnt, dass die unendlich weisen und langsamen Marsianer durchaus Weltenzerstörung auf dem Programm haben; wenn auch voller Liebe durchgeführt.
Für Smiths weitere Strategie gibt es zwei Initialzündungen: Erst entdeckt er (mit Jill) den Sex, dann die Religion. Letzteres in Form der Fosteriten, die einen sogar für evangelikale Verhältnisse geschmacklosen Jahrmarkt von Kirche betreiben. Nun gründet Smith seine eigene Sekte ... und ein Messias, der seine Jünger nach einem hierarchischen Stufensystem geistig erhöht und sie mit ihren erweiterten Fähigkeiten zur Unterwanderung in Wirtschaft und Politik hinausschickt: Erinnert das nicht an irgendetwas? Zwar wird Heinlein wegen seines Konzepts von der "freie Liebe" praktizierenden Kirche als Pionier der sexuellen Revolution heraufbeschworen - doch ganz so aufgeschlossen ist der neue Mensch der Romanwelt dann auch nicht. Die Konstellation Mann-Frau wird verklärt, Mann-Mann von vorneherein ausgeschlossen und Frau-Frau als interessant zum Zuschauen betrachtet ... was nicht wirklich revolutionärer ist als die Mitternachtsschiene im Kabelfernsehen. Obendrein legt der Autor den Figuren einige haarsträubende Sätze in den Mund - wie den, dass neun von zehn vergewaltigten Frauen selber schuld an der Tat sind. Aber es wirkt eben kaum etwas so alt wie die Revolution von gestern. Dass "Stranger in a Strange Land" zum Kultbuch der Hippie-Bewegung erklärt wurde, kann man sich nach der Lektüre ganz gut vorstellen. Erst recht mit dem Gedanken, worin diese später versandelte. Im doppelten Rückblick liest sich Smiths Kirche wie ein irgendwann aufs unweigerliche Platzen zusteuernder 60er-Jahre-Traum aus Kommunenleben, transzendental verbrämtem Gruppensex und reichlich selbstgerechter Glückseligkeit. Und ohne marsianische Spezialkräfte müsste er so wohl auch enden. - "Fremder in einer fremden Welt" ist jedenfalls - no na - ein ausgesprochen lesenswerter Klassiker. Mit ein paar Abstrichen.
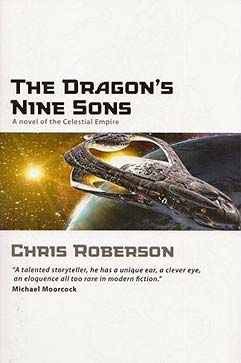
Chris Roberson: "The Dragon's Nine Sons"
Broschiert, 416 Seiten, Solaris 2009.
Zum Auftakt des im Vormonat angekündigten Drachenschwerpunkts erst mal das Buch, das den Begriff am weitesten dehnt. Denn Dragon ist hier zum einen der Name eines erbeuteten Azteken-Raumschiffs und verweist zum anderen auf den beinahe den gesamten Globus beherrschenden chinesischen Kaiser, der auf dem Drachenthron sitzt. - Zugleich wird damit ein weiterer Preisträger nachgereicht: Mit "The Dragon's Nine Sons" hat der texanische Autor Chris Roberson vor kurzem den Sidewise Award für den besten Alternativwelt-Roman 2009 eingeheimst. Wobei er es nicht bei der Beschreibung einer alternativen Gegenwart belässt, sondern die Geschichte in die Zukunft fortschreibt und so den Plot ins Sonnensystem hinausverlegen kann.
Abgetrennt hat sich Robersons Geschichtslinie von der unseren bereits im 15. Jahrhundert, als der chinesische Admiral Zheng He mit seiner legendären Flotte von (angeblich) riesigen Dschunken auf Entdeckungsfahrt ging und zumindest bis nach Afrika kam. Danach erfolgte in China ein grundlegender politischer Wandel, die Flotte wurde eingestampft und das Reich der Mitte gab sich jahrhundertelangem Isolationismus hin. Ein wenig bekannter Wendepunkt der Geschichte! - Hier jedenfalls wurde Zheng He weiterhin unterstützt und knüpfte Kontakte bis nach Europa. Die am Ende des Romans angehängte Zeittafel hält daher einige vergnügliche Gedankenspiele für historisch Interessierte bereit: Zum Beispiel dass die Luftfahrt bereits im 17. Jahrhundert begann, nachdem chinesische Raketentechnik mit Leonardo da Vincis Hängegleiter-Entwürfen kombiniert wurde. Oder dass das unidentifizierte "weit östlich von China" gelegene Land Fusang hier mit dem von China kolonisierten Südamerika gleichgesetzt wird. Das 17. Jahrhundert ist allerdings auch die Zeit der Machtübernahme durch die Mandschu - und die betraf in Robersons Welt nicht nur China, sondern auch dessen zahlreiche Außenkontakte. Land um Land fiel im Lauf der Zeit unter die Herrschaft des Drachenthrons; Mitte des 21. Jahrhunderts regiert dieser über die gesamte Erde mit Ausnahme des niemals von europäischen Invasoren zerstörten Aztekenreichs der Mexica. Auf der Erde belauern die beiden Konkurrenten um die Weltherrschaft einander nur - im Weltraum hingegen wird scharf geschossen.
Im Zuge des Konflikts werden die beiden Hauptfiguren des Romans in den Einsatz gepresst: Captain Zhuan Jie wollte einst Abenteuer erleben und schloss sich der kaiserlichen Treasure Fleet an. Dass das "Abenteuer" allmählich in einen gemütlichen Pendelverkehr zwischen der Erde und dem nur als Fire Star bekannten Mars mündete, war ihm mit zunehmendem Alter nur recht. Doch mit Ausbruch des Krieges gegen die Mexica wurde die Flotte militarisiert und Zhuan ist nicht zum Helden geboren. Eine Befehlsverweigerung bringt ihn mit Yao Guanzhong zusammen, der seinen Vorgesetzten mit unbequemen Fragen aufgefallen ist. Als Alternative zur Hinrichtung "dürfen" die beiden eine Selbstmordmission leiten, mit der die Asteroiden-Basis Xolotl der Mexica-Raumflotte zerstört werden soll. Sieben weitere Delinquenten werden ihnen zu Seite gestellt - alle recht simpel als Grundtypen charakterisiert: der Clown, der Riese mit dem kindlichen Gemüt, der Betrüger, der Jähzornige usw. Anders ausgedrückt: Roberson verlegt das "Dreckige Dutzend" ins All, Überraschungen gibt es kaum. Von der Ausbildung im Inneren des Marsmonds Phobos (hier als Zhurong geläufig) über die erwartbaren Streitereien bis zur nicht so ganz nachvollziehbaren charakterlichen Wandlung der disziplinären Problemfälle zu selbstlosen Heroen. Recht schematisiert gibt jeder im Lauf der Reise seine Lebensgeschichte zum besten - ganz am Schluss folgt dann auch die Aufklärung von Yaos Geheimnis ... das direkt der Geschichte des Zweiten Weltkriegs entlehnt ist.
Alternativweltromane müssen in beiden Wortteilen funktionieren. Im "Celestial Empire"-Zyklus, zu dem schon vor diesem Roman einige Kurzgeschichten und Novellen erschienen sind, hat Roberson eine interessante Welt erschaffen. Natürlich gab es ähnliches bereits (siehe etwa Christopher Evans' "Aztec Century"/"Der Sturm der Azteken") - trotzdem ist die Grundidee deutlich origineller als die beiden Hauptthemenkreise des Genres: Hitler hat den Zweiten Weltkrieg und der Süden den amerikanischen Bürgerkrieg gewonnen. Roberson verknüpft die fremdartige Historie überdies mit einigen Elementen, die man als Gag auffassen kann oder die das Paralleluniversum den LeserInnen vertrauter machen sollen: Zum Beispiel dass die Westküste Nordamerikas durch einen wild konstruierten Zufall zum Namen Khalifah kam oder dass die chinesische Armee wie "unsere" US-amerikanische aus mehreren rivalisierenden Heereskörpern besteht. Aber all das wurde in früheren Geschichten schon abgehandelt, und "The Dragon's Nine Sons" wartet lediglich noch mit pittoresken Details auf. Zum Beispiel einem mit Hämoglobin-Sensoren ausgestatteten Opferaltar an Bord des erbeuteten Aztekenschiffs - denn ohne Blutopfer läuft keine Technik (nicht dass das sonderlich logisch wäre). - Was den zweiten Wortteil, nämlich Roman, anbelangt, hat das Buch dann leider nicht allzu viel zu bieten: zu schematisiert und überraschungslos läuft der Plot ab. Mitbewerber Robersons für den Sidewise Award war übrigens Terry Pratchett mit "Nation" ("Eine Insel") - das wäre dann doch die bessere Wahl gewesen.

Tad Williams & Deborah Beale: "Die Drachen der Tinkerfarm"
Gebundene Ausgabe, 379 Seiten, € 20,50, Klett-Cotta 2009.
Mit der monumentalen "Otherland"-Saga hat sich Tad Williams, seit einem Vierteljahrhundert im Geschäft, endgültig in die Genre-Annalen eingeschrieben. Derzeit laufen parallel die "Shadowmarch"-Reihe und ein neuer Zyklus von Jugendromanen, die der Kalifornier zusammen mit seiner Frau Deborah Beale verfasst. "Die Drachen der Tinkerfarm" ("The Dragons of Ordinary Farm") ist der erste Teil daraus.
Es beginnt mit einem - siehe "Narnia" oder Brandon Mulls jüngst erschienenes "Fabelheim" - probaten Mittel Kinder ins Abenteuer zu schicken: nämlich sie aufs Land zu verfrachten. Die Mutter von Tyler und Lucinda jedenfalls ist froh, als ein Brief vom vergessenen Onkel Gideon Goldring auftaucht, in dem er die Kinder auf sein Anwesen einlädt. Nun braucht sie sie nur noch in den Zug zu setzen und kann hoffnungsvoll zum Urlaub in einer Feriensiedlung für Singles abdampfen. Tyler und Lucinda dämmert indes bereits im Zug, dass Gideons Ordinary Farm im Standard Valley des kalifornischen Hinterlands keineswegs ganz gewöhnlich sein dürfte. Das Buch, das ihnen der Onkel zwecks Vorbereitung geschickt hat, ist mit einem Zettel mit der Botschaft "Bitte lest dies aufmerksam durch. Es könnte euch das Leben retten." versehen und entpuppt sich als Handbuch zum Umgang mit Kühen. Nur dass das Wort "Kühe" offenbar über ein anderes drübergeschrieben wurde und irgendwie nicht zum Kontext "Fliegen" und "Feuer speien" passen will. Und flog da am Zugfenster nicht grade ein Affe vorbei? - Auf der Farm bereitet sich inzwischen ein dritter Halbwüchsiger auf die Ankunft der Gäste vor, mit ebenso wenig Enthusiasmus für einen gemeinsamen Sommer wie diese selbst: Colin, dessen schöne, schreckliche Mutter wir bereits im Prolog kennenlernen, als sie anmutig durch die Gärten schreitet und einen Vogel in der Hand zerquetscht. Patience Needle lautet ihr verheißungsvoller Name.
Die Farm selbst erscheint den beiden Stadtpflanzen in ihrer wirren Architektur zunächst wie eine hölzerne Raumstation; speziell Tyler neigt - absolut altersgemäß - dazu, alles Reale mit Bezügen zu Videospielen und TV-Serien zu vergleichen. Die hier vorgefundenen Geheimnisse stellen die fiktiven Erlebnisse aber bald in den Hintergrund, und die beiden Kinder entdecken nicht nur den Reiz einer Farm, die sich als mythologisches Bestiarium erweist, sondern nach und nach auch, was es heißt Verantwortung zu tragen. Und - ohne pädagogische Botschaft keine Jugendliteratur - miteinander auszukommen.
Viele der hier auftauchenden Motive wirken vertraut: Nicht zuletzt von Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur wie eben "Narnia", dem "Zauberer von Oz", "Alice im Wunderland" oder Andersens "Schneekönigin". Aber auch von neuerem Material her - wenn beispielsweise Onkel Gideon die Kids auf einen Rundgang durch die Menagerie seiner Farm mitnimmt, dann entspricht dies der Szene, in der John Hammond seinen Enkelkindern Tim und Lex stolz die Höhepunkte des "Jurassic Park" präsentiert. - Immer noch ein eleganteres Wiederaufgreifen alter Motive jedenfalls als bei "Harry Potter", der im Verbraten von Fremdschöpfungen höchstens noch von "Stargate" übertroffen wird. Nur die Parallelen der "Tinkerfarm" zu Mulls 2006 begonnener "Fablehaven"-Serie (seit 2009 als "Fabelheim" auch auf Deutsch erscheinend) sind etwas zu stark: Hier wie dort dient ein abgelegenes Anwesen als Asyl für selten gewordene Fabelwesen ... welche keineswegs von Haus aus liebenswerte Geschöpfe sind, sondern quer über die Grenzen von "Gut" und "Böse" hinweg ihrer eigenen Natur folgen. Wenn sich da mal nicht zwei Autoren die LeserInnenschaft streitig machen; an erzählerischer Qualität stehen sich die beiden (bzw. die drei) jedenfalls in nichts nach. Und auch "Ordinary Farm" ist als Serie angelegt: der zweite Roman soll 2010 erscheinen.
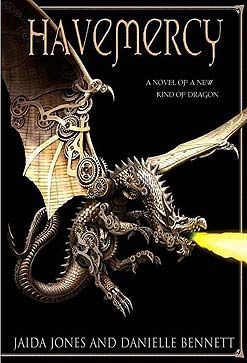
Jaida Jones & Danielle Bennett: "Havemercy"
Broschiert, 431 Seiten, Spectra/Ballantine Books 2008.
Zwei Sex-Skandale erschüttern zu Beginn von "Havemercy" das Königreich Volstov ... oder vielleicht ist "erschüttern" zuviel gesagt. Jedenfalls gehen sie dem herrschenden Esar genügend auf die Nerven, um durchzugreifen: Zum einen hat Margrave Royston, ergrauender Magier im Staatsdienst und Lebemann, den Erbprinzen des verbündeten Reichs Arlemagne, wo man sexuell etwas verklemmter ist, vernascht. Zum anderen hatte Rook, Problemkind in Volstovs legendärem Dragon Corps, eine Diplomatengattin nicht nur zum Seitensprung verleitet, sondern wollte sie in Verkennung ihrer Position und ihrer aufgetakelten Erscheinung anschließend auch noch bezahlen ... und schon wieder blamiert man sich damit gegenüber Arlemagne, auf dessen Unterstützung man im Kampf gegen das Imperium von Ke-Han aber angewiesen ist. Also verbannt der Esar Royston aufs platte Land und verordnet Rook - und mit ihm dem ganzen Korps von Drachenreitern - rehabilitation. Der Anstoß für unerwartete Personenkonstellationen und einige ziemlich originelle Plot-Ideen ist gegeben.
Ohne die magisch-mechanischen Drachen - they were as mythical as they were man-made - wäre Volstov aufgeschmissen; selbst der Herrscher kann es sich daher nicht mit ihren Reitern verscherzen. Das haben die Männer vom Drachenkorps soweit verinnerlicht, dass sie es - außer gegenüber ihren feuerspuckenden girls - komplett an Umgangsformen missen lassen. Ganz besonders gilt dies für Rook, der aus einer Gruppe leicht soziopathischer Kindsköpfe noch einmal als extra-grober Marlboro Man hervorsticht. Und denen setzt man nun in Form Thoms, eines Studenten aus wenig begüterten Verhältnissen, einen naturgemäß ungeliebten sensitivity trainer vor die Nase. Von Versagensängsten gepeinigt, führt Thom mit den Rittern Gruppentherapie und Rollenspiele durch - was in für einen Fantasy-Roman ebenso ungewohnte wie hochkomische Situationen mündet. - Royston indessen entdeckt im Provinz-Exil, dass das verhasste Landleben - grässlich, überall Schafe! - auch seine Sonnenseiten hat: Nämlich in Form Hals, der bei Roystons Bruder als Tutor von dessen Kindern arbeitet, eine unschuldige Seele ist und mit Vorliebe in romans über Abenteuer liest. Und schließlich selber in einem landet: Erst Liebe, dann Krieg.
"Havemercy" - benannt nach Rooks Drachin, welche aber (leider) nur eine Nebenrolle spielt - wird abwechselnd aus den Ich-Perspektiven von Royston, Hal, Rook und Thom erzählt. Dabei gelingt es den beiden Autorinnen, jedem seine eigene Stimme zu verleihen: Abgeklärt und sarkastisch etwa Royston, übersensibel Thom. Am stärksten heben sich auch sprachlich die Kapitel ab, in denen der stets zornige und vulgäre Rook berichtet. Was die beiden Personenkonstellationen Royston-Hal und Rook-Thom anbelangt, war letztere sicher die schriftstellerisch dankbarere Aufgabe. Die Liebesgeschichte zwischen Royston und Hal wird zwischendurch ein wenig zäh, weil die romantischen Hindernisse eher bemüht als wirklich hinderlich erscheinen; Lynn Flewelling hat in ihrer "Nightrunner"-Serie eine sehr ähnliche Storyline etwas eleganter ausgeführt. - Deutlich spannender der Fortgang der Ereignisse rund um Rook und Thom, in deren Verlauf Spannungen und böse Überraschungen im Schnelltakt auftauchen. - Und weil alle Beteiligten so sehr vom Zwischenmenschlichen in Anspruch genommen sind, merken sie - und mit ihnen der Leser - erst sehr spät, dass Volstov längst unter Angriff steht.
Die Idee vom Drachenkorps erinnert unwillkürlich an Naomi Noviks Erfolgsserie "Die Feuerreiter Seiner Majestät". Die stark auf die Psychologie konzentrierte Ausrichtung stellt "Havemercy" allerdings eher in die Nähe von Sarah Monettes "The Doctrine of Labyrinths"-Reihe; ohne jedoch deren Tiefe zu erreichen. Und schon gar nicht deren dunklen Grundton: "Havemercy" - ein Stand-Alone-Roman(!), der wegen seines Erfolgs allerdings inzwischen einen Nachfolger ("Shadow Magic") bekommen hat - gibt sich deutlich unbeschwerter. Und noch einem Vergleich können sich die beiden Autorinnen kaum entziehen: Da die beiden Studentinnen Jaida Jones und Danielle Bennett mit "Havemercy" ihren ersten Fantasy-Roman im Alter von 20 bzw. 21 Jahren veröffentlicht haben, liegt der Gedanke an "Eragon" von "Wunderkind" Christopher Paolini nahe; glücklicherweise spielt "Havemercy" einigen Kinderkrankheiten zum Trotz in einer höheren Liga. Die Chancen auf eine Verfilmung dürften aber ungleich niedriger sein - außer schwule Helden mit Psycho-Knacks werden doch noch Popcornkino-tauglich. Schade: Launische Steampunk-Drachen aus Platin und Gold gäben sicher einen tausendmal cooleren CGI-Effekt ab als eine blaue Echse, die wie Onkel Dagoberts Chefsekretärin Fräulein Rührig spricht. Und Paolinis Saphira werden wir auch nie ihren Reiter wie folgt kommentieren hören: He wasn't half-bad. Didn't even piss himself on me. I appreciate that in a man.
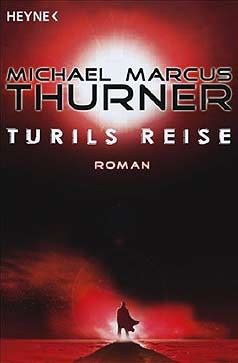
Michael Marcus Thurner: "Turils Reise"
Broschiert, 415 Seiten, € 9,20, Heyne 2009.
Robert Lembkes heiteres Beruferaten "Was bin ich?" würde im Weltraum nur begrenzt Sinn machen. Zieht man erst mal a) alles Soldatische, b) wissenschaftliche Entdecker-Jobs und c) auch noch die Ermittler- und Detektivschiene ab, dünnt der kosmische Arbeitsmarkt beträchtlich aus. Zumindest in der betreffenden Literatur. Mit Begeisterung liest man daher die raren Romane, in denen andere Berufsgruppen ins All gehievt werden - etwa Barry B. Longyears wunderbare "Zirkuswelt"-Trilogie oder George R. R. Martins Episoden um Haviland Tuf, den Handlungsreisenden in Sachen biologische Problemlösungen. - Der Wiener Autor Michael Marcus Thurner, der bislang vor allem für verschiedene Heftromanserien geschrieben hat, hat eine weitere Nische gefunden: den interstellaren Bestattungsunternehmer. Und Thurners biografischer Hintergrund war dafür vermutlich durchaus hilfreich: Oder kann man sich ein besseres Training in Sachen "Das hatten wir noch nicht" vorstellen als eine Serie wie "Perry Rhodan", die alleine schon wegen ihres Umfangs - derzeit so um die 2500 Romane, und das bloß aus der Hauptreihe - ungefähr jede Idee in Sachen Plot, Setting, Alienbiologie und Technikkonzeption bereits verbraten haben muss?
Totengräber also, oder genauer gesagt: Thanatologe. Unter dieser Bezeichnung reist der Anti-Held des Romans, Turil, durch den Kahlsack: Eine höchst merkwürdige, nach außen vollkommen abgeschottete Weltraumregion, in der in etwa 30.000 Sternensystemen fast ebensoviele verschiedene intelligente Rassen leben. In natürlicher Evolution entwickelt hat sich keine davon hier - sie waren eines Tages einfach da, wie eingeschaltet. Einige Romanfiguren argwöhnen daher, dass sie in der gigantischen Petrischale eines kosmischen Experiments leben (... oder vielleicht auch im virtuellen Raum eines großen Computerspiels, argwöhnt der Leser). In der Beschreibung einzelner Kulturen lässt Thurner seine Fantasie wild drauflosgaloppieren: Etwa gleich in der Eröffnungssequenz, in der der pflanzliche Eigentümer einer Plantage hilfos mitansehen muss, wie sein Anwesen - gefolgt vom ganzen Planeten - durch einen nanotechnologischen Angriff verwüstet wird. Fortpflanzungsfixierte Insekten-Clans, Kristallwesen und vieles mehr werden später dazukommen: Thurner brennt ein Exotik-Feuerwerk voller skurriler, teilweise humoriger Einfälle ab, das an Iain Banks' Ideen für die galaktische Nachbarschaft der Menschheit denken lässt. Menschen im eigentlichen Sinne kommen in "Turils Reise" übrigens keine vor - nur verschiedene körperlich ähnliche Humanes-Völker wie auch das von Turil.
Und so viele Kulturen es gibt, so vielfältig sind auch die Beerdigungsriten - bemerkenswerterweise wird übrigens zumindest in den hier geschilderten Fällen Tötung und Bestattung in einem gemeinsamen Akt kombiniert. Thanatologen beherrschen das gesamte Repertoire, entsprechend hoch ist das Ansehen ihres Standes. Und nichtsdestotrotz hasst Turil, der seine Umgebung nüchtern bis zynisch betrachtet, seinen Beruf: die Farce der pompösen Zeremonien ebenso wie den Verwaltungskram. Im Grunde hasst er sein Leben - und für schwarze Gedanken reist er auch noch im schlimmstmöglichen Transportmittel durchs All: Seine riesenhafte Totenbarke ist eine Art fliegendes Geisterschloss voller morbider Requisiten für die verschiedenen Zeremonien, virtuellen Abbildern mit den gespeicherten Persönlichkeiten ehemaliger "Kunden" und einem als "Licht" und "Schatten" bezeichneten Duo künstlicher Wesen, die ihn als angebliche Psychohygiene-Berater in den Wahnsinn treiben. Wohinter die machtlüsterne Schiffs-KI steckt, die nicht lokalisierbar ist, möglicherweise in einem Drohnenkörper durch die Gänge trippelt und Turils Paranoia immer weiter steigert. Wenn der aufmüpfige Turil von seinem HighTech-Arbeitsmantel im Auftrag der KI mal eben zusammengequetscht wird, bringt dies am besten auf den Punkt, was "Turils Reise" trotz allem Exotismus so leicht zugänglich macht: Letztlich geht es um die Nöte eines von seinem Beruf Frustrierten, der nach und nach die Bedeutung der Songzeile Freedom's just another word for nothing left to lose zu erkennen beginnt.
Ein wenig unterläuft Thurner dann seine originelle Plot-Idee und wechselt doch noch auf die Ermittlerschiene: Denn parallel zu Turils Werdegang tut sich im Kahlsack Katastrophales: Ein als Kitar bezeichnetes Volk verwüstet Planet um Planet, ohne dass dahinter ein Sinn erkennbar würde (die, die glauben in einer Petrischale zu leben, sehen in ihnen allerdings die Killerviren). Mit ihrem oben erwähnten Angriff haben die Kitar Turil eine wichtige Zeremonie versaut - und es war nicht das erste Mal, dass sich ihre Wege kreuzten. Nicht zuletzt aufgrund persönlicher Betroffenheit macht er sich also daran, die Hintergründe ihres Vernichtungsfeldzugs aufzuklären. Ebenso wie Kix Karambui, der als Generalsekretär der notorisch finanzschwachen Überorganisation ARMIDORN eine Art robotischen Ban Ki-moon abgibt und ähnlich populär ist wie sein irdisches Pendant. Und dabei ahnt noch nicht mal irgendjemand, was ihn wirklich so umtreibt ... Am Ende wird es einige Überraschungen geben, doch es werden auch einige grundlegende Fragen offenbleiben - ein weiterer Besuch im Kahlsack scheint daher nicht ausgeschlossen. Eine durchaus reizvolle Vorstellung! Teil welchen Experiments die Kahlsack-Bewohner auch immer sein mögen - Thurners schriftstellerisches Experiment ins nächstgrößere Format aufzusteigen ist jedenfalls geglückt.
Und nächsten Monat ... wird es wieder eine Rundschau geben, mehr lässt sich vorerst nicht sagen. Fast alle Neuerscheinungen in meinem Regal sind Riesenschinken, die Auswahl wird daher primär eine Frage der Zeitökonomie sein. (Josefson)