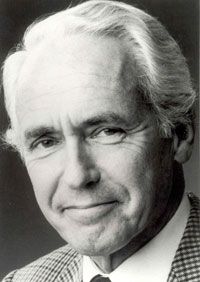
Wolf Schneider über Blogs und Social Media: "Journalisten haben gerade eine so wichtige Aufgabe wie noch nie, nämlich Ordnung zu schaffen und zu überprüfen: Kann das stimmen und muss das dringend verbreitet werden?"
"Es wird etwas nicht automatisch gelesen, weil es geschrieben worden ist", richtet Wolf Schneider den Bloggern im derStandard.at-Interview aus. "Wenn sie denn gelesen werden wollen, müssen sie sich ein wenig plagen und ein paar Regeln befolgen", so der Sprach- und Medienkritiker. Wie man gut und lebendig schreibt, erklärt Schneider im neuen Buch "Deutsch für junge Profis". Mit Saskia Jungnikl sprach er über Facebook und Twitter als Recherchequelle, Online-Journalismus, die Veränderung der Sprache und sein Videoblog auf sueddeutsche.de.
derStandard.at: Sie sind 84 und schreiben ein Buch für "junge Profis". Heißt das, allen sprachlichen Veränderungen zum Trotz bleibt die Basis des Schreibens immer gleich?
Wolf Schneider: Die Basis bleibt sich wenigstens dann gleich, wenn man gelesen werden möchte. Die Bibel ist so geschrieben und so übersetzt, dass man sich heute eine Scheibe abschneiden könnte. Die Grundzüge einer lebhaften Kommunikation bleiben unverändert. Einzelheiten ändern sich.
derStandard.at: Sie schreiben in Ihrem Buch, zwischen Journalisten und Bloggern herrsche Krieg. Wertet der Blogger die Arbeit des Journalisten ab?
Schneider: Dafür gibt es viele Indizien. Viele Blogger verachten in der Tat Journalisten, weil diese auf ihren Pfründen sitzen, und die Blogger fühlen sich schneller, moderner und unabhängig davon, dass die Journalisten die Informationen erst filtern müssen.
derStandard.at: Sie haben in einem Interview gesagt, Sie hätten Mitleid mit den Bloggern. Sollten sich die meisten lieber ein paar Freunde suchen, als ihre Befindlichkeiten im Netz auszubreiten?
Schneider: Mitleid ist ein starkes Wort. Es ist offenkundig, dass viele Blogger zufrieden damit sind, dass sie etwas geschrieben haben, das die Chance hat, von irgendjemandem einmal gelesen zu werden. Für viele liegt also die Selbstdarstellung im Vordergrund. Früher gab es das nicht, da hätte man jemanden einen Brief schreiben sollen, oder tausend Briefe. Aber offenkundig haben sehr viele der Blogger die Hoffnung oder das Bestreben, dass sie nicht nur geschrieben haben, sondern auch gelesen werden. Und da kann man sagen, in neun von zehn Blogs, die ich mir so aus dem Netz fische, denke ich mir: Liebe Leute, das habt ihr falsch angefangen. Es wird etwas nicht automatisch gelesen, weil es geschrieben worden ist. Wenn ihr damit anfangt, dass euch der Kaffee heute nicht so gut schmeckt wie gestern, so muss man davon ausgehen: Den zweiten Satz in diesem Text will keine Sau mehr lesen.
derStandard.at: Was ist ein guter Blog?
Schneider: Das ist eine Qualitätsfrage, die ich in dieser Form nicht beantworten kann. Mir geht es immer nur darum: wie muss ein Text beschaffen sein, damit er das statistisch Unwahrscheinliche erreichen kann, nämlich gelesen zu werden. Journalisten leben damit, dass es die Ausnahme ist, dass ein Dreispalter in einer Zeitung bis zum letzten Satz gelesen wird. Dieses Übergewicht des Geschriebenen über das Gelesene hat sich dramatisch verstärkt. Demzufolge haben Blogger hier noch mehr Grund darüber zu grübeln: Wenn sie denn gelesen werden wollen, müssen sie sich ein wenig plagen und ein paar Regeln befolgen. Und darin ermutige ich sie und diese Regeln nenne ich ihnen.
derStandard.at: Viele Redakteure nutzen bereits Facebook und/oder Twitter als Recherchequelle. Was ist dabei der Vorteil, worin liegt die Gefahr?
Schneider: Der Vorteil ist, dass man an viele Informationen herankommt, die man so früher nicht hatte. So hat der neue Chefredakteur der deutschen Nachrichtenagentur dpa vernünftigerweise gesagt, Blogs und Twitter müssen wir sichten: Da ist eine Riesenmenge an Informationen im Netz, aber nun müssen wir wägen und sortieren. Die bloße Tatsache, dass aus diesem Blog etwas kommt und wenn es auch aus China kommt, besagt noch nicht, dass es etwas mit der Wahrheit zu tun hat. Dass man Lügen und Irrtümer hier vollkommen ungefiltert verbreiten kann, ist eine große Gefahr. Deswegen haben Journalisten gerade eine so wichtige Aufgabe wie noch nie, nämlich Ordnung zu schaffen und zu überprüfen: Kann das stimmen und muss das dringend verbreitet werden?
derStandard.at: Sehen Sie diese Aufgabe erfüllt?
Schneider: Normalerweise gehen Journalisten mit den Blogs überhaupt nicht um. Das ist ja eine Ausnahme, wie es die dpa macht. Viele Journalisten sind hochnäsig oder haben nicht die Zeit. Es ist ein Rohstoff, an dem die eigenen journalistischen Tugenden ansetzen müssen.
derStandard.at: Ist Spiegel Online der einzige Online-Journalismus, den Sie verfolgen?
Schneider: Ja, aber das ist kein Werturteil über die anderen. Ich kann halt nicht alles lesen. Spiegel Online bietet guten Journalismus, der sich nicht wesentlich von der gedruckten Ausgabe unterscheidet.
derStandard.at: Sie glauben, dass die Tageszeitungen aussterben werden: Sollte einem das wehtun?
Schneider: Mir natürlich, als einem alten Zeitungsmenschen. "Aussterben" meine ich auch nicht, sondern, dass sie es schwer haben werden zu überleben. Eine häufige Prognose, die mir auch psychologisch einleuchtet, lautet: Wochenzeitungen werden es leichter haben. Die Zahl der Menschen, die, nachdem sie sich täglich schnell im Internet informiert haben, einmal pro Woche Hintergrundinformationen lesen wollen, wird größer sein als die, die täglich neben der Internetnutzung auch noch ein halben Pfund Papier auf dem Tisch haben wollen.
derStandard.at: Der Verein Deutsche Sprache sieht eine "Affensprache" kommen, eine Verflachung unserer Sprache. Sehen Sie eine solche Entwicklung?
Schneider: "Affensprache" ist ein Wort, das ich niemals wählen würde. Alles in allem ist es unstreitig, dass es mit der Sprachkultur zurückgeht, soweit es die Menge der Menschen angeht, die sie haben. Ich bilde seit dreißig Jahren Journalisten aus, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und die Zahl der Leute, die noch korrekte Grammatik schreiben, die noch korrekte Zeichensetzung verwenden können, sinkt. Meine Prognose lautet: Wir werden wieder etwa zum Stand der Goethe-Zeit zurückkommen, als die Zahl der Menschen, die gutes Deutsch schrieben und gerne lesen wollten, ein Zehntel so groß war wie heute.
derStandard.at: Wer wäre eigentlich in der Verantwortung, Kindern, Heranwachsenden den Umgang mit der Sprache beizubringen?
Schneider: Oh Gott, in der Verantwortung wären Eltern und Lehrer. Wäre der Computer nie erfunden worden, hätten wir wahrscheinlich besseres Deutsch. Aber wer hat die Verantwortung?
derStandard.at: Der hohe Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund verändert auch die Sprache. Vor allem unter Jugendlichen ist es modern, ein Deutsch zu verwenden, das sich an keine grammatikalischen Regeln hält. Wie geht es Ihnen damit?
Schneider: Ich habe leider wenig Kontakt dazu. Ich merke mitunter in der U-Bahn oder lese allerlei darüber, dass auch 15-Jährige, die zwar Deutsch als Muttersprache haben, ihre Sprache dementsprechend ändern. Aber was ich wirklich beurteilen kann, ist die Kenntnis von jungen Berufsschreibern. Was bei denen passiert, das weiß ich genau.
derStandard.at: Wer spricht das bessere Deutsch, die Deutschen oder die Österreicher?
Schneider: Da erkenne ich keine regionalen Unterschiede. Die Probleme der 20- bis 25-Jährigen, mit denen ich beinahe hauptberuflich umgehe, sind in allen drei deutschsprachigen Ländern die gleichen.
derStandard.at: Gibt es ein österreichisches Deutsch?
Schneider: Naja: Es gibt ja den Paradeiser und so weiter. Das geschriebene Deutsch - von einigen Unterschieden im Wortschatz abgesehen - unterscheidet sich im gesamten deutschen Sprachraum nicht.
derStandard.at: Wäre es notwendig, Kindern eine gewisse Mediengewandtheit beizubringen? Ein Wissen, wie man Medien konsumieren sollte?
Schneider: Wer soll das machen? Das Entscheidende wäre, ein bisschen Misstrauen gegen den Computer. Das Entscheidende wäre, dass es noch Familien gäbe, bei denen man jeden Abend eine Stunde mit den Kindern beim Abendessen sitzt und in der Zeit kein Fernsehapparat oder Computer laufen darf, sondern geplaudert wird.
derStandard.at: Verändert sich die Sprache und das Lesen durch die Verlagerung ins Internet?
Schneider: Ja, insofern als ein sorgfältiger Umgang mit der Sprache immer seltener wird - als es für jeden erlaubt ist, irgendetwas in seinen Computer zu schreiben und das geht dann in die Welt hinaus. Sprachprodukte, die besonders schwach, langweilig oder schlecht sind, in die Welt hinaus zu lassen - das gab es früher nicht.
derStandard.at: Sie sagen, die "Bild"-Zeitung ist ein Beispiel für brillante Sprache...
Schneider: "Brillante" nicht. Nein. Was mich an der "Bild"-Zeitung stört, sind die Stoffe, über die sie schreibt. Ich will niemals etwas über Oliver Pocher und seine Freundin lesen, aber wenn ich davon absehe, bedienen sie sich eines sauberen, gut verständlichen und grammatisch korrekten Deutsch. Es gibt Texte, die könnten genauso gut bei Luther, bei Goethe oder der "Bild"-Zeitung stehen - und das sind dann gute Texte. Sie ringen um den Leser. Wenn sie es als Zeitung fertig bringen, was wir alle wollen, nämlich gelesen zu werden, verdient das auf jeden Fall einmal Respekt. Mit der Qualität dessen, was sie berichten, hat das nichts zu tun.
derStandard.at: Hans Dichand, der Herausgeber der Kronen Zeitung, hat einmal gesagt, man müsse dem Volk ein klein wenig voraus sein, aber nicht zu weit, so dass es noch nachkommt.
Schneider: Wir alle mögen es ja, mit einer Sprache umzugehen, die etwas komplizierter ist, als unsere eigene. Kleine Kinder lieben Gedichte und könnten selbst keine machen. Ob das die Kronen Zeitung schafft, kann ich nicht beurteilen. Ich habe kein starkes Bedürfnis Herrn Dichand nach dem Munde zu reden, aber ich glaube, er hat tendenziell recht.
derStandard.at: Sie waren vorwiegend Print-Journalist und machen jetzt einen Videoblog auf sueddeutsche.de. Nun hat man das Gefühl, immer mehr Printjournalisten lesen Ihre Texte als Videoblog ab. Reicht das - bzw. was macht einen guten Videoblog aus?
Schneider: Ich sehe hier keinen grundsätzlichen Unterschied - sieht man von einer Live-Sendung ab. Wir hören ja immer. Die Schrift ist eine späte Zutat zur Sprache. Wir setzen sie während des Lesens in unserem inneren Ohr um. Man muss immer einfach Sätze liefern, ob für das Reden oder für das Schreiben. Das Nicht-zurück-Hören-Können des Hörers entspricht zu 98 Prozent dem Nicht-zurück-Lesen-Wollen des Lesers. Ich denke doch gar nicht daran, einen Satz in der Zeitung zweimal zu lesen, weil ich ihn nicht verstanden habe. (Saskia Jungnikl, derStandard.at, 6.4.2010)