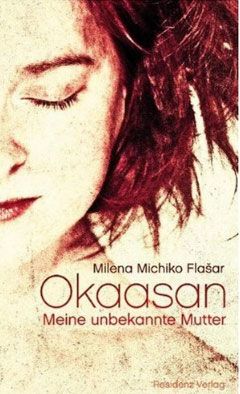
Eine Mutter verschwindet. Ihre Alzheimer-Erkrankung entfernt sie langsam aus dem Leben. Franziska, ihre Tochter, lernt die vergehende Mutter dabei neu kennen: Als Kind in Japan, das vom Vater verlassen wurde, das gerne Klaviermusik hört, das zur Frau heranwächst, die sich entfremdet fühlt und voller Sehnsucht in die Welt zieht, um einen Unbekannten zu heiraten. Der Weg zur Mutter beginnt mit dem japanischen Wort für sie, Okaasan.
Okaasan überschreibt auch den Text der 1980 in St. Pölten geborenen Autorin Milena Michiko Flašar, der in einem zweiten Teil Franziskas Reise zu einer mythischen Urmutter in einem indischen Ashram begleitet. Die Suche kehrt sich nach innen, wird zur Selbstsuche und zum poetischen Gleichnis.
Wie bereits in Flašars Erstlingswerk Ich bin bedeutet diese konkrete Handlung aber nur den Boden, der aus luftigen Höhen lyrischer Wahrheitssuche überblickt wird. Die Sätze reihen sich, um zu abstrahieren, zu suggerieren, nicht um den Handlungsstrang in konventionellem Realismus oder Tiefe der Charaktere zu erden.
Flašars Vorstellungen einer lyrisch objektivierten Sprache mögen in einer Passage aus Okaasan durchscheinen, in der ein Schrift-steller-Freund Franziska Ratschläge gibt: "Wenn du schreibst, flüsterte er, schreib mit Vorsicht! Ich habe gelernt, dass es eine andere Sprache als die der Anklage geben muss. Eine Sprache, die jenseits aller Verletzungen steht und die - trotzdem - die Dinge benennt."
Im besten Fall ergibt das Benennen der Dinge jenseits romanhafter Konkretisierung überraschende, gewohnter Wertkonventionen entkleidete und in ihrer Schönheit sich selbst genügende Metaphern, im schlechtesten Fall schwelgerische Plattitüden. Doch um den Preis nur einiger hohler Lyrik-Phrasen führt melodischer Sprachrhythmus mit traumwandlerischer Sicherheit durch die poetischen Sinngeflechte. In der Haupterzählung von Ich bin, die das Werden und Vergehen einer jugendlichen Liebe beschreibt, neigt sich dieses Verhältnis noch mehr in Richtung ungebremsten Sprachflusses als in Okaasan.
Dass Franziska die Perspektive einer 48-Jährigen nicht ganz abzunehmen ist - zu viel naiv-jugendlicher Aufbruch spricht aus ihr -, bleibt eine oberflächliche Unstimmigkeit, die in der Welt von Okaasan wenig bedeutet. Denn hier soll Muttersein, Kindsein mit Hilfe einigen poetischen Talents in größere Zusammenhänge gestellt werden: Die beiden Kapitel, die an der Oberfläche auseinanderzufallen scheinen, spiegeln, verdoppeln die Geschichte einer Menschwerdung.
Da die Mutter, die in ihrem Zerfall keine Mutter mehr ist, sondern in der Reise zu einem früheren Ich in ihren Verletzungen und Sehnsüchten als Person kenntlich wird. Dort Franziska auf ihrem Bilderbuch-Selbstfindungstrip bei der indischen Übermutter, die sie lehrt, die eigene Vergangenheit zu bewältigen, Verletzungen und Sehnsüchten wieder ins Auge zu sehen. Die Mutter, die ihre Rolle aufgibt, befreit das Kind von ihrer Autorität, um den Weg zur Selbstfindung zu bereiten. Andere Mütter- und Väterfiguren, die im Text vorkommen, erscheinen als Leid schaffende Manipulatoren, die aus Liebe und Angst keinen Freiraum geben, niemals eine Blöße zulassen oder nur im Leid Erfüllung finden.
Franziskas Mutter heißt Miyuki, was, wie die Autorin erläutert, je nach Schreibweise "tiefer" oder "schöner Schnee" bedeutet. Dass metaphorische Schneestürme Miyukis letztes Darben umwehen, dass im Altersheim eine mysteriöse Frau Winter auftritt, die Franziska auf die Reise in ihren indischen Sommer weist, und viele weitere unterirdische Fügungen verweben das große Lied vom Vergehen, Entstehen und der Sehnsucht nach Einssein mit sich.
Das Bemühen um Ehrlichkeit scheint romanhaftes Kalkül zu verdrängen: Man glaubt der Autorin, dass sie etwas sagt, was sie wirklich sagen will. Der Preis dafür ist die Reduktion auf einen Stil poetischer Mythenschreibung. Flašars mutige Erzählweise schafft eine ausbalancierte Waage zwischen Handlung und lyrischer Verklärung, zwischen Welt und Wahrheitssuche. (Alois Pumhösel, ALBUM - DER STANDARD/Printausgabe, 08./09.05.2010)