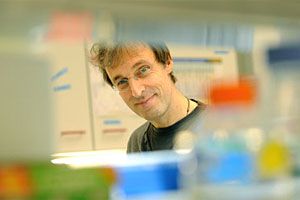
Andreas Heitger: "Das Immunsystem ist sicher kein Legobaustein
STANDARD: Das Immunsystem, so das allgemeine Verständnis, schützt den Körper vor Angriffen. Sehen Sie das auch so?
Heitger: Infektabwehr ist nur ein kleiner Teil seiner Aufgaben. Das Immunsystem ist für Vieles im Organismus zuständig: Es hat eine Art Hausmeisterfunktion und wacht über das System. Im menschlichen Körper gibt es hunderte verschiedene Zellarten und zirka 50 Milliarden Zellen, die großteils einem steten Umbau unterworfen sind. Das Immunsystem muss abgestorbenes Gewebe abtransportieren oder reparieren und gewährleisten, dass Fehler entdeckt werden. Aus meiner Sicht zentral ist die Tatsache, dass das Immunsystem nicht separat zu betrachten ist, sondern in viele Körpervorgänge involviert ist. In der herkömmlichen medizinischen Terminologie dominiert viel zu häufig ein Kriegsvokabular, um immunologische Prozesse zu beschreiben. Das ist aus meiner Sicht ein falsches Verständnis.
STANDARD: Warum verwendet die Wissenschaft Kriegsterminologie?
Heitger: Ich denke, das beruht auf einem simplen Freund-Feind-Denken und ist letztlich der irreführende Versuch, die Komplexität der Materie irgendwie verständlich auszudrücken. Die eigentliche Aufgabe des Immunsystems ist es, Reize aus der Umwelt integrativ zu verarbeiten und mit möglichst wenig Energie und Aufwand den Organismus aufrecht zu erhalten.
STANDARD: Es verändert sich doch aber ständig?
Heitger: Genau, ein junges Immunsystem ist anders als ein älteres. Zeitlebens ist es ein dynamisches, ständig lernendes und immer aktives System ist. Unter Umständen ist das Immunsystem dem Gehirn in Aufbau und Funktion ähnlich. Beide verarbeiten ständig Informationen von innen und außen. Dieser Aspekt wird zu wenig berücksichtigt.
STANDARD: Darüber, wie Denken funktioniert, rätselt aber doch die Forschung...
Heitger: Das Problem ist, dass wir es bei Hirnforschung so wie bei der immunologischen Forschung mit extrem komplexen Systemen zu tun haben. Der menschliche Geist hat aber von vornherein immer einen reduktionistischen Ansatz. Das heißt: Wir tendieren dazu, lineare Bezüge herzustellen. Wir wissen, dass dieser Denkansatz in vielen Bereichen nicht funktioniert. Das Immunsystem ist sicher kein Legobausteinkasten. Eher funktioniert es als System so wie ein Ameisenhaufen. Im Vergleich betrachtet, sezieren wir in der medizinische Forschung ein paar einzelne Ameisen, aber die dafür bis ins kleinste Detail, daraus lassen sich aber keine Rückschlüsse auf das gesamte System des Ameisenhaufens ziehen. Doch das versucht moderne medizinische Forschung.
STANDARD: Was wäre ein adäquater wissenschaftlicher Zugang?
Heitger: Wie funktioniert Selbstorganisation? Was wissen wir über Schwarmtheorie? Das sind interessante Fragen. Ein Schwarm beispielsweise funktioniert nach den Prinzipien der Selbstorganisation und nur dann, wenn es keinen Führer gibt und die Hierarchie flach ist. Das hat man bei Vogelschwärmen beobachtet._Die Vögel im Schwarm achten nur auf vier oder fünf Nachbarn. Wenn es einen Führer gibt, stoßen sie zusammen. Aber wie ein Schwarm genau funktioniert, ist vollkommen unklar. Ich denke, dass das Immunsystem unter Umständen nach ähnlichen Prinzipien aufgebaut sein könnte. Netzwerke sind ein Schlüsselbegriff. Medizinische Forschung sollte sie viel mehr in ihr Denken integrieren und nicht versuchen, alles auf singuläre molekulare Mechanismen zu reduzieren.
STANDARD: Was ist der Grund für diese Sichtweise?
Heitger: Ich glaube, es beruht auf der Forderung nach simpler Ursache-Wirkungsweise, also Mechanismen für einen bestimmten Effekt zu identifizieren. In anderen Fächern ist die Frage des Informationstransfers längst ein zentraler Forschungsgegenstand, etwa in der Physik. Medizin und Biowissenschaften hinken hinterher. Da hält man an der Vorstellung fest, dass Information und Materie untrennbar aneinander gekoppelt sind. Vielleicht hat aber auch die Pharmaindustrie ihren Anteil, weil sie sich naturgegebenermaßen auf Moleküle spezialisiert.
STANDARD: Warum?
Heitger: Weil sie sich industriell herstellen und als Medikamente verkaufen lassen. Kein singuläres Molekül oder Botenstoff kann Probleme wie die Krebsentstehung lösen.
STANDARD: Aber die ganze Krebsforschung ist doch auf dieser Molekül- und Targetsuche aufgebaut?
Heitger: Da ist der Wunsch stärker als die Erkenntnis. Wir wissen, dass ein Molekül nicht nur eine Aufgabe hat, sondern immer im Netzwerk agiert. Sämtliche Körperfunktionen sind stets mehrfach abgesichert, zudem sind sie zeit-, dosis- und kontextabhängig.
STANDARD: Gibt es denn keine Knotenpunkte?
Heitger: Doch, in diesen Netzwerken gibt es Knotenpunkte, etwa das BCR-ABL Gen, das bei der Chronischen Leukämie im Erwachsenenalter eine zentrale Rolle spielt. Da konnte auch ein Medikament, Glivec, entwickelt werden. Ich denke aber, dass dies eher Ausnahmen sind und die Illusion nähren, mit einem Schlag ein Problem wie Krebs lösen zu können. Robuste Systeme haben tendenziell eher wenige verletzbare Stellen. Medikamente aus der gleichen Substanzklasse wie Glivec wirken interessanterweise auch nach Transplantationen gegen Graft-Versus-Host-Erkrankungen, eine Abstoßung, die manchmal nach Stammzelltransplantationen auftritt. Warum, ist nicht bekannt.
STANDARD: Wie nähern Sie sich der Erforschung von Leukämie?
Heitger: In der Transplantationsimmunologie erforschen wir, was passiert, wenn wir das Knochenmark eines Spenders in den Organismus eines Leukämie-Patienten, dessen Knochenmark zuvor durch Chemotherapie zerstört wurde, implantieren. Das besondere daran:_Mit dem Knochenmark implantieren wir auch ein neues Immunsystem in den Körper, denn die Zellen des Immunsystems werden im Knochenmark produziert. Wir erforschen, wie sich das fremde Immunsystem zurechtfindet. Konkret geht es um genau um Graft-versus-host. Sie kann lebensgefährlich sein. Wir versuchen, den Prozess der gegenseitigen Anpassung zu begleiten und den Organismus zu unterstützen - etwa dadurch, dass wir gezielt im Labor hergestellte T-Zellen für transplantierte Patienten aufberereiten, damit der Körper besser mit Infektionen zurecht kommt ohne eine Graft-versus-Host-Erkrankung zu entwickeln.
STANDARD: Aber damit operieren auch Sie mit Bausteinen des Immunsystems, eben den T-Zellen?
Heitger: Übergeordnet geht es um die Toleranzinduktion des Immunsystems. Wir versuchen aber unseren linearen Ansatz innerhalb eines komplexen, kontextabhängigen Umfelds zu sehen. Große Hoffnungen setzen wir in Computermodelle, die komplexe Systeme simulieren. Da kooperieren wir mit israelischen Forschern, konkret mit Irun Cohen, dessen Ansichten zu Immunologie (Buchtipp: Tending Adam‘s Garden)neue Wege aufzeigen. Systemimmunologie, das ist das Fernziel.
STANDARD: Nähert man sich so den Ursachen von Krankheit gezielter?
Heitger: Es geht grundsätzlich darum, wie unterschiedliche Reize aus der Umwelt von einem Organismus verarbeitet werden. Darüber, dass es in manchen Aspekten eine simple Dosis-Wirkung-Korrelation gibt, herrscht Einigkeit, etwa Rauchen und Lungenkrebs. Viel schwieriger zu erforschen sind jedoch unterschwellige Reize. Sie genau zu analysieren und eventuell bestimmte krankheitsverursachende Momente ausfindig zu machen, ist ungemein schwierig. Unmöglich, denke ich.
STANDARD: Was ist der Vorteil solcher komplexen Systeme?
Heitger: Das Immunsystem muss einerseits auf verschiedene Reize sehr fein abgestimmt reagieren, es muss gleichzeitig aber auch sehr robust sein. Diese konträren Anforderungen, die das Überleben sichern, erfordern viele unterschiedlichen Strategien. Diese Vielfalt ist nur in komplexen Systemen möglich.
STANDARD: Sie kritisieren etablierte Denkmuster in der medizinischen Forschung. Warum?
Heitger: Die Frage ist doch, nach was wir suchen. Dass wir uns hauptsächlich mit Proteinen beschäftigen,rührt daher, dass sie industriell herstellbar und dadurch leichter zu erforschen sind. In der Immunologie sind zum Beispiel auch Blutfette wichtig. Sie führen aber ein Schattendasein, weil ihre Synthese zu zeit- und kostenaufwändig ist. Generell geht es in der Schulmedizin vordergründig um das simple Ursache-Wirkungsprinzip. Als Beweis braucht man immer einen Stoff, um einen Effekt zu erzielen. Ich denke, diese materialistische Sicht ist nicht zeitgemäß.
STANDARD: Was dann?
Heitger: Die Erforschung des Informationstransfer. Stellen wir uns vor, Zellen wären Handys. Wir zerlegen sie, kennen die Bestandteile und den Bauplan. Daraus allein ergibt sich aber nichts über die Nachrichten, die per Handy übermittelt werden. Ähnlich ist es mit Zellen und Molekülen. Wir sollten uns viel stärker auf diese Kommunikationspotenzial konzentrieren. Dann könnte es nämlich gut sein, dass der Biomedizin eine große Revolution erst bevorsteht - so ähnlich wie die Relativitätstheorie die Physik verändert hat. (Karin Pollack, DER STANDARD, Printausgabe, 27.12.2010)