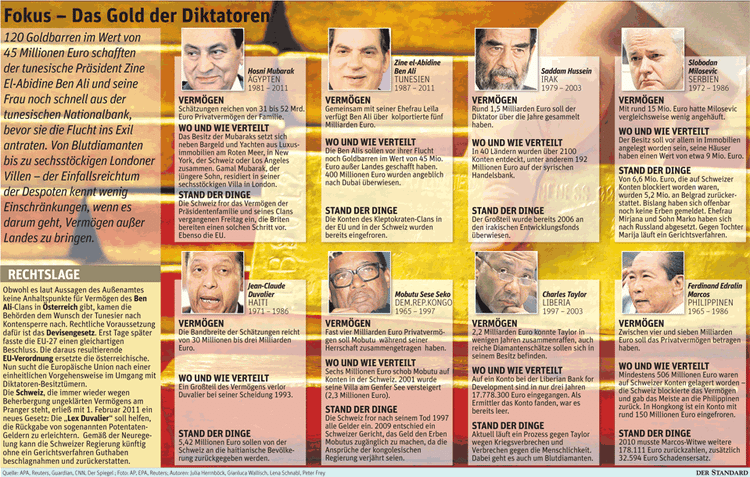
Der ägyptische Ex-Präsident Mubarak soll mehr Geld besitzen als Bill Gates. Auch Tunesiens Ben Ali hat sich gut versorgt. Die von Ägypten von der EU geforderte Kontensperre könnte jedoch auf sich warten lassen.
***
In seiner Rolle als ägyptischer Staatschef erhielt Hosni Mubarak monatlich 598 Euro Salär.
Angesicht der Tatsache, dass fast 40 Prozent seiner Landsleute mit weniger als 1,5 Euro pro Tag auskommen müssen, gar kein schlechter Verdienst. Wie der Ex-Präsident, seine Frau Suzanne und seine zwei Söhne Alaa und Gamal das unfassbare Vermögen - die Schätzungen internationaler Finanzexperten schwanken zwischen 31 und 51 Milliarden Euro - zusammengespart hat, wird dieser Tage heiß diskutiert. Ein Großteil stamme aus der Privatisierungswelle in Ägypten, sowie aus Waffen- und Immobiliendeals.
Stimmt die Summe auch nur annähernd, wäre Mubarak demnach reicher als Bill Gates - offizielle Bestätigungen dafür gibt es dafür bisher allerdings keine.
Auch das Privatvermögen von Tunesiens Ex-Staatschef Zine El-Abidine Ben Ali und des Trabelsi-Clans, angeführt von seiner Frau Leila, ist aktueller Gegenstand von Spekulationen. Weltweit wird nun nach den Geldern der zwei ehemaligen arabischen Diktatoren gefahndet.
Die Schweiz hat die Konten beider Despoten inzwischen eingefroren. Antikorruptionsexperten fordern auch andere Staaten dazu auf, ihrem Beispiel zu folgen. Neben Deutschland und Großbritannien, wo große Teile jener Vermögen vermutet werden, habe auch Österreich entsprechende Rechtshilfe-Ansuchen erhalten, bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Alexander Schallerberg, dem Standard.
Prinzipiell beabsichtige Wien, dem Ansuchen stattzugeben. Zwar könne Österreich eine Sperrung von Konten auch im "prophylaktischen Alleingang" beschließen, doch wolle man einen solchen Schritt mit der EU koordinieren. Zudem besaßen die Mubaraks laut Angaben des Außenministeriums keine Konten im Land.
Österreich sei auch nicht besonders bekannt als beliebtes Anlageland für Despoten-Gelder, weiß Colin Joseph von der weltweit operierenden Antikorruptionsorganisation Transparency International in London. Die Schweiz sei immer noch "The Place to go", so sein Urteil.
Auch wenn sich die Attraktivität der Schweiz durch die eben erst in Kraft getretene "Lex Duvalier" verringern könnte - vorerst bleibt es Land Nummer Eins für das internationale Versteckspiel mit illegal erworbenem Vermögen. "Es spielt auch eine Rolle, aus welchem Land das Geld kommt", erklärt Joseph. Despoten würden sich oftmals an ehemalige Kolonialmächte wenden, weswegen auch große Summen in Großbritannien und Frankreich vermutet werden (siehe unten). Die Banken allerorts profitieren von den hohen Einlagen, bei anderen Veranlagungsformen kommt die Dankbarkeit auf Umwegen zurück, etwa über hohe Auslandsinvestitionen und Importgeschäfte.
Dubai wird populärer
Aufstrebend gilt neben sogenannten Offshore-Gebieten wie den Kanal-Inseln auch Dubai, um die Millionen ins Trockene zu bringen. Liegt das Vermögen der aktuell ins Exil gejagten Despoten in Dubai, wird eine Restitution problematisch, analysiert der Antikorruptionsexperte Joseph: "Dubai hat sich in der Vergangenheit nicht allzu kooperativ mit dieser Art von Übung gezeigt."
Großbritannien und Frankreich zeigen sich noch verhalten, wie mit den geparkten Millionen zu verfahren sei. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble plädiert für eine rasche Prüfung einer EU-weiten Sperre. "Ich glaube nicht, dass es da Probleme gibt", so Schäuble.
Ein trauriges Beispiel für nicht gelungene Restitutionsbemühungen ist der Fall Mobutu Sese Seko, Staatschef der demokratischen Republik Kongo: Als zwischen der Schweiz, wo er fast fünf Millionen Euro zwischenlagerte, und der kongolesischen Regierung keine Einigung erzielt werden konnte, kamen Mobutus Erben zum Zug. (Julia Herrnböck/Gianluca Wallisch/DER STANDARD, Printausgabe, 16.2.2011)