
Cordwainer Smith: "Was aus den Menschen wurde"
Broschiert, 1052 Seiten, € 13,40, Heyne 2011.
Hui. Wo soll man nur beginnen, wenn es um einen Giganten wie Cordwainer Smith geht? Noch dazu wo es sich um meinen Lieblingsautor handelt und "The Dead Lady of Clown Town" in meiner persönlichen Wertung den Platz der besten Science-Fiction-Erzählung aller Zeiten einnimmt? Vielleicht zum Start ein paar objektivere biografische Fakten: Der 1966 verstorbene Paul Myron Anthony Linebarger, der als "Cordwainer Smith" ab den 30er Jahren an seinem großangelegten Erzählzyklus um die Instrumentalität der Menschheit arbeitete, teilte einige Eigenschaften mit der im Vormonat vorgestellten Alice B. Sheldon alias "James Tiptree Jr": Die Konzentration auf kurze Formate und ein unverwechselbarer Stil waren bei beiden ebenso zu finden wie das Verbinden von Spiritualität mit Humanismus ... oder die Geheimniskrämerei um die eigene Autoren-Persona und die Scheu vor dem Kontakt mit Fans. Beide hatten eine kosmopolitische Kindheit verbracht, studierten Psychologie und arbeiteten zeitweise für Geheimdienste. Wobei sich Smiths Vita noch spektakulärer ausnimmt: Als US-Amerikaner war er der Patensohn des chinesischen Diktators Sun Yat-sen und später ein Vertrauter von Maos Gegenspieler Chiang Kai-shek, zudem noch außenpolitischer Berater John F. Kennedys.
Die in zahlreichen Kurzgeschichten und Novellen plus einem Roman geschilderte Welt der Instrumentalität, die sich über einen Zeitraum von zehntausenden Jahren erstreckt, läuft unter dem Begriff "Future History". Sie lässt sich aber alleine schon wegen ihrer Fülle an bizarren Ideen nicht mit anderen Werken des Genres - etwa von Isaac Asimov oder Larry Niven - vergleichen. Wo sonst findet man Menschen, die Tiere zu ihren Ebenbildern umgeformt haben, um sie anschließend wie Gegenstände zu behandeln? Da betreten wir in "Ein Planet namens Shayol" eine Welt der Strafe, deren VIP-Insassen die Demütigung über sich ergehen lassen müssen, dass ihre Körper ohne jede Hoffnung auf Tod ad infinitum überschüssige Organe produzieren und wie Obstbäume abgeerntet werden. Zugleich schwelgen die Bestraften dabei so sehr in chemisch induziertem Glück, dass sie hemmungslos weinen, als ein Befreiungskommando sie aus ihrer Qual erlösen will. Da liegen auf der Oberfläche der Welt Altnordaustralien/Norstrilia wie schnaufende Hügel die kranken Körper gigantischer missgestalteter Schafe, aus denen die Unsterblichkeitsdroge Stroon gewonnen wird. Und Norstrilia schützt sich gegen Diebe, indem es sie durch telepathisch verstärkte Gedankenimpulse einer Meute tobsüchtiger Nerze in den Irrsinn treibt ("Die klainen Katsen von Mutter Hudson"). Die schrecklich patenten FarmerInnen sind der festen Überzeugung, dass Arbeit den Charakter formt - doch zugleich hat Stroon sie so unermesslich reich gemacht, dass einer ihrer Bürger mal eben Mutter Erde aufkaufen kann. In genau kontrollierten Dosen hat Stroon den Menschen galaxisweit zu einer standardisierten Lebensspanne von 400 Jahren verholfen - wie alles in dieser Zukunftswelt streng reglementiert durch die Lords und Ladies der Instrumentalität, die sich dem Glück der Menschheit verschrieben und sie genau dadurch ins Unglück gestürzt haben.
Smiths Werk quillt geradezu über vor surrealen Szenen, die die ProtagonistInnen ebenso nachhaltig beeindrucken wie die LeserInnen: Da schildert ein Veteran, wie China als letzter verbliebener Nationalstaat der Erde Millionen nackter Männer, Frauen und Kinder über der Venus abwarf, um diese per Hand zu kolonisieren ("Als die Menschen fielen"). Ein anderer hat nie so recht begriffen, dass die Instrumentalität seinen Heimatplaneten mit einem winzigen Raumschiff auslöschte, weil er sich nur noch an die 90 Millionen Kilometer lange Attrappe erinnern kann, die als Ablenkung über seiner Welt erschien ("Golden war das Schiff - oh, so golden!"). Der junge Cashier O'Neill sammelt Unterstützung, um den Diktator seiner Heimatwelt zu stürzen ("Planet der Edelsteine"): Eine zumindest anfänglich klassische Abenteuerhandlung, doch in Erinnerung bleiben Bilder wie das von dem Pferd, das durch Stroon unsterblich gemacht und zugleich jeden Lebenssinnes beraubt wurde. In einer eigens für es geschaffenen Illusion galoppiert es schließlich über eine virtuelle Gnadenweide und jubiliert darüber, dass es den Menschen vertraut hat ... Oft erinnern Cordwainer Smiths Geschichten an Träume, die in sich vollkommen konsistent erscheinen, sich nach dem Erwachen aber dem Zugriff des logischen Denkens zu entziehen beginnen.
Anstatt von einer "History" sollte man vielleicht besser von einer "Future Mythology" sprechen. Nicht umsonst hat SF-Herausgeber John J. Pierce ein 1975 geschriebenes Essay, das dieser bislang umfangreichsten deutschsprachigen Smith-Sammlung als Vorwort vorangestellt wurde, im Original mit "Cordwainer Smith: The Shaper of Myths" betitelt. Und wie es Sagenkreise - vom Mahabharata über die Bibel bis zum Silmarillion - so an sich haben, sind sie lückenhaft und manchmal in sich widersprüchlich. Pierce hat auch eine in unserem Zeitalter beginnende Zeittafel der Instrumentalität angefertigt, die zwar für diese Ausgabe nicht übernommen wurde, die aber ohnehin spätestens mit der handlungschronologisch dritten Erzählung ("Modell Elf") in Konflikt gerät. Die Lücken in Smiths Schaffen, das auch nie zu einem Abschluss gebracht wurde, mögen manche LeserInnen frustrieren, sind zugleich aber stete Quelle der Faszination. In so gut wie jede Erzählung fließen geheimnisvoll klingende Begriffe ein, die gerade dadurch die Fantasie beflügeln, dass sie oft ungeklärt bleiben: Wer sind die Heillosen, die in den ersten Jahrtausenden nach unserem Zeitalter zusammen mit den mechanischen Manshonyaggers eines längst versunkenen "Sechsten Deutschen Reiches" durch die Wildnis zwischen den letzten Städten streifen? Wer waren die Daimoni, die einst von der Erde auswanderten und sie bei einem Kurzbesuch mit dem unzerstörbaren Erdhafen beschenkten, der vom Magma unter der Erdkruste bis in die Stratosphäre reicht? Und woher kamen die telepathisch kommunizierenden Tiere, die vor der Gründung der Instrumentalität auf Erden lebten und Erzählungen wie "Modell Elf" oder "Die Königin des Nachmittags" wie Fabeln erscheinen lassen ... und wohin sind sie später wieder verschwunden?
Die inhaltlichen Widersprüche wiederum werden gegenstandslos, wenn man Smiths Werk weniger als Geschichtsschreibung der Zukunft denn als Sammlung von Sagen mit immer wiederkehrenden Motiven betrachtet. Eines davon ist die Feindlichkeit des Weltraums, des Auf-und-Hinaus, für das der Mensch nicht gemacht ist: Schon in "Modell Elf" schreckt ein Telepath vor dem endlosen Himmel zurück, der sein Bewusstsein in sich hineinzuziehen versucht. In der berühmten Erzählung "Scanner leben vergebens", Smiths erster Veröffentlichung, kann die Raumfahrt nur durch den Einsatz verurteilter Krimineller, der Habermänner, bewältigt werden, deren untote Körper gegen die "Große Qual des Weltraums" immun sind. Überwacht werden sie durch Scanner wie Martel, die den Prozess der "Entzweischneidung von Gehirn und Leib" freiwillig durchlaufen haben und als Preis für ihren elitären Status nur kurzfristig und mit technischer Hilfe menschliche Empfindungen zurückerlangen können, wenn sie "unter den Draht gehen".
Die Technologien wechseln im Lauf der Jahrtausende: Auf tausende Kilometer breite Photonensegler folgen Planoformschiffe, die hinab in den Weltraum2 tauchen, während noch später auch der geheimnisvolle Weltraum3 erschlossen wird. Doch die Mechanismen sind stets dieselben: Bedrohliche Kräfte lauern im Kosmos auf den Menschen, treiben Reisende in den Selbstmord oder zu Gewalttaten ("Denk blau, zähl bis zwei") oder manifestieren sich als Energie-Drachen, gegen die die Go-Kapitäne der Planoformschiffe Lichtstecher und deren tierische Kampfpartner ins Feld führen ("Das Spiel Ratte und Drache"). Und auch die beiden allerersten Besuche in Weltraum2 und Weltraum3 enden für den jeweiligen Pionier beinahe mit dessen Tod. Die beiden betreffenden Erzählungen ("Der Colonel kehrte aus dem Nimmernichts zurück" und "Das trunkene Schiff") liegen handlungschronologisch etwa 10.000 Jahre auseinander, in Wahrheit handelt es sich bei der einen um eine posthum veröffentlichte Alternativversion der anderen - der Nebel, der sich durch Smiths Werk zieht, verdichtet sich damit und einmal mehr gleicht es den Sagen und Märchen unserer Welt, deren Motive und Charaktere auch so gut wie niemals zu einem eindeutigen Ursprung zurückverfolgt werden können.
(Weiter auf der nächsten Seite -->)
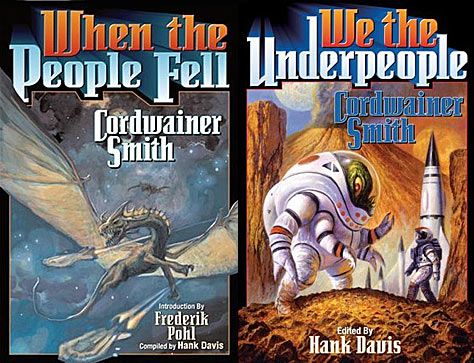
Gesammelte Erzählungen in Englisch: Cordwainer Smith: "When the People Fell" und "We the Underpeople", broschiert, 624 bzw. 619 Seiten, Baen 2007/2008.
Das zentrale Motiv schlechthin in Cordwainer Smiths Schaffen ist das von der Revitalisierung der menschlichen Gesellschaft, denn auf lange Sicht ist Utopia ein ebenso menschenfeindlicher Ort wie der Weltraum. In ihrem Bestreben nach gerecht zugeteiltem Glück für jedermann ist die allfürsorgliche Instrumentalität zu weit gegangen: "... ihr fesselt die Wahren Menschen an ein Glück, das keine Hoffnung und keinen Ausweg besitzt", muss sich ein Lord der Instrumentalität sagen lassen, als er in "Unter der alten Erde" auf eine Gemeinschaft von Flüchtlingen trifft, welche die Welt, in der alle Taten getan und alle Gedanken gedacht sind, nicht mehr ertragen konnten. "Triste, sinnlose Jahrhunderte des Glücks, während derer die Unglücklichen von ihnen korrigiert oder angepasst oder getötet wurden." Doch spiegelt dies nur wider, was bereits in Erzählungen thematisiert wurde, die viele Jahrtausende zuvor angesiedelt sind, als die Wahren Menschen im Bann einer Kaste standen, die sich der Perfektion verschrieben hatte. Das Element der Vitalität brachten damals bizarrerweise drei Mädchen auf die Erde zurück, die am Ende des Zweiten Weltkriegs im Kälteschlaf ins All geschossen worden waren - um schließlich die Instrumentalität zu gründen und mit ihr die alten Fehler zu wiederholen.
Sie leben in Benommenheit, und sie sterben in einem Traum - die hoffnungslose Glückseligkeit hat tiefe Spuren hinterlassen: "Ist das, was du mit mir machst, ein Verbrechen?" fragt das Mädchen Veesey-koosey in "Denk blau, zähl bis zwei" angesichts einer drohenden Vergewaltigung mit derselben vollkommenen Ahnungslosigkeit, mit der andere später über die Bedeutung von Wörtern wie "Gott" oder "Gnade" rätseln werden. Am stärksten wird die Fremdartigkeit der rundum eingelullten Menschheit in "Alpha Ralpha Boulevard" fühlbar: Paul & Virginia steigen den kilometerhohen Erdhafen empor, um sich von einem alten Computer bestätigen zu lassen, dass ihre Liebe echt und nicht von der Instrumentalität verordnet ist. Die Lebensgefahr in schwindelerregender Höhe ist ihnen nicht bewusst - sie haben keine Angst vor dem Tod, weil sie auch keine Ahnung haben, was Leben bedeutet. Und doch befinden sie sich mitten in einem Umbruch: Die Instrumentalität hat ihren Fehler erkannt und mit der Wiederentdeckung des Menschen das größte Projekt aller Zeiten gestartet. Das Zufallselement wird wieder eingeführt, und mit ihm Krankheiten, Unfälle, Verbrechen und Konflikte: Wir beobachteten an der Augenmaschine, wie die Cholera wieder in Tasmanien eingeführt wurde, und wir sahen die Tasmanier auf den Straßen tanzen, weil sie von nun an nicht mehr beschützt wurden.
Paul & Virginia sind übrigens bei weitem nicht das einzige Liebespaar in den 27 hier versammelten Geschichten, auch dieses Motiv zieht sich wie ein roter Faden durch Smiths Werk: Da sind der Scanner Martel und seine Frau Luci, die die Entbehrungen des Lebens mit einem Quasi-Untoten bereitwillig auf sich nahm. Oder Artyr Rambo, der als erster den Weg durch Weltraum3 fand, um zu seiner Elizabeth zu gelangen. Oder die leider einseitige Liebe zwischen dem aus einer Katze gezüchteten Girlygirl K'mell und dem Lord Jestocost, die zwar nicht zueinander finden, aber als BegründerInnen einer sozialen Revolution doch für immer in einem Atemzug genannt werden sollten. Und schließlich die immer wieder zitierte "größte Liebesgeschichte aller Zeiten" zwischen dem Schiffskapitän Mr. Nicht-mehr-grau, der durch die Qualen des Weltraums um viele Leben gealtert scheint, und dem unter den Augen eines ganzen Kontinents aufgezogenen "öffentlichen Mädchen" Helen Amerika. Die Aussichtslosigkeit einer solchen Beziehung treibt ihn in seine Heimat zurück - doch ohne sein Wissen übernimmt Helen das Schiff, in dem er in einer Kältekapsel schläft, und steuert es im Alleingang durchs All, um ihn nach 40-jähriger Reise am Zielhafen zu empfangen ("Die Lady, die mit der Seele segelte"). Zusätzliche mythische Überhöhung erfährt die Geschichte dadurch, dass sie rückblickend erzählt wird - auch unter Erwähnung der Generationen von Schauspielerinnen, die Helen seitdem zu verkörpern versuchten.
... auch das eine ganz typische Erzähltechnik Smiths: Viele Geschichten werden aus der Warte noch fernerer Zukünfte erzählt, manchmal auf den Unterschied zwischen Faktizität und künstlerischer Nachbearbeitung hin beleuchtet ("Die tote Lady von Clowntown"), manchmal überhaupt als reine Legende in Frage gestellt ("Unter der alten Erde") und oft in Liedern und Gedichten besungen. Smiths ganz spezielle Sprache unterstreicht den märchenartigen Charakter: Viele Eigennamen bilden Reimpaare (Baiter Gator, Meeya Meefla, Alpha Ralpha Boulevard, ...), zudem entfalten formelhafte Gesprächsteile und rituelle Wiederholungen eine beinahe hypnotische Wirkung. Die hohe Musikalität von Smiths Stil lässt sich nicht leicht in andere Sprachen übertragen - diese Ausgabe enthält zum größten Teil leicht überarbeitete Versionen der Übersetzungen, die der 2004 verstorbene Thomas Ziegler Anfang der 80er Jahre für die Verlage Moewig und Droemer Knaur angefertigt hatte: Eine gute Wahl, denn noch näher kann man der Wirkung der Originale in einer anderen Sprache nur schwer kommen.
All die genannten Elemente fließen in der überragenden Erzählung "The Dead Lady of Clown Town" aus dem Jahr 1964 zusammen, als Smith den Zenit seines Schaffens erreicht hatte. Im Zentrum der Novelle stehen die Untermenschen - ein schwer belastetes Wort, an dem auf Deutsch aber wohl kein Vorbeikommen war (Underpeople heißt es im Original). Seit tausenden von Jahren werden Tierbabies nach ihrer Geburt solange modifiziert, bis sie im Aussehen kaum und in Intelligenz und Gefühlen gar nicht mehr von Menschen zu unterscheiden sind. Doch haben sie keinerlei Rechte, werden "wie Stühle oder Türklinken" benutzt und mitleidlos vernichtet, sobald auch nur der geringste Zweifel an ihrem Nutzen aufkommt. Mehr als einmal drängt sich der Eindruck auf, dass die, die mit einem Namens-Präfix (etwa K'mell bzw. C'mell für "Katze") gebrandmarkt sind, und die niemals am verordneten "Glück" ihrer blutleeren Herren teilhaben durften, die eigentlichen Wahren Menschen sind. Den Beginn ihrer Emanzipation schildert, einmal mehr aus der Warte der Zukunft, das stark religiös geprägte "Die tote Lady von Clowntown": Auf dem Planeten Fomalhaut III entdeckt die Menschenfrau Elaine auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmmung eine im Untergrund lebende Gemeinde von Untermenschen. Diese klammern sich an eine Prophezeiung, derzufolge das Hundemädchen H'jeanne (D'joan) sie zur Freiheit führen wird. - Keine Prophezeiung eigentlich, sondern Ergebnis einer Kalkulation, die besagte "tote Lady" - das auf einen Computer übertragene Bewusstseinsimprint einer Verstorbenen - in subjektiv endlosen elektronischen Zeitaltern durchgeführt hat: Unter allen möglichen Zukünften errechnete sie nur eine, die Hoffnung bringt - und so zieht eine Generation nach der anderen ein Mädchen namens H'jeanne auf, bis zufällige Umstände die Ereignisse tatsächlich ins Rollen bringen.
... natürlich ist der friedliche Aufstand zum Scheitern verurteilt: Die Revolution dauerte sechs Minuten und erstreckte sich über einhundertzwölf Meter. Während Soldaten die Schädel der Babies zerschmettern, die ihnen die Untermenschenmütter mit der Botschaft der Liebe entgegenrecken, erlangt die messianische Gestalt H'jeanne genauso wie ihre christliche Namensvetterin auf dem Scheiterhaufen Unsterblichkeit. Und doch war die Revolution erfolgreich: In den Text eingebaute historische Bewertungen des Ereignisses machen klar, dass die Untermenschen letztlich ihr Ziel erreicht haben - einfach nur deshalb, weil sie die Menschen zum ersten Mal gezwungen haben, sie wahrzunehmen. Schließlich nimmt der vom Autor geschaffene Mythos solche Wucht an, dass er weit über die fiktive Welt hinausstrahlt, wenn H'jeanne/D'joan unter erstmaliger Weglassung ihres Herkunfts-Präfixes erklärt: "I am Joan, and I am dog no more." - Selbst wenn Cordwainer Smith nichts anderes geschrieben hätte: Alleine schon für "The Dead Lady of Clown Town" wäre er in die Annalen der Science Fiction eingegangen. Unbedingte Empfehlung!
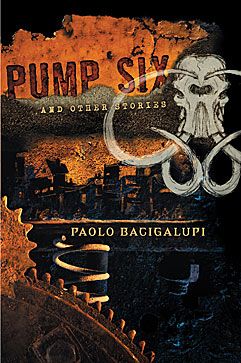
Paolo Bacigalupi: "Pump Six"
Broschiert, 239 Seiten, Night Shade Books 2010.
Während Paolo Bacigalupis phänomenaler Roman "The Windup Girl" (den inzwischen hoffentlich alle in unserem kleinen Lesezirkel verschlungen haben) kürzlich auch auf Deutsch veröffentlicht wurde, ist bereits die Paperback-Ausgabe der Sammlung "Pump Six" erschienen, die Bacigalupis Schaffen vor seinem Roman-Debüt zusammenfasst. Zehn Geschichten aus den Jahren 1999 bis 2008, chronologisch geordnet, demonstrieren, dass der US-amerikanische Neo-Starautor das Schreiben von Anfang an aus dem Effeff beherrschte. Und dass Biotechnologie gewissermaßen Bacigalupis Visitenkarte darstellt, zeigt sich gleich in der ersten und ältesten Erzählung "Pocketful of Dharma": Darin wird der Bettlerjunge Wan Jun zum Zeugen eines Mordes; die Täter engagieren ihn umgehend dafür, einen Datenwürfel mit hochbrisantem Inhalt zu transportieren. Wan Juns Welt sind die verregneten Slums der chinesischen Metropole Chengdu - doch vor Augen hat er stets einen geradezu überirdisch anmutenden neuen Wohnkomplex, der aus lebendem Material geschaffen wird: It was an animal vertical city built first in the fertile minds of the Biotects and now growing into reality. It would stand a kilometer high and five wide when fully mature. A vast biologic city, which other than its life support would then lie dormant as humanity walked its hollowed arteries.
In noch extremerer Form ist die Biotechnologie zum Einsatz gekommen, um "The People of Sand and Slag" zu erschaffen: Auf einer biologisch toten Erde, die zu einer einzigen Giftmüllhalde verkommen ist, haben die Menschen ihre Körper soweit verändert, dass sie sich von jedem beliebigen Material ernähren können und unzerstörbar geworden sind - die SöldnerInnen, die im Mittelpunkt der deprimierend düsteren Erzählung stehen und sich mit Göttern vergleichen, hacken einander gerne mal zum Spaß Gliedmaßen ab ... sie wachsen ja ohnehin nach. Auch die Tier- und Pflanzenwelt hätte man biologisch "anpassen" können, aber das wollte einfach niemand bezahlen. Umso größer die Überraschung der ProtagonistInnen, als sie auf einen versifften und verkrüppelten, aber dennoch lebendigen Hund treffen. Schließlich sind sie aber doch erleichtert, als ihr zeitweiliges Maskottchen, das ständig vor Verletzungen und Vergiftungen geschützt werden musste, endlich krepiert ...
Ökologische Katastrophen und Ressourcenknappheit ziehen sich als Themen durch einen Großteil der Geschichten: In "The Pasho" lassen Quaran-Rituale von Wüstenmenschen noch nach langer Zeit die Seuche erahnen, die einst durchs Land gezogen sein muss. In "The Tamarisk Hunter" sind die Wasserkriege zwischen Kalifornien und seinen Nachbarstaaten, die in unserer Zeit noch auf das juristische Parkett beschränkt bleiben, in eine neue Phase eingetreten. Und wie schon in der Eröffnungsgeschichte erlebt auch hier ein Underdog seine Hilflosigkeit angesichts derer, die genügend Mittel haben, um die hässliche neue Welt zu gestalten - und mit ihrem schwer bewachten Straw Colorado entwässern und entvölkern. - Ähnlich die Szenarien in den beiden Erzählungen, die in derselben Welt wie "The Windup Girl" angesiedelt sind: "Yellow Card Man" ist, bis auf den Namen der Hauptfigur im Wesentlichen unverändert, in den späteren Roman als die Geschichte Hock Sengs eingebaut worden. "The Calorie Man" hingegen führt uns von Thailand in einen anderen Winkel der Welt: Mitten hinein ins Herz der USA, das einem Entwicklungsland ähnelt und biologisch ähnlich tot ist wie die Welt der "People of Sand and Slag". Zwar grünt und blüht hier alles strahlender denn je - doch was da auf den Feldern wächst, heißt TotalNutrient oder SoyPRO, während sich in den Flüssen LiveSalmon tummeln: Die patentierten Lebensformen der großen Biotech-Konzerne habe alles andere verdrängt. Und die Verdachtsmomente aus "The Windup Girl", dass die Pflanzenseuchen, die die Ökosphäre verheert haben, seltsam zeitgleich mit der Fertigstellung der Bio-Patente aufkamen, verdichten sich.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lalji, ein ehemaliger Flüchtling aus Indien, der einen calorie man - also einen Meister-Genetiker - über den Mississippi Richtung Süden schmuggeln soll. Lalji wird im Verlauf der Mission vor eine Entscheidung gestellt werden, wie es Bacigalupi mit seinen Hauptfiguren oft macht: sich ins scheinbar Ausweglose zu fügen oder seinem Gewissen zu folgen. Wan Jun musste diese Wahl auf seine Weise treffen, der Pasho Raphel in der gleichnamigen Geschichte auf eine andere ... und auch der Ich-Erzähler von "Pop Squad" kommt nicht darum herum. In seiner Welt befindet sich die Menschheit im Besitz der Unsterblichkeit - der Preis dafür ist jedoch, dass keine Kinder mehr geboren werden dürfen. Wird dieses Gesetz gebrochen, macht eine pop squad das illegale Nest ausfindig, steckt die Mütter ins Arbeitslager, während die Kinder ... tja. Im krassestmöglichen Kontrast zu den weltabgewandten Zeitvertreiben der Unsterblichen zeigt die Eröffnungspassage mit schockierender Beiläufigkeit, was popping kids bedeutet. Bis der Erzähler schließlich auf eine Mutter trifft, die ihm Paroli bietet.
Auch die titelgebende Erzählung "Pump Six" scheint zunächst die bekannte Geschichte von zerbrechender Infrastruktur und Ressourcenknappheit zu erzählen, denn das sind die Probleme, mit denen sich der Klärwerksangestellte Trav im New York des 22. Jahrhunderts tagtäglich herumschlagen muss. Oder zumindest herumschlagen würde, wenn er nicht andauernd von anderen Ärgernissen abgelenkt würde: Etwa seiner Frau, die mit dem Feuerzeug in der Hand den Gasofen reparieren möchte, oder seinen Mitarbeitern, die einen Störfall übersehen, weil sie lieber eine Klopapier-Schlacht veranstaltet haben. Indirekt und so nach und nach zeigt sich erst, welche ganz spezielle Ressource es ist, die hier knapp wird. - An originellen Einfällen mangelt es Bacigalupi jedenfalls nicht - selbst wenn er einmal die Genre-Literatur kurz verlässt: In "Softer" drückt Jonathan eines schönen Frühlingsmorgens seiner Frau im spielerischen Herumgealbere das Kissen aufs Gesicht ... und lässt dann aus einem Impuls heraus einfach nicht mehr los. In der Folge wird er nicht nur über den Grund für seine Tat philosophieren, sondern auch noch mit neuer Lebenslust in eine rosige Zukunft losmarschieren. Was wohl Bacigalupis Frau gedacht haben mag, als sie diese Geschichte gelesen hat?
Nahezu alle zentralen Motive kommen in der zweitältesten Geschichte, "The Fluted Girl" zusammen (das Wörterbuch bietet eine Reihe Übersetzungsmöglichkeiten für "fluted" an, aber die hier zutreffende ist garantiert nicht dabei ...), auch wenn sie in einem für den Autor nicht charakteristischen Gothic-Setting zuhause ist: Vor dem Hintergrund einer neo-feudalen Gesellschaft, in der eine gelangweilte Medien-Elite das Sagen hat, darf einmal mehr die Biotechnologie ungeahnte Möglichkeiten entfalten. Das Schloss, in dem das gentechnisch veränderte Mädchen Lidia lebt und arbeitet, ähnelt in seiner Atmosphäre von exquisit sadistischer Dekadenz einem Bordell und scheint ein Gefängnis ohne Ausweg zu sein. Doch wie der brillante Schluss zeigt, ist fast immer irgendwo Hoffnung zu finden - selbst wenn sie nur in einem offenen Ende liegt. - Selten fällt es so leicht ein Resümee zu ziehen: Paolo Bacigalupi ist ein großer Erzähler und ein fantastischer Autor.
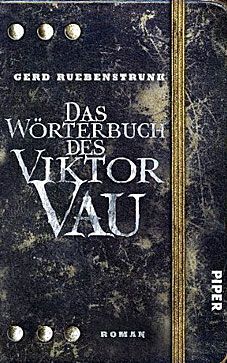
Gerd Ruebenstrunk: "Das Wörterbuch des Viktor Vau"
Kartoniert, 414 Seiten, € 16,40, Piper 2011.
Den deutschen Autor Gerd Ruebenstrunk werden LeserInnen am ehesten als Verfasser der Jugendbuch-Reihe, die mit "Arthur und die Vergessenen Bücher" begann, kennen. Mit "Das Wörterbuch des Viktor Vau" bleibt er gewissermaßen beim Thema, wendet sich aber an ein erwachsenes Publikum und wagt sich in die Science Fiction vor. Dass dies nicht unbedingt Ruebenstrunks Stammgebiet ist, macht sich im Roman durchaus bemerkbar - aber nicht auf eine unangenehme Art. "Das Wörterbuch des Viktor Vau" erinnert mit seinem unverkennbaren Retro-Flair an SF-Literatur aus den 60er Jahren und wartet überdies mit einem originellen Plot auf.
Die Titelfigur lernen wir in einer Eloge, die zugleich ein Nachruf ist, als das Idealbild des reinen Wissenschaftlers kennen. Wer diese Lobesrede hält, wissen wir nicht - zum ersten Mal darf sich gesundes Misstrauen regen: Ruebenstrunk ist ja auch ein Autor, der gerne Rätselnüsse zu knacken gibt. In der Folge erweist sich Viktor Vau - in passend distinguiertem Tonfall beschrieben - als hochgebildeter und etwas neurotischer Mensch, der sein Leben pedantisch unter Kontrolle zu halten versucht. Er empfindet es schon als unangenehme Veränderung, wenn sein Stammkellner, dessen Augen von der jahrelangen Job-Routine stumpf geworden sind, plötzlich wieder strahlt (was Viktor allerdings auch aus gutem Grund beachtet, wie sich noch herausstellen wird). Komplett beziehungsunfähig und ungeschickt im Umgang mit anderen, aber stets penibel auf seine Kleidung achtend - kurz: Jack Nicholson als Melvin Udall in "As Good As It Gets" hätte für Viktor Vau Pate stehen können.
Viktor leistet aber auch etwas Besonderes: Er arbeitet an einer künstlichen Universalsprache, Katlan genannt, der ersten Sprache, die in der Lage sein soll, die Wirklichkeit in all ihren Facetten exakt abzubilden. Dass er sein Wörterbuch an einer Klinik erstellt, liegt daran, dass Katlan - wie jede Sprache, aber effektiver - auch das Denken strukturiert. Eingefleischte SF-Fans werden vielleicht unwillkürlich an andere AutorInnen denken, die den Zusammenhang zwischen dem Kontakt mit einer fremdartigen Sprache und einer Veränderung des Bewusstseins thematisierten, etwa Samuel R. Delany in "Babel-17" oder Ted Chiang in "Story of your life". Viktor jedenfalls hofft mit seinem Katlan psychisch Kranke zu heilen - gewissermaßen indem ihr Verstand ein "neues Betriebssystem" erhält. Sein überragendes Verständnis von Sprache wird Viktor jedoch zum Verhängnis, als vor der Küste des afrikanischen Staats Dagombé - in der Romanzeit eine ehemalige Provinz von Niger - eine Raumkapsel niedergeht, in deren Innerem zwar weder Lebewesen noch irgendwelche bemerkenswerte Technik vorgefunden werden, aber dafür ein Waschzettel in einer unbekannten Sprache. Die besten LinguistInnen und KryptografInnen beißen sich daran die Zähne aus - also wird Viktor wider Willen nach Afrika gekarrt. Die Entschlüsselung fällt ihm leichter als erwartet, doch was er zu sehen bekommt, als er die auf dem Zettel festgehaltenen Anweisungen befolgt, lässt ihn in heller Panik ausbüxen. In der Folge wird sich Viktor, von allen Geheimdiensten gejagt, auf der Flucht befinden und sein so sorgsam durchstrukturiertes Leben im Chaos versinken.
Unter den verschiedenen möglichen Zukünften, die das Genre hervorgebracht hat, wählt Ruebenstrunk die Variante, die nicht durch immense technische Fortschritte oder äußere Umstände wie Naturkatastrophen geprägt wurde, sondern durch ein anderes System der gesellschaftlichen Steuerung. Die Demokratie und auch die Postdemokratie sind Vergangenheit - im Jetzt der Union gibt es nur noch eine Dynastie, deren verschiedene Fraktionen ein demokratisches System vorgaukeln, während wir es tatsächlich mit einem zentralistischen Überwachungsstaat zu tun haben. Wo und wann genau wir sind, wird nie gesagt. Schätzungsweise in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, doch von der digitalisierten Informationsgesellschaft, die andere AutorInnen auf dieser Zeitebene angesiedelt haben, ist die Union weit entfernt. Es ist eine Welt der Arbeiter und der Sekretärinnen, der Heizungsmonteure und Zeitungsjournalisten; die Hauptstadt hat ein Fabriksviertel und ein monumentales Repräsentationsviertel im Stil Ceaușescus. Soviel zum oben erwähnten Retro-Flair; verstärkt wird es noch durch die abstrakte Wirkung, die es mit sich bringt, wenn statt Eigennamen nur Begriffe wie eben "die Hauptstadt" verwendet werden: Die Handlung könnte sich überall und irgendwann ereignen.
Sehr viel konkreter ist das eigentliche Geschehen, das sich in der Folge vor allem an Krimi-Strukturen anlehnt. Wer ist beispielsweise der geheimnisvolle "Protektor", der seine Beobachtungen als Ich-Erzähler einstreut? Und wer der "Florist" genannte Serienmörder, der Frauen blumenförmige Muster aus der Haut schneidet? Rings um Viktor versammelt sich im Verlauf des Romans ein ganzes Ensemble an Figuren, die allesamt auf nicht ganz koschere Weise in die Hauptstadt gekommen sind und etwas aus ihrer Vergangenheit zu verbergen haben. Dieses Ensemble ist überschaubar, und die ganz große Überraschung am Ende wird darum auch ausbleiben - aber einen fiesen Twist setzt der Autor dann doch noch. Und für alle, die am Thema "Sprache und welche Macht sie über unser Denken hat" interessiert sind, hat Ruebenstrunk überdies noch einige Verweise eingebaut, die ein Nachblättern wert sind: etwa zur einzigartigen Sprache des Amazonas-Volks der Pirahã oder zum Psychologen Julian Jaynes und dessen These, warum im menschlichen Bewusstsein einst tatsächlich "die Stimmen der Götter" ertönt sein könnten. Haben manche vielleicht schon gehört, als sie sich in der Schule noch durch die "Ilias" kämpfen mussten - aber das unterstreicht ja nur Ruebenstrunks generelle Botschaft: Bücherlesen ist eine bereichernde Tätigkeit.

Jack McDevitt: "Zeitreisende sterben nie"
Broschiert, 524 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2011.
Seit dem Millennium hat sich US-Autor Jack McDevitt vor allem auf seine beiden Reihen um den interstellaren Antiquitätenhändler Alex Benedict und die Pilotin Priscilla Hutchins konzentriert, "Time Travelers Never Die" war 2009 der erste Einzelroman nach längerem Abstand. In dem vom Jahr 2018 ausgehenden Roman begibt sich McDevitt aufs schlüpfrige Gelände der Zeitreisen. Um da nicht auszurutschen und sich in Widersprüchen zu verheddern, muss man unter den diversen Theorien zur Kausalität eine auswählen und dann eisern daran festhalten - im vorliegenden Fall ist es das Selbstkonsistenzprinzip. In den Worten des bekannten Großvaterparadoxons: Man kann zwar nicht in die Vergangenheit reisen, um durch einen Mord an Opa die eigene Existenz auszulöschen ... sehr wohl aber Opa und Oma in spe verkuppeln. Eingriffe in die Vergangenheit sind also möglich, aber nur um die bekannten historischen Tatsachen zu schaffen - oder solche, die von der Geschichtsschreibung nicht erfasst wurden und daher auch nicht in Widerspruch zu ihr stehen. Wer weiß schon, wer 1931 Winston Churchill nach seinem New Yorker Taxi-Unfall mit ein paar Dollarscheinen zu einer raschen Behandlung verholfen hat? Die zwei Hauptfiguren von "Zeitreisende sterben nie" werden jedenfalls am laufenden Band mit Fakten konfrontiert werden, die nicht verändert werden dürfen ... oder erst auf Teufel komm raus geschaffen werden müssen.
Einen davon, Adrian "Shel" Shelborne, lernen wir aus Grabreden auf seiner eigenen Beerdigung kennen. Doch wie der Titel schon andeutet, wird der Tod für jemanden, der auf verschiedenen Zeitebenen (also auch danach) agieren kann, zu einem höchst relativen Ereignis. Am Ende des Eröffnungskapitels erscheint Shel quicklebendig im Haus seines trauernden Kumpels Dave Dryden und erzählt ihm die haarsträubende Geschichte von seinem Vater Michael, einem hochdekorierten Physiker, der einige Zeit zuvor aus seinem von innen versperrten Haus verschwand: Dann, an einem Tag im Oktober 2018, (...) spazierte Michael aus der Welt hinaus, heißt es mit leichtem Einschlag von Magic Realism - in der Folge wird der Ton straighter. Offenbar hat Michael Shelborne eine Methode zur Zeireise erfunden - und drei an iPods erinnernde Geräte, Konverter genannt, hinterlassen, die ihren Träger nach Belieben durch die Zeit tragen. Teil 2 des in einem Schließfach hinterlegten Erbes, nämlich die Anweisung zur Vernichtung der Konverter, ignoriert Shel geflissentlich. Ist man von den vielfältigen Möglichkeiten des Zeitreisens erst mal angefixt, wird man nämlich ganz schnell danach süchtig - eine Erfahrung, die bald auch Dave machen wird.
Für den Aufbau des Romans war entscheidend, dass er aus einer kürzeren Erzählung hervorging. Die anfängliche Handlung öffnet eine Klammer zum dritten Teil, in dem es hauptsächlich darum geht, wie Shel die Umstände seines Todes aufzuklären versucht. Den großen Mittelteil hingegen hat McDevitt genutzt, um das auszubauen, was in der ursprünglichen Version zu kurz kam. Das gilt gar nicht mal so sehr für Shels Suche nach seinem Vater, die für ihn nur die Einstiegsdroge für zunehmenden Zeittourismus hergibt und später auch zu einem vergleichsweise beiläufigen Finale gebracht wird. Zeitreisen haben auch ungeahnt praktische Seiten, auf die McDevitt gerne hinweist: So betritt man ein Haus, das eigentlich abgesperrt sein müsste, ganz einfach, indem man in seinem Inneren ein paar Minuten in die Vergangenheit reist und die Tür aufschließt, wodurch man überhaupt erst hineingelangen konnte, um den erforderlichen Kurztrip anzutreten. Regenwetter kann man ebenso leicht entgehen wie sein zukünftiges Ich als Krankenstandsvertretung engagieren, während man sich an einem abgelegenen Ort auskuriert ... die Zeitreisemaschine als Alltagsorganizer, dagegen sieht jedes Smartphone blass aus!
Oberflächlich spektakulärer, zugleich aber auch erwartbarer, sind natürlich die Reisen in andere Epochen: Shel und Dave reisen mit einer Begeisterungsfähigkeit, die die Thirtysomethings fast wie Jugendliche erscheinen lässt, zu historischen Wendepunkten, erleben Martin Luther und Martin Luther King in deren größten Momenten, sehen Caesar den Rubikon überschreiten und die Alliierten in Frankreich landen, gönnen sich konzertante Erstaufführungen von Werken der großen Meister ebenso wie "historische" Baseballspiele. Vieles davon wird nur erwähnt oder kurz gestreift - eine längere Nebenhandlung dreht sich um einen Besuch in der legendären Bibliothek von Alexandria, wo unser Duo damit beginnt, im späteren Brand verloren gegangene Werke zu kopieren und damit die akademische Gemeinde von 2018 in Aufruhr zu versetzen.
Alle diejenigen, die eine klar fokussierte Handlung vorziehen, werden im Verlauf dieses Teils die Stirn runzeln, da der Roman hier etwas zerfasert. Allerdings wird es nie langweilig, wenn McDevitt vergnüglich die sehr gut erträgliche Leichtigkeit des Zeitreisender-Seins schildert. Und irgendwie ist dieser Teil - trotz späterer Rückkehr zum Krimi-Plot - auch der plausibelste. Gedankenspiel: Was würden zwei Menschen, die weder übermäßige kriminelle Energie aufweisen noch eine ideologische Mission verfolgen, wohl tun, wenn ihnen eine Zeitmaschine in den Schoß fiele? Vermutlich genau das, was Shel und Dave tun: Sich als Bildungs- oder einfach nur Spaßtouristen amüsieren und ein bisschen was für sich zur Seite schaffen (sei es durch Kenntnis der Rennergebnisse von nächster Woche oder indem man bei Michelangelo die ultimativen Gartenfiguren in Auftrag gibt). Und weil einen gelegentlich auch mal das Gewissen packt, zum Ausgleich ein bisschen was für die Menschheit tun: zum Beispiel die Wissensschätze der Antike für die Nachwelt zu retten.
Viele kleine Kausalschleifen und die Auflösung besagten Kriminalfalls später wird man feststellen, dass McDevitt mit den geschaffenen Fakten genauso sorgfältig umgegangen ist wie seine Protagonisten und sämtliche lose Enden zu einem schönen Abschluss verknüpft hat. Ehre, wem Ehre gebührt.
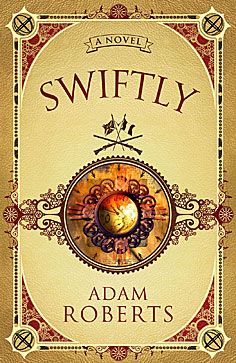
Adam Roberts: "Swiftly"
Broschiert, 368 Seiten, Gollancz 2009
Then the giants came; heads rearing up like the sun over the horizon, but these suns followed by bodies, and the bodies supported on enormous legs. Der Marsch der Riesen von Brobdingnag auf London, in dessen Verlauf die Kuppel der St. Paul's Cathedral wie eine Eierschale geknackt wird, ist bloß ein Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen werden. Und das alles nur, weil Jonathan Swift 1726 mit "Gullivers Reisen" keinen fiktiven Bericht, sondern eine Tatsachenschilderung veröffentlicht hat ... jedenfalls in der alternativen Welt, die der Brite Adam Roberts in "Swiftly" beschreibt: Als Hommage an seinen großen Landsmann und zugleich - in mehrfacher Hinsicht - als Weiterführung von dessen Gedanken. Großes Kino!
Wir schreiben das Jahr 1848, und das Britische Empire hat sich die Entdeckungen Lemuel Gullivers zunutze gemacht: Die zwergenhaften Menschen Lilliputs (im Original mit zwei "l" geschrieben) und seines feindlichen Nachbarstaats Blefuscu haben als Feinmechaniker-Sklaven viel zum wirtschaftlichen Aufschwung Großbritanniens beigetragen. Vor den eigentlich gutmütigen Riesen aus Brobdingnag hatte man soviel Angst, dass man sie auszurotten versuchte - die späte Quittung erhält das Empire, als die Giganten in den Reihen der französischen Invasionsarmee mitmarschieren. Andere Topoi aus Swifts Erzählung spielen keine entscheidende Rolle: Die Gelehrten-Stadt Laputa wird als potenzielles Vorbild für eine fliegende Multifunktionsinsel genannt, die Yahoo-Affenmenschen tauchen einmal kurz als britische Spezialeinheit auf, während einige Houyhnhnms - intelligente Pferde, die Swift in seiner Satire als Inbegriff von Weisheit und ethischer Vollkommenheit den barbarischen Yahoo gegenüberstellte - ihren Dienst in einem Kavallerieregiment fristen. Wichtig sind für die Handlung nur die ganz großen und die ganz kleinen Menschen ... und vor allem letztere zeigen im Verlauf des Romans eine durchaus unheimliche Seite.
Hauptfigur des Romans ist Abraham Bates, ein engagierter Gegner der Versklavung der kleinen Menschen ("unser" Großbritannien hatte zu diesem Zeitpunkt übrigens längst ein Verbot des Sklavenhandels erlassen und strebte ein allgemeines Verbot der Sklaverei auch außerhalb seines Hoheitsgebiets an). Was nicht heißen soll, dass Abraham eine humanitäre Lichtgestalt wäre: Ihm geht es nur darum, dass die hellhäutigen Lilliputaner und Blefuscaner made in God's image seien - zwecks Sklaverei bediene man sich doch bitte bei denjenigen, die von Gott selbst durch eine schwarze Haut für die Sklaverei gezeichnet worden seien. Melancholische Stimmungsschübe, in denen Abraham komplett versumpft, und später eine tendenziell sehr ungustiöse sexuelle Prägung machen aus Abraham einen interessanten Anti-Helden - verstärkt noch durch seine Entscheidung, den vermeintlichen Sklavenbefreiern aus Frankreich durch Landesverrat die Eroberung Londons zu ermöglichen.
Wie zuvor der Roman Jack McDevitts hat auch "Swiftly" eine Vorgeschichte, was die Konstruktion anbelangt: Der mit der Eroberung Londons endende erste Abschnitt bildet spürbar eine in sich geschlossene inhaltliche Einheit; er ist vor dem Roman als eigenständige Erzählung erschienen. Das gilt in gleicher Weise für den folgenden Teil, der sich um Eleanor Davis dreht, eine wissenschaftlich interessierte junge Frau aus verarmtem Adel. Eleanor wird von ihrer Mutter in eine Zweckehe mit einem reichen Industriellen gepresst - das Thema Sklaverei spiegelt sich hier auf der zwischenmenschlichen Ebene wider, doch macht der Autor auch hier den LeserInnen in Sachen Sympathieverteilung einen Strich durch die Rechnung: Eleanors unbeholfener und aufrichtig in sie verliebter Ehemann kann einem nur leidtun, während aus Eleanors verständlicher Wut über ihre ausweglose Situation allmählich schwärender Hass wird. Und dabei hatte alles noch so humorvoll begonnen: Da dieser Abschnitt für den Gesamtkontext eigentlich unnötig viel Platz einnimmt, erfahren wir viel von Eleanors Vorgeschichte - etwa wie sie sich die Geheimnisse der Sexualität aus Büchern zusammenreimte und "in einem Eliminierungsprozess schlussfolgerte, welches ihre Fortpflanzungsorgane sein müssen". Die ihres Mannes hätte sie in der Hochzeitsnacht auch gerne studiert ... but Burton was on top of her before she could make her observation. Bald wird daraus eine wahre Ehehölle, die ein rasches und blutiges Ende findet. Roberts kommt in fieser Weise vom Drolligen zum Ungemütlichen - das gilt auch für den Roman insgesamt, der eine überraschend apokalyptische Richtung einschlagen wird.
Nach einem Drittel des Romanumfangs treffen die beiden Handlungsstränge und mit ihnen unsere zwei Hauptfiguren zusammen. Und was es zuvor an ehelicher Pflichterfüllung durchzustehen galt, wird nun in einer unglaublichen - und äußerst detailreichen - Passage noch einmal weit übertrumpft: Auf der Flucht nach Nordengland geraten die ProtagonistInnen mitten hinein in die Ausbreitung einer neuen Seuche. Selbst schwer gezeichnet, versucht Gentleman Abraham der bewusstlosen und durchfallgeplagten Eleanor zu helfen, säubert sie, während ihr die Scheiße die Beine runterläuft, schüttelt sich vor Ekel und ejakuliert zugleich angesichts der halbnackten Frau. Und während Abraham vor Scham und Selbsthass fast implodiert, weiß der Leser nicht, ob er lachen, weinen oder sein Frühstück verlieren soll. Adam Roberts ist wahrlich kein Autor, der einem einfache Urteile erlaubt: Siehe die durchwachsenen Sympathiewerte der Hauptfiguren, siehe auch Roberts' Spiel mit der Konstruktion von Wirklichkeit(en). Im kürzlich hier vorgestellten "Yellow Blue Tibia" schwammen verschiedene Realitäten ineinander, hier basteln sich die Menschen in ihren Köpfen die Wirklichkeit zurecht: Sei es, dass Abraham all seine Verdachtsmomente, von den Franzosen betrogen worden zu sein, wider alle Vernunft verdrängt, sei es dass Eleanor die Ermordung ihres Mannes zu einem bösen Traum erklärt.
Auf den Schlachtfeldern Nordenglands kommt dann alles zusammen: Szenen, die einerseits dem Dreißigjährigen Krieg und andererseits "War of the Worlds" entsprungen sein könnten; der Plot um romantischen Überschwang und unmögliche Liebe zwischen den Hauptfiguren; und - ganz im Sinne Swifts - gesellschaftskritische Elemente, wenn aus Sklaverei Revolution und aus dieser ein Genozid entspringt und wenn Menschen aus dem Kampfgetümmel entkommen, nur um sich plötzlich in der auf völlig andere Weise schrecklichen Position des Beobachters wiederzufinden. Und das alles verbindet Roberts mit einem Worldbuilding, das mit einer fraktalen Kette von Mikro- und Makrokosmen aufwartet, die jeden Begriff von "groß" oder "klein" bis zur Bedeutungslosigkeit relativiert. - Wieder einmal lädt Adam Roberts also eine riesige Fuhre vor einem ab. Nicht jeder wird alles gelungen finden - doch dürfte für jeden etwas dabei sein, das ihn restlos davon überzeugt, das richtige Buch gekauft zu haben. Und wer mittlerweile ebenfalls von Roberts' unerschöpflichem Ideenvorrat angefixt ist: Sein jüngster Roman "New Model Army", der sich um eine sehr ungewöhnlich organisierte Armee dreht, ist gerade erst als Taschenbuch erschienen. Und noch diesen Sommer wird schon der nächste folgen und uns zeigen, wie wir lebten, wenn unser Kopfhaar zur Photosynthese geeignet wäre. Man hält kaum Schritt!
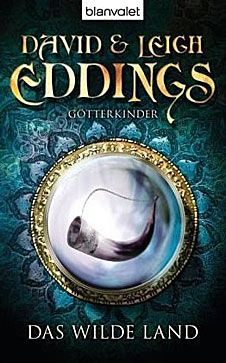
David & Leigh Eddings: "Das wilde Land" ("Götterkinder" 1)
Broschiert, 408 Seiten, € 9,30, Blanvalet 2011.
Die "Götterkinder"-Tetralogie ist auf gewisse Weise das Vermächtnis des US-amerikanischen Autors David Eddings ... jedenfalls in dem Sinne, dass es das letzte ist, was der Schöpfer von "Belgariad" und "Elenium" geschrieben hat. Wie bei allen seinen Spätwerken fungierte dabei seine Ehefrau Leigh als Ko-Autorin; beide sind vor einigen Jahren verstorben. Und auch wenn die Reaktionen auf "Götterkinder" insgesamt sehr, sehr, sehr gemischt ausfielen, hat sich die Reihe offenbar gut genug verkauft, um nun eine Neuauflage zu erleben. Ring frei also für eine zweite Runde Fantasy light:
Mögen andere Kontinente sich verschieben, das Land Dhrall bleibt festgepappt an seinem Platz. Das ist noch nicht mal so absonderlich: In unserer Welt wird die Antarktis ja auch bis auf weiteres durch einen unterseeischen Gebirgsring an jeder Wanderung gehindert. Der wissenschaftliche Verweis sei deshalb erlaubt, weil sich das Ehepaar Eddings in seiner Kosmogenese an Anspielungen auf Phänomene wie Tektonik und Evolution herantraut - wenn auch kursorisch und natürlich nicht so benannt. Dhrall selbst erinnert an nichts mehr als an ein Spielbrett: Streng symmetrisch liegen vier nach den Himmelsrichtungen angeordnete Domänen um eine zentrale Einöde herum. Die Domänen werden von zwei Götter-Quartetten im Schichtbetrieb behütet bzw. - gemessen am Dolce Vita der aktuell jobbenden Riege - bewohnt. Momentan sind seit einigen Äonen übrigens die vier Älteren Götter dran (im Original hieß der 2003 erschienene Roman daher "The Elder Gods"). Weitere Big Player des großen Spiels sind Mutter Meer und Vater Erde, und dazu kommt dann noch ein im Ödland hausendes, vorerst völlig ungeklärt bleibendes Mysterium, das-man-Vlagh-nennt. Betrachtet man die Götter, die der Entwicklung des Lebens freien Lauf lassen, als VertreterInnen der Evolution, dann verkörpert das Vlagh, das in unregelmäßigen Abständen seine martialischen Eigenkreationen in die Welt hinausschickt, gewissermaßen das Intelligent Design. Na, wenn einen das nicht zum Bösewicht prädestiniert, was dann!
... das soll jetzt aber nicht den Eindruck erwecken, "Das wilde Land" wäre das Flaggschiff der intellektualisierten Fantasy. Götter als einen Großteil der Handlung tragende Hauptfiguren kennt man am ehesten aus der "Drachenlanze", und etwa auf diesem Level bewegen sich die "Götterkinder" auch. Einen beträchtlichen Teil des Geschehens erleben wir aus der Überflieger-Perspektive der Agierenden; in märchenhaft-kindlicher Weise erzählt überdies: Gott Veltan reitet nicht nur auf einem Blitz durch die Lüfte, er schickt ihn nach getaner Arbeit auch noch "ins Bett". Die Gespräche der Götter pendeln zwischen gewitzten Bemerkungen und Twitter-Tiefgang; verblüffend dabei immer wieder die Naivität der angeblichen WeltenschöpferInnen, die allzuoft von Tuten und Blasen keine Ahnung zu haben scheinen (ein paar inhaltliche Widersprüche mal ausgeklammert; die sind vielleicht der zweigeteilten AutorInnenschaft geschuldet). Der leichtfüßige und alles andere als heroische Erzählduktus wird für den einen oder die andere durchaus gewöhnungsbedürftig sein. Und in so mancher Slapstick-Passage nähert sich der Roman sogar der Funny Fantasy an, zum Beispiel bei einem Piratenüberfall: Die "Seemöwe" wartete kurz, um den trogitischen Seeleuten Zeit zu lassen, über die Reling zu springen und von den beiden Schiffen fortzuschwimmen, dann legten die Maags längsseits an und stahlen alles von Wert, trugen ihre Beute an Bord der "Seemöwe" und zogen sich zurück, damit die Trogiten wieder auf ihr Schiff klettern konnten, ehe jemand ertrank. Es handelte sich um ein zivilisiertes Arrangement.
David und Leigh Eddings schlugen in ihrem letzten Werk so einiges an Genre-Regeln in den Wind: So gibt es zum Beispiel keine echten Hauptpersonen, die als Identifikationsfiguren fungieren könnten. Zunächst steht die Göttin Zelana im Vordergrund, die von einem ihrer Brüder das kleine Mädchen Eleria als Mündel aufgehalst bekommt, das sich im Laufe des Heranwachsens als bezaubernd, aber auch hochgradig manipulativ entpuppt. Anschließend begleiten wir Zelana noch dabei, wie sie bei Völkern außerhalb Dhralls Söldner gegen einen neuen Vorstoß des Vlagh anwirbt, aber damit verschiebt sich die Perspektive auch schon und in der Folge stehen mehrheitlich verschiedene menschliche ProtagonistInnen im Vordergrund: anarchistische Maag-Piraten, straff organisierte Trogiten (zwischen beiden kommt es immer wieder mal zu einem Culture Clash der komischen Art) und nicht zu vergessen auch die BewohnerInnen von Dhrall selbst. Die wurden von den Göttern zwar in wohlbehüteter Stagnation gehalten, aber ganz auf den Kopf gefallen sind sie auch nicht. So verlaufen viele individuelle Fäden nebeneinander her, von denen sich mal der eine, mal der andere in den Vordergrund schiebt.
Und noch eine Konvention wird gebrochen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Im Klappentext wird bitte-nicht-schon-wieder-eine-uralte-Prophezeiung zitiert, dergemäß vier bitte-nicht-schon-wieder-magisch-begabte-Kinder bitte-nicht-schon-wieder-als-einzige in der Lage sein sollen, bitte-nicht-schon-wieder-die-Welt-zu-retten; im Roman selbst relativiert sich dies dann deutlich. Besagte vier Kinder - das ist jetzt kein Spoiler, denn es wird sehr früh erklärt - sind nämlich keine Menschen mit überraschenden Talenten, sondern niemand anderer als die Jüngeren Götter; einer der Älteren hat lediglich die Modalitäten der Wachablöse ein wenig geändert. Eigentlich ein halbseidener Trick, der den Eindruck verstärkt, dass alles nur ein großes Spiel ist. Doch wer bestimmt hier die Regeln? - "Das wilde Land" ist ein eigenwilliges Werk, man wird nicht so recht schlau draus. Es kommt so kulleräugig kindlich daher wie Eleria ... und wer weiß, vielleicht wird sich dieser Eindruck später genau wie bei ihr als falsch herausstellen.

Karl Schroeder: "Segel der Zeit"
Broschiert, 431 Seiten, € 9,30, Heyne 2011.
"Ich wollte dir ein Pferd mitbringen ... Aber als die Welt unterging, fiel es über den Rand." Solche Sätze bekommt man nur an einem Ort des Universums zu hören: In Virga, der wunderbaren Welt der Schwerelosigkeit, die uns der kanadische Autor Karl Schroeder nach "Planet der Sonnen" und "Säule der Welten" nun bereits zum dritten Mal besuchen lässt; "Pirate Sun" heißt das 2008 erschienene Buch im Original. Erstmals ist nun auch eine schematische Zeichnung Virgas enthalten, eines 8.000 Kilometer durchmessenden luftgefüllten Ballons, der von einer nur zwei Meter dünnen Hülle aus Kohlenstofffasern vor dem Platzen bewahrt wird; seine Kreise zieht er irgendwo am Rande des Wega-Systems.
Habitaträder, rundum baumbewachsene Felsbrocken ("wie ein zusammengeklappter Wald") und kugelförmige Seen: Im Inneren Virgas schweben zahlreiche Miniaturwelten - "Schwerkraft" können sie ihren BewohnerInnen nur bieten, wenn sie schnell genug rotieren. Und weil die künstliche Sonne Candesce, die zumindest die Zentrumsregion Virgas mit Licht und Wärme versorgt, auch ein Störfeld aussendet, das jede Elektrotechnik zum Erliegen bringt, bewegt man sich zwischen diesen Welten in Dampf- oder Kerosin-betriebenen Gefährten. Oder schlicht per Muskelkraft mit selbstgebastelten Flügeln. Selbst nach drei "Virga"-Romanen kann es immer noch verblüffen, wenn ein scheinbar selbstverständlicher Handlungsablauf hier einen etwas anderen Fortgang nimmt als gewohnt - in einer Welt, in der selbst der tiefste Sturz kein automatisches Todesurteil bedeutet, sondern vielleicht einfach nur eine ganz praktische Fortbewegungsmethode ist. Vorausgesetzt, man hat die Geschwindigkeit, mit der man im Ziel aufklatscht, richtig kalkuliert.
Schroeder wartet auch im dritten Roman wieder mit beeindruckenden Bildern auf - etwa als es zum Krieg zweier Nationen kommt: Misstrauisch umkreisen einander die beiden Städte Neverland und Stonecloud. Neverland erzeugt durch ausgeklügelt dirigierte Beleuchtung seiner Wohnhäuser das Abbild eines zornigen Gottes, der auf Stonecloud herabschaut (ein Effekt, auf den jede nordkoreanische Massenchoreographie neidisch wäre), während Stonecloud die Formation seiner Häuserkonglomerate auflöst und sich von einer Parklandschaft in eine zupackende Klauenhand verwandelt. Und schon ist der Kriegstanz eröffnet: Wie es der Zufall wollte, trafen zuerst zwei Wohnblocks aufeinander ... Wir lernen das Berufsbild des Schwerkraftverkäufers kennen, der Häuser an sein Bike kettet und sie in Rotation versetzt, um den BewohnerInnen eine regenerative Zeit für Muskel- und Knochenaufbau zu verschaffen. Und wir erleben hautnah mit, wie Luftfeuchtigkeit im schwerelosen Himmel von Virga nicht dabei Halt macht, in Tropfenform zu kondensieren, sondern zu immer größeren und noch größeren Klumpen anschwillt: Sekunden später verwandelten sich die Tropfen in ein Angriffsheer bizarrer Gebilde. Die Kugeln wurden durch die unruhige Luft verformt, so dass einige aussahen wie amputierte Arme, andere wie nasse Spinnen, die einen Sprühnebel hinter sich herzogen. Sie teilten sich und vereinigten sich wieder, rempelten und drängelten aneinander vorbei, als könnten sie es nicht erwarten, das ohnehin nicht sehr stabile Habitatrad zu zertrümmern. Schweres Wetter, in der Tat.
Mit einer weiteren gewitzten Nutzbarmachung dieser speziellen Umweltbedingungen sind wir auch schon mitten in der Handlung von Teil 3: Admiral Chaison Fanning, in Ungnade gefallener Kriegsheld der Nation Slipstream, sitzt in der feindlichen Falkenformation in Haft - bis eines Tages jemand auf einem Air Bike angeknattert kommt, den lieblos zusammengepappten Gefängniskomplex mit einer Kette umwickelt und ihn so lange wie ein Jo-Jo herumwirbelt, bis er auseinander bricht. Dahinter steckt niemand anderer als Venera Fanning, Chaisons wilde Hummel von Ehefrau, deren Erlebnissen der Vorgängerroman gewidmet war. Einmal mehr schmiedet Venera Pläne, diesmal um sich an den politischen Feinden ihres Mannes zu rächen ... doch hat sie Pech und verpasst im allgemeinen Tohuwabohu den frisch befreiten Gatten, dessen Flucht wir anschließend begleiten, während Venera in den Hintergrund zurücktritt. Schroeder bleibt damit seiner Linie treu, jeden Band rund um eine andere Hauptfigur aufzubauen - auch wenn die Romane inhaltlich eng verknüpft sind und sich erst nach und nach enthüllt, welche Auswirkungen bestimmte Geschehnisse in Band 1 auf die jetzige Handlung hatten.
Es ist ein ungleiches Trio, das sich da aus dem Falken-Gefängnis absetzt: Der Admiral und das rangniedrigste Mitglied seiner ehemaligen Crew, der Schiffsjunge Martor, und dazu der distinguierte, wenn auch von der Gefangenschaft etwas zerrupfte Diplomat Richard Reiss. Doch schnell findet man unter den gegebenen Umständen zu zwanglosen Umgangsformen, und Chaison Fanning erweist sich als waschechter Ehrenmann, der sogar seinen Feinden beisteht, als diese von einer weiteren Nation Virgas angegriffen werden. Chaison ist in seinem Element: Endlich kann er wieder Entscheidungen treffen und auch durchsetzen ... allerdings schwingt in seinem verlängerten Aufenthalt in der Falkenformation auch die Angst vor der Rückkehr in die Heimat mit - schließlich wurde er dort inzwischen als Verräter gebrandmarkt. "Segel der Zeit" entwickelt sich damit ganz analog zu "Planet der Sonnen" zu einer Abenteuerfahrt vor undurchsichtigem politischen Hintergrund. Und wie in Band 1 gesellt sich auch hier eine zwielichtige Frau zum Protagonisten: Antaea Argyre heißt sie in diesem Fall und scheint mit ihren Riesenaugen und 15 Zentimeter hohen Stahl-Heels einem Manga entsprungen. Antaea, das Wintergespenst aus einer von Candesce nicht beleuchteten Region Virgas, gaukelt Chaison vor, seine Befreierin zu sein, weil sie ganz eigene Pläne mit ihm verfolgt.
Ein Handlungselement, das im Vorgängerband nicht vorkam, spielt nun wieder eine große Rolle: Nämlich die Welt außerhalb Virgas, das brodelnde Versuchslabor der posthumanen galaktischen Gesellschaft, die nur zu gerne ins Innere Virgas vordringen möchte. Für dessen Nationen würde dies den kulturellen Tod bedeuten - als würde man ein neuentdecktes Regenwald-Dorf mit 50 indigenen Seelen mit einem eigenen U-Bahnanschluss versehen, aus dem anschließend Tausendschaften von Vertretern für iPhones, Fastfood und das gesamte Beate-Uhse-Sortiment geströmt kämen. Und das wären nur die freundlich Gesinnten ... Aus den Erinnerungen Antaeas erfahren wir, dass die Künstliche Natur außerhalb Virgas noch viel, viel fremdartiger ist als gedacht - und dass Virga nicht einfach nur ein Reservat für Menschen ist, die eine Old-School-Lebensweise pflegen, sondern dass der Ballon (wie auch andere seiner Art) noch einen ganz anderen Zweck erfüllt. Endgültige Gewissheit wird der vorerst letzte Teil der Saga bringen, der 2009 als "The Sunless Countries" erschien und hoffentlich ebenfalls auf Deutsch herauskommt. Worldbuilding Römisch Eins mit Sternchen!

Sergej Lukianenko: "Labyrinth der Spiegel"
Broschiert, 607 Seiten, € 15,50, Heyne 2011.
Woher stammte noch gleich das Märchen von der Prinzessin/dem Prinzen, die/der verfolgt wird und einen Kamm und einen Spiegel hinter sich wirft, aus denen ein Wald und ein See werden und die Verfolger aufhalten? Egal, Sergej Lukianenko greift es jedenfalls in einer Passage auf, die seinen Zugang zum Thema Cyberpunk in besonders schöner Weise illustriert. In einer Tiefe genannten virtuellen Welt ist jeder Gegenstand zugleich ein Icon: ein Schwert steht für ein Computervirus, der Wald für ein "Dickicht" unnützer Informationen, der See für eine Blockade der Verbindung. Das ist alles auch für LeserInnen, die vor der Welt der Computerspiele als Romanthema immer noch eher zurückschrecken, leicht aufschlüsselbar - und obendrein fungiert das Tempus wie eine laufende Navi-Anzeige: Wenn im Imperfekt erzählt wird, befinden wir uns in der realen Welt, bei Präsensform in der Tiefe. Zwei entscheidende Ausnahmen wird es geben, aber die haben ihren Grund und der soll hier natürlich nicht verraten werden.
Wenn "Labyrinth der Spiegel" nicht immer auf dem aktuellsten Stand der Spieletechnik erscheint, dann liegt das ganz einfach daran, dass es in seiner ursprünglichen Form (wenn auch in dieser Ausgabe nicht entsprechend gekennzeichnet) 1996 erschienen ist. Was es immerhin zu einem Zeitgenossen von Tad Williams' "Otherland" macht, mit dem es auch einige Grundzüge teilt - etwa die Williams' Simwelten entsprechenden Fantasy-artigen Landschaften, in denen es vor Avataren in Menschen-, Tier- und Elfengestalt nur so wimmelt. Oder auch die Verselbstständigungstendenzen der virtuellen Welt und das unerhörte Ereignis, das sich in deren Tiefen zusammenbraut und auf die wirkliche Welt auszustrahlen beginnt. Obwohl die mit "Labyrinth der Spiegel" begonnene Trilogie deutlich weniger umfangreich ist und auch andere Schwerpunkte setzt, lässt sie sich also durchaus als russisches Pendant zu "Otherland" betrachten. Und das nicht nur, weil die Computersphäre genauso voller Russen ist wie in Lukianenkos anderen Romanen - quasi ein Running Gag - der Weltraum; in beiden Fällen lässt es sich der Autor nicht nehmen, eine augenzwinkernde Erklärung dafür in der Mentalität seiner Heimat zu finden.
Zur Handlung: Leonid, genannt Ljonja, ist ein 34-jähriger ehemaliger Spiele-Designer aus Sankt Petersburg und ein brummiger Einzelgänger. Nichts könnte diesen Umstand besser illustrieren als die Passage, in der er ein virtuelles Bordell "betritt" und sich unter all den zur Verfügung stehenden Frauen-Versionen diejenige aussucht, die ihn tagtäglich als Windows-Interface auf seinem Computer begrüßt. Entscheidend ist aber Leonids Begabung als Diver - und hier kommt Lukianenkos nicht unbedingt der Hard-SF entstammender Zugang zum Thema viel stärker zum Tragen als bei jedem virtuellen Zauberschloss oder sprechenden Wolf, der sich in der Tiefe so herumtreibt: Da hat nämlich jemand ein geniales Mini-Programm namens "Deep" entwickelt, das Total-Immersion in jede virtuelle Welt erlaubt: Einmal vor Betreten des Netzes kurz das entsprechende Filmchen durchlaufen lassen und schon wird selbst die pixeligste Spielwelt zum hyperrealistischen Szenario. So wirklich scheint das Erleben, dass sich Normalsterbliche nicht mehr daraus lösen können und daher vorsorglich eine Zeitschaltung programmieren müssen, ehe sie in die Tiefe gehen. Nur die Diver schaffen das Auftauchen willentlich, indem sie ihr persönliches kleines Mantra herunterbeten - wie Leonid: Tiefe, Tiefe, ich bin nicht dein ... Tiefe, Tiefe, gib mich frei.
Weil Leonid zu den besten seiner Zunft gehört, wird er in einem besonderen Fall zu Hilfe gerufen: Weit unten im titelgebenden "Labyrinth" - einer aufgejazzten Weiterentwicklung des guten alten Ego-Shooter-Spiels "Doom" - sitzt seit Tagen jemand fest, den keine Zeitschaltung zurückgebracht hat und den auch kein Diver bislang befreien konnte. Seltsamerweise wirkt der "Loser" genannte Unbekannte aber nicht einmal psychotisch, was bei Gestrandeten normalerweise nach einiger Zeit immer der Fall ist. Verschiedene Interessengruppen konkurrieren um Leonids Dienste, und allesamt wollen sie wissen, was es mit dem Loser auf sich hat. Spekulationen machen die Runde: Vielleicht handelt es sich um den ersten Menschen, der ohne Interface in den virtuellen Raum einsteigen konnte. Vielleicht ist es aber auch eine künstliche Intelligenzform, die die Tiefe selbst hervorgebracht hat.
Gleich zu Beginn des Romans grantelt Leonid: Das bunte Kaleidoskop, der Flitter, der funkelnde Sternenwirbel - alles sehr schön, doch ich weiß, was hinter dieser Schönheit steckt. Das scheint einige Bilder aus den berühmten Eröffnungssätzen von William Gibsons "Neuromancer" aufzugreifen und zugleich zu entzaubern - "bodenständig" ist das Wort, das Lukianenkos Version von Cyberpunk am besten beschreibt: Statt weltweiter Hegemonie eines fernöstlichen Lebensstils gibt's hier Wurstbrote und Bier, das gleich in Kanistern nach Hause geschafft wird, statt "neo-aztekischer" Architektur Plattenbauwohnungen. Und statt undurchschaubarer ökonomischer Konglomerate agieren hier Personen - wodurch ein einzelner Mensch, der mit ausreichend Willensstärke und Tatkraft ausgestattet ist, immer noch was ausrichten kann.
Zum Herold des virtuellen Zeitalters oder gar der Computerspielwelt erklärt sich Lukianenko hier nicht. In dieser Netzwelt sind nicht mehr Hacker die Meister, sondern Diver - soll heißen: nicht mehr Menschen, die sich ihre Kenntnisse durch langjähriges Learning by Doing angeeignet haben, sondern solche, die von einem genetischen Zufall begünstigt wurden; eigentlich der Traum jeden Newbies. Neben dem Ekel über so manches blutige Spiel-Detail äußert Leonid in Gesprächen mit einem Hacker-Kumpel oder einer virtuellen Geisha auch grundsätzliche Kritik - etwa dass die virtuelle Welt nichts Neues erschaffe, sondern nur die reale wiederhole und dass es statt kreativer Neuschöpfungen nur noch Updates gebe: Ohne gelernt zu haben, in der einen Welt zu leben, haben wir eine neue hervorgebracht. Aber letztlich ist die VR-Frage auch nur Mittel zum Zweck, um fundamentalere Themen anzuschneiden: Nämlich was die menschliche Kultur überhaupt wert ist und was Freiheit bedeutet. Und siehe da: Wenn Leonid über seinen Glauben an die Tiefe bzw. das Internet als Ort der Freiheit philosophiert, dann zeigt sich, dass er - und mit ihm Lukianenko - tief im alten Lederherz doch ein Idealist ist.
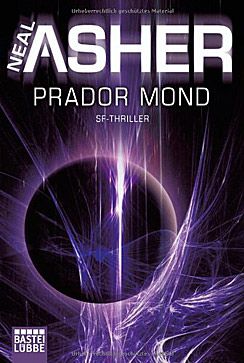
Neal Asher: "Prador Mond"
Broschiert, 284 Seiten, € 7,20, Bastei Lübbe 2011.
Nach einem knappen Dutzend von Neal Ashers "Polis"-Romanen kommen wir nun zum handlungschronologisch ältesten, der auch im Original - 2006 als "Prador Moon" erschienen - erst nachgereicht wurde. Ganz wie bei "Dorsai", "Darkover", "Pip & Flinx" und anderen SF-Zyklen aus der Ära vor den durchgeplanten Trilogien veröffentlicht der englische Erfolgsautor neue Erzählungen aus seiner Zukunftswelt in fröhlichem chronologischen Durcheinander - ganz so, wie ihm gerade die Ideen kommen. Und manche brauchen wohl auch etwas Zeit: Zum Beispiel wie man dem schlimmsten Feind der raumfahrenden Menschheit, den außerirdischen Prador (eine Verballhornung von "Predator"), endlich mal ausführlich Platz einräumt und schildert, wie es zu den später oft zitierten Prador-Kriegen ursprünglich gekommen ist.
Der Erstkontakt zwischen den beiden Spezies mag manche LeserInnen an die Szene am Beginn von "Battlestar Galactica" erinnern, in der die Zylonen "diplomatischen Kontakt" zu den Menschen aufnehmen: Auch hier verwandelt sich die nichtmenschliche Delegation binnen Augenblicken in ein alles niedermetzelndes Überfallskommando - bald wird sich zudem zeigen, dass es sich um einen lange vorbereiteten Angriff auf breiter Front handelt. Dass dieses erste Massaker von einer Truppe poppig gefärbter Riesenkrabben ausgeübt wird, lässt Galgenhumor aufblitzen: Asher ist klug genug, um zu wissen, dass das abgenutzte Bild vom angreifenden Alien-"Insekt" einer kleinen Dosis Ironisierung bedarf. Jebel Krong, der dem menschlichen Empfangskomitee angehört, denkt etwa: "Klar doch, große feindselige Außerirdische, die Geschmack an Menschenfleisch finden." Es war ein Szenario, das ein moderner Holofiction-Produzent lachend abgelehnt hätte. Und Moria Salem, Bürgerin eines Kolonialplaneten, die die unglaublichen Bilder des Angriffs zuhause mitverfolgt, glaubt an eine Fehlfunktion ihrer neuimplantierten Cyber-Schnittstelle und beklagt sich darüber, dass der Nachrichtenkanal mit einem trashigen Anime vermischt worden sei ...
Wer glaubt, dass die Nemesis der Menschheit in diesem Roman durch einen Perspektivenwechsel oder gar Handlungstwist teilrehabilitiert werde, wird sich getäuscht sehen. Die von ihrem Denken her unerwartet unexotischen Prador präsentieren sich durchgängig als ruchlose Invasoren, zudem als Monster, Menschenfresser und Kannibalen. Das Flaggschiff des Prador-Feldherrn Immanenz ist ein fliegendes Schlachthaus, in dem nicht nur die gefangenen Menschen nach endlosen Qualen verspeist werden, sondern gerne auch der eigene Nachwuchs - welcher mit einer Rate, auf die jeder Fisch neidisch wäre, in die Welt gesetzt und verheizt wird, wo man ihn halt gerade verbrauchen kann. Und doch unterläuft Asher durch eine geschickte Umkehr ein klassisches Klischee: Im Aufeinanderprallen zweier gegensätzlicher Spezies sind es hier nämlich die von Künstlichen Intelligenzen gelenkten Menschen, die tendenziell kollektiv denken und handeln. Demgegenüber präsentieren sich die Quasi-Insekten, die von Paranoia getrieben jeden potenziellen Konkurrenten eliminieren, als die extremste Form von Individualisten und ihr Königreich als die ultimative Ellenbogen-Gesellschaft. Nicht schlecht gemacht!
Apropos Künstliche Intelligenzen: Auch wenn "Prador Mond" zeitlich vor der Geburt von Ashers späterem Lieblingsprotagonisten Ian Cormac angesiedelt ist, finden "Polis"-Fans hier wichtige vertraute Elemente wieder. Cormacs bekanntes Misstrauen gegenüber den alleslenkenden KIs würde hier neue Nahrung finden: Moria etwa kommt durch ihr Implantat einem Polit-Mord, den die KIs (natürlich für einen guten Zweck) veranlasst haben, auf die Schliche - und wird von diesen umgehend wegen ihrer Fähigkeiten rekrutiert. Jebel indessen muss erkennen, dass die KIs das Massaker an der diplomatischen Delegation letztlich deshalb zugelassen haben, weil sie die Absichten der Prador testen wollten. Dass sich seine Rachegelüste dennoch primär gegen die Aliens richten, nutzen die KIs mit gewohntem Kalkül aus, schicken Jebel auf seiner Vendetta von Kampfschauplatz zu Kampfschauplatz und vermarkten ihn nebenher noch als Medienstar, damit die Bevölkerung auch mal gute Nachrichten von der Front erhält. Noch ist es aber zu früh, die Rolle der wohlwollenden und zugleich erbarmungslos berechnenden Hüter der Menschheit so radikal zu hinterfragen, wie es später Ian Cormac tun wird. Die KIs bleiben alles besser wissende Eltern, die ihre Kinder manipulieren und vermutlich x von ihnen opfern würden, um x + 1 zu retten. Wie soll man gegen eine solche Logik auch ankommen?
Im allgemeinen Schlachten- und Folterstrudel fallen zwei berührende Momente auf, und immerhin einer davon ist einem Prador gewidmet: Ein Sohn von Immanenz wird nach einem gescheiterten Einsatz buchstäblich ausgeschlachtet und zum Steuerungselement einer Kampfdrohne gemacht; für einen tragischen Augenblick stellt er die Mechanismen der grausigen Gesellschaft, die ihn hervorgebracht hat, in Frage. Der Fokus liegt aber natürlich auf menschlichen Schicksalen in einer posthumanen Gesellschaft. Eines davon, das nur eine Nebenrolle spielt und auf wenigen Seiten abgehandelt wird, wäre einer eigenen Erzählung würdig gewesen: John Varence ist der langjährige Pro-forma-Kapitän eines uralten Schlachtschiffs, das er im Verbund mit einer Künstlichen Intelligenz steuert; eine rein juristische Konstruktion - de facto trifft die KI die Entscheidungen. Als das kilometerlange Schiff mit dem schönen Namen "Occam Razor" für den Kriegseinsatz reaktiviert wird, wird der längst senil gewordene Varence vom Netz genommen, um ihn durch einen unverbrauchten Nachfolger zu ersetzen. Ein letztes Mal blickt der alte Kapitän mit Baby-Staunen in einen Sternenhimmel, ohne zu begreifen, was er da sieht, und stirbt.
... soweit Ashers ungeahnt besinnliche Seite. Der große Rest ist natürlich ein infernalisches Hauen und Stechen: Von körpereigenen Waffen über Folterwerkzeuge bis zu hochtechnologischen Instrumenten zur Massenvernichtung ist hier alles im Einsatz - auch Objekte, die eigentlich gar keine Waffe sind (wer im Romantitel einen romantischen Einschlag wähnt, hat nur zu fünfzig Prozent recht). Und auch die Folgen werden nicht verschwiegen: Menschliche Überreste füllten den Gang; einige davon fingen an zu schreien, aber der Rest war zerfleischt und still. - "Prador Mond" ist ein Härtefall: Asher, der sich in Sachen blutiger Action ohnehin nie lumpen ließ, entfesselt in seinem bislang grimmigsten Roman ein rekordverdächtiges Stahlgewitter, bei dem kein Auge trocken bleibt. Oder im Schädel.
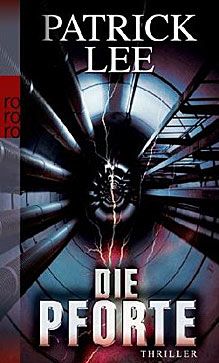
Patrick Lee: "Die Pforte"
Broschiert, 377 Seiten, € 10,30, Rowohlt 2010.
15 Jahre lang hat Travis Chase im Gefängnis gesessen. Die Wiedereingliederung ins Leben draußen hat leidlich geklappt, und um den Kopf endgültig frei zu bekommen, startet Travis am Jahrestag seiner Haftentlassung eine Trekkingtour durch Alaska. Mitten in der Einöde stößt er auf eine abgestürzte Regierungs-Boeing - merkwürdig nur, dass weit und breit kein Rettungsteam in Sicht ist. Im Inneren der Maschine findet er die Leichen der erschossenen Crewmitglieder vor, hinter einer Sicherheitstür auch die der Präsidentengattin: Die hatte sich zwar erfolgreich versteckt, war dann aber doch von einem Streifschuss erwischt worden ... zum Glück blieb ihr beim Dahinscheiden noch genügend Zeit, um einen recht elaborierten Abschiedsbrief an wer-auch-immer-dies-finden-mag zu verfassen. Der Brief ruft den ehrlichen Finder zur Verfolgung der Täter auf und mündet in die Aufforderung: Töten Sie alle. Na, das ist doch mal ein Brett! Die First Lady, traditionell Galionsfigur des Charity-Wesens, als knallhartes Flintenweib, das nach Blut schreit ... US-Autor Patrick Lee, der bislang nur Drehbücher verfasste, lässt's in seinem Roman-Debüt (2009 als "The Breach" erschienen) krachen und versteht es zu unterhalten.
Wie Travis bald erfahren muss, war die First Lady im Auftrag einer geheimen Organisation namens "Tangent" unterwegs, die seit dem Jahr 1978 ein mysteriöses Portal in der Einöde von Wyoming bewacht, aus dem ohne Unterlass die ungewöhnlichsten Gegenstände hervorkommen. Ein waschechtes Füllhorn gewissermaßen - doch mindert es den Reiz beträchtlich, dass man nicht beeinflussen kann, was da herausgequollen kommt. Ein großer Teil der "Portal-Entitäten" genannten Objekte erscheint vollkommen sinnlos, andere erweisen sich als äußerst praktisch (solange sie nicht in die falschen Hände geraten): Da hätten wir etwa - dem aktuellen Stand der realen Technik noch am nächsten - einen Anzug, der unsichtbar macht, einen Tricorder-artigen Heilstrahler oder gar einen taschenlampenförmigen Verdoppler, der eine exakte Kopie von allem herstellt, was man vorne in seinen Lichtkegel hält. Quasi-magische Objekte aus einem kunterbunten Pulp-Universum, die wie dreidimensionale Farbkleckse aussehen ... als hätte ein real existierender Pac-Man sein Eigenheim entrümpelt. Querdenker Travis wird die Unzahl an Hypothesen über Sinn und Zweck des Portals daher auch um die erste neue Theorie seit Jahren bereichern: Vielleicht hängt man ja am Auslass eines intergalaktischen Müllschluckers ...
Weniger spaßig ist, dass ein abtrünniger "Tangent"-Mitarbeiter mittels einiger ausgewählter Portal-Entitäten Schlimmes im Sinn hat - denn die sind brandgefährlich. Das Flüstern vor allem, eine kleine blaue Kugel, die an Bord der abgestürzten Maschine transportiert worden war. Seine gute Seite: Es kann jede Frage beantworten (eine nette kleine Anspielung auf ein vor allem in den USA beliebtes altes Kinderspielzeug), denn es weiß buchstäblich alles über alles. Seine schlechte Seite: Es zwingt nicht nur jeden, der es in die Hand nimmt, in seinen Bann, sondern trachtet auch beständig danach Unheil zu stiften. Nach seiner Bergung kann mit Müh und Not gerade noch verhindert werden, dass das Flüstern einen Atomschlag auslöst ... just for the fun of it. Diese erste Prüfung bewältigt Travis und schafft es überdies, die entführte "Tangent"-Mitarbeiterin Paige Campbell zu retten. Womit die für Mystery-Thriller so typische Mann-Frau-Konstellation komplett wäre, um sich den weiteren Herausforderungen zu stellen.
Bücher aus diesem Genre sind klassisches Urlaubslesefutter - das gilt auch für "Die Pforte", das sich allerdings durch eine Reihe origineller Ideen von so manchem aus der Titelflut der vergangenen Jahre angenehm abhebt. Siehe etwa die Rückblenden, in denen wir erfahren, warum Travis überhaupt ins Gefängnis kam - die sind keine bloße Pflichterfüllung, sondern halten tatsächlich einige faustdicke Überraschungen bereit. Und wenn unsere HeldInnen in Zürich in eine Falle ihres Gegenspielers geraten, dann ist diese wirklich bemerkenswert perfide konstruiert - und der Weg heraus ein Tauchgang durch wannenweise Blut. Überhaupt ist Lee in Sachen Gewalt nicht eben zimperlich: Travis etwa schießt einem Gegner gezielt die Augen weg, und spätestens wenn Paige an ihren Entführern und Folterern professionell durchgeführte Rache nimmt, wird auch sie niemand mehr für das zarteste Pflänzchen unter der Sonne halten.
Sehr sympathisch und bei einem US-amerikanischen Autor keineswegs selbstverständlich ist außerdem der Umstand, dass die USA hier mal nicht stellvertretend für die ganze Welt auftreten, sondern dass "Tangent" ein Projekt ist, an dem die gesamte internationale Staatengemeinschaft beteiligt wurde (1978 war Jimmy Carter Präsident, da könnte man's fast sogar glauben) - was es so ganz nebenbei zur größten Verschwörung aller Zeiten macht. Und zwischendurch bleibt auch noch ein wenig Platz, sich über Genreklischees wie die Last-Minute-Rettung lustig zu machen - etwa wenn Travis erfährt, dass ein früherer Plan ihres Gegenspielers über viele Jahre hinweg der Vollendung entgegenstrebte, um kurz vor Ablauf der Frist doch noch vereitelt zu werden: "Drei Stunden", sagte Travis. - "Drei Stunden." - "Fällt sehr schwer, das zu glauben." - "Ja", sagte Paige. - "Ist fast schon unmöglich, das zu glauben."
Wichtiger ist aber ein ganz anderer Umstand: Was Mystery- und Verschwörungsthriller oft so unbefriedigend erscheinen lässt, ist der Umstand, dass die betreffenden AutorInnen erst ein Riesenfass aufmachen und dann nix damit anzufangen wissen. Was wurde da nicht schon alles ans Licht geholt: Vom Heiligen Gral über das Goldene Vlies und die Arche Noah bis hin zu apokryphen Evangelien im Ausmaß eines Bibliothekskatalogs ist so ziemlich jeder mythenbeladene Gegenstand schon verbraten worden, viele davon mehrfach. Auf der wissenschaftlichen Seite wären es die Weltformel, die unerschöpfliche Energiequelle und was nicht gar - und dazu gesellen sich dann noch Dinge, auf die überhaupt kein vernünftiger Mensch kommen würde, vom übersinnlichen Musikstück bis zum Schachbrett. All diese Dinge sollen jeweils dazu angetan sein, "die Welt in ihren Grundfesten zu erschüttern" ... allein, sie tun's nie. In aller Regel liegen sie passiv in der Gegend herum, während die VertreterInnen gegnerischer Organisationen um sie rangeln, ohne dass die Öffentlichkeit je davon erfährt. Genausogut könnte man die mysteriösen welterschütternden Objekte durch einen Batzen Geld oder eine Lastwagenladung Kokain ersetzen - die Handlung wäre exakt dieselbe, bloß hieße sie dann einfach nur "Krimi". In "Die Pforte" hingegen greifen die Portal-Entitäten ganz massiv und direkt ins Geschehen ein - und erst am Ende wird sich zeigen, wer hier wirklich die treibende Kraft ist. - Lees Roman würde eine gute Vorlage für einen Film abgeben. Wäre wohl ein B-Movie, aber eines, das sicher Spaß macht.
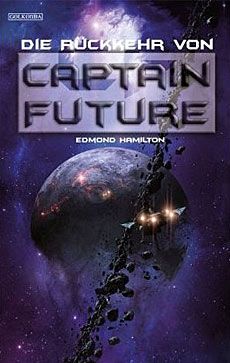
Edmond Hamilton: "Die Rückkehr von Captain Future"
Broschiert, 161 Seiten, € 15,40, Golkonda 2010.
Wo wohl das Durchschnittsalter der LeserInnenschaft hier liegt? Vielleicht mach ich dazu mal eine Umfrage. Die Abenteuer von Captain Future sind jedenfalls ein Fall für weit auseinander liegende Jugenden: Die meisten erinnern sich vielleicht an das Anime, das Ende der 70er in Japan produziert und anschließend auch in Europa ausgestrahlt wurde; auch wenn wir hierzulande überall da, wo weder deutsches noch italienisches Fernsehen empfangbar war, leider im Tal der Ahnungslosen lebten. Seinen Ursprung hatte Captain Future aber in der Literatur. Von den 40er bis frühen 50er Jahren veröffentlichte der US-amerikanische Autor Edmond Hamilton seine Erzählungen um die Futuremen in verschiedenen Pulp-Magazinen, wo er einen zentralen Beitrag zur Etablierung des brandneuen Genres Space Opera leistete. Es waren die gleichen Magazine, die auch Figuren wie Robert E. Howards "Conan" oder Philip Francis Nowlans "Buck Rogers" eine Heimat boten. Beide - nicht zu vergessen auch der gleich alte "Flash Gordon" - wurden dann in derselben Ära wie das "Captain Future"-Anime für Kino und TV recycelt; auch die Pulp-Kultur hat offenbar ihre Zyklen. Auf Deutsch sind Hamiltons Erzählungen in den 80ern erschienen - bis auf die allerletzten, die Hamilton Anfang der 50er veröffentlicht hatte. Der Golkonda-Verlag schließt diese Lücke nun mit einer zweibändigen Ausgabe der "Verschollenen Abenteuer von Captain Future".
Und da sind sie wieder alle beisammen: Neben Curtis Newton alias Captain Future selbst seine drei ungewöhnlichen "Zieheltern" Otho der Androide (der im Anime aus irgendwelchen Gründen vom spitzgesichtigen Asketen zum bulligen Typ mit Kapitänsmütze mutiert ist), das konservierte Gehirn Simon Wright und der Roboter Grag (von dem hab ich noch ein Modell aus Anime-Zeiten daheim). Dazu das gestaltwandelnde Tier Oog und das telepathische Mondhündchen Eek und natürlich das famose Raumschiff "Comet" - und schließlich noch Joan Randall, die Agentin mit Herz für den schnittigen Rotschopf Captain Future. In der Titelgeschichte muss sie zunächst noch heiße Tränen vergießen, weil die Futuremen zuletzt in der Andromeda-Galaxis verschollen waren und inzwischen für tot erklärt wurden. Dabei sind sie längst heimlich zurückgekehrt und verhören in ihrem Mondlabor einen gefangen genommenen Erzfeind der versunkenen menschlichen Zivilisation, von der wir alle abstammen. Und der antwortet mit dem vergnüglichen Pathos, das man von einem Finsterling erwarten kann: "Wie wolt ihr erbärmliches Gezücht aus Fleisch, die ihr sterbt, kaum seid ihr geboren, etwas von der Erhabenheit weit zurückliegender Zeitalter ahnen?"
In den insgesamt vier Erzählungen wird alles aufgeboten, was die Pulp-Science Fiction des Goldenen Zeitalters zu bieten hatte: Da werden Stirnbänder mit "Energiejuwelen" angelegt, die telepathische Angriffe abblocken sollen; da hausen die barbarischen Nachkommen einstiger Superzivilisationen zwischen den megalithischen Ruinen der Vergangenheit; da werden uralte Geheimnisse aus extraterrestrischen Grüften geborgen; da wird in haarsträubender Weise mit Physik und Technik umgegangen (einmal stopft etwa Roboter Grag ein Beruhigungsmittel in seine Brennstoffzelle ...); da entdeckt man, dass die Vorfahren der Menschheit aus dem Weltraum kamen und deren Vorläufer aus noch größeren Fernen: ein Motiv, das später bis hin zur "Perry Rhodan"-Serie noch oft aufgegriffen werden sollte. Und so weiter.
Und jede Geschichte wartet mit ihren eigenen - hölzernen, aber liebenswerten - Attraktionen auf: In "Die Harfner des Titan" wird das lebende Gehirn Simon Wright in einen Körper verpflanzt, um Verhandlungen mit den BewohnerInnen des Saturnmonds zu führen, und bekommt dadurch noch einmal einen Nachgeschmack auf das Leben. In "Kinder der Sonne" folgt Captain Future den Spuren eines verschollenen Freundes zu einem sonnennahen Planetoiden, der natürlich ebenfalls bevölkert ist; das Sonnensystem wimmelt bei Hamilton nur so vor Leben! Dort lässt Captain Future sich gar in ein Energiewesen umwandeln und taucht in die Sonne ein, was in eine wirklich reizvoll beschriebene Orgie aus Licht und Farben mündet. Im humorvollen "Nerven aus Stahl" schließlich stapft der Metallriese Grag wie ein Elefant durch den Porzellanladen zum Psychoanalytiker, weil er glaubt unter Minderwertigkeitskomplexen zu leiden. Zur Therapie wird er auf einen Bergbau-Mond geschickt, wo die Minenroboter einen freien Willen erlangt haben und die Arbeit niederlegen (Roboter-Revolte: noch so ein Klassiker unter den Themen!). Wie Grag das Problem löst ... nun ja, in Gewerkschaftszentralen würde "Nerven aus Stahl" eher nicht als Wartezimmerlektüre ausliegen.
Vier Geschichten aus einer Zeit, als unser aller Lieblingsgenre noch ein Baby war. Ergänzt um ausführliche biografische und bibliografische Anmerkungen am Ende - ganz so, wie es früher mal bei Genre-Büchern Usus war. Wie seltsam, dass sich die Riesenschinken von heute für einen solchen Service nie ein paar Zusatzseiten abknapsen können ... Im Juni folgt unter dem traurigen Titel "Der Tod von Captain Future" der zweite Band mit den allerletzten verschollenen Abenteuern, ergänzt um eine 1996 mit dem Hugo ausgezeichnete Hommage aus der Feder von Allen Steele. Wie sagte obiger Finsterling doch? "Soll ich euch noch mehr Wissen schenken, Menschling? Soll ich euch noch mehr erzählen - bevor ich hinfort eile, um mich mit meinen Brüdern im Kampf gegen die menschliche Brut zu vereinigen?" Aber klar doch!

Kevin Shamel: "Rotten Little Animals"
Broschiert, 100 Seiten, € 12,00, Voodoo Press 2011.
Zum Schluss noch eine Bösenachtgeschichte aus der Abteilung Bizarro: Jahrzehntelang musste die Fauna es über sich ergehen lassen, für Tierdokumentationen bei jeder intimen Tätigkeit gefilmt zu werden - jetzt schlägt sie zurück. Der junge Bizarro-Autor Kevin Shamel aus dem Nordwesten der USA verfasste bislang vor allem Flash Fiction, ehe er 2009 mit "Rotten Little Animals" - nun auch auf Deutsch erschienen - seine erste Novelle veröffentlichte. In diesem Debütwerk illustriert er auf vielfache Weise, wie stark die aktuell unterhaltsamste Gattung des literarischen Undergrounds vom Film beeinflusst wurde.
... und das nicht nur, weil die Handlung mit dem Hinterhof-Dreh eines Zombiefilms beginnt, die Crew um Stinkin' Rat, Dirty Bird und Filthy Pig aus Ratten, Katzen, Hühnern, Hunden ... und einem Diademhäher bestehend. Der 12-jährige Cage, der gerade bei seiner masturbierenden Nachbarin spannte, entdeckt das surreale Geschehen - und spätestens seit Hitchcocks "Fenster zum Hof" wissen wir ja, dass es einem ordentlich Ärger einbringen kann, wenn man aus ebendiesem allzu genau hinausschaut. Cage hat gerade das bestgehütete Geheimnis der Welt entdeckt: nämlich dass Tiere sprechen können und ihren BesitzerInnen heimlich die Drogen klauen. Der lästige Zeuge wird von den Tieren gekidnappt, und weil die Filmgeschichte bekanntlich nicht bei Hitchcock stehen geblieben ist, beschließt man die Entführung ganz zeitgemäß in eine Kombination aus Reality-Format und Torture Porn umzumünzen. Armer gefangener Cage: Als er nach oben sah, entdeckte er drei Ratten, die ihre Ärsche auf ihn gerichtet hatten und dabei kleine Stinkbomben auf ihn herab regnen ließen. Zum Glück hat Shamel ein Einsehen, bevor wir in "Saw"- und "Hostel"-Dimensionen geraten, aber mit Cages Flucht sind wir ja auch noch lange nicht am Ende angelangt.
"Rotten Little Animals" ist eine einzige Verarsche des Filmbiz in all seinen Schattierungen: Vom chaotischen Dreh eines Underground-Streifens zwischen Sex, Drugs & Körperausscheidungen (die Kacke kleckst und kullert ohne Unterlass durchs Bild) über slapstickartige Probleme (unter anderem erweisen sich die Zombie-Katzen zum Entsetzen aller als echt) bis zum rauschenden Festival-Erfolg, der schließlich auch auf die Big-Business-Welt der Menschen überschwappt: Der Soundtrack bekam Platin. Kleine Mädchen wurden ohnmächtig. PETA protestierte. Nach einem Rache-Massaker zieht sich der Hauptdarsteller - ganz wie wir's von Stars, die eine Missetat begangen haben, gewohnt sind - vorübergehend in eine Therapie zurück. Und während alle Welt nach einem Sequel giert, hechelt Shamel auch noch schnell alle Elemente durch, die man an guter Popcorn-Unterhaltung nicht missen möchte: Die rasende Autoverfolgungsjagd, den großen finalen Knall und etwas, das trotz stapelweise herumliegender Leichen irgendwie als Happy End durchgehen könnte.
Dem Buch selbst hätte zwar eine verlängerte "Post Production" gutgetan, weil sich da auf den 80 Seiten Handlung doch einiges an Druckfehlern angesammelt hat; rasendes Tempo und Underground-Feeling hin oder her. Nichtsdestotrotz ist es ein höchst erfreulicher Umstand, dass Bizarro inzwischen auch unter den deutschsprachigen Verlagen Interessenten gefunden hat. Hoffentlich auch beim Publikum!
In der nächsten Rundschau steht natürlich der neue Alastair Reynolds auf dem Programm, außerdem soll Paul Melko eine zweite Chance bekommen; hoffentlich vergurkt er nicht auch die. Und dazu werfe ich mal die Frage in den Raum, ob - so gegen Sommer hin und einfach deshalb, weil sich da schon so viel angesammelt hat - ausnahmsweise auch mal eine Rundschau-Ausgabe mit ausschließlich englischsprachigen Büchern akzeptabel wäre. Let's have a discussion! (Josefson)