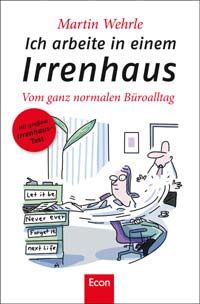"Wenn Mitarbeiter auspacken, bröckeln die Fassaden", schreibt Martin Wehrle in der Einleitung seines Buchs "Ich arbeite in einem Irrenhaus". Die Unternehmen, Tretmühlen von einst, seien die Klapsmühlen von heute geworden, so der Karriereberater aus Deutschland, der sich dabei auf die Erzählungen der "Insassen", sprich der Mitarbeiter, beruft. Im Interview mit derStandard.at erläutert Wehrle mit Beispielen, warum seiner Meinung nach der Wahnsinn grassiert und welchen Ausweg es geben könnte.
derStandard.at: Wieso haben Sie dieses Buch geschrieben? Greift der berufliche Wahnsinn um sich?
Wehrle: Ich bekomme die geballte Ladung dieses Wahnsinns ab. Als Karriereberater spreche ich mit Menschen, die in Unternehmen arbeiten und bei mir in der Beratung die Wahrheit auf den Tisch legen. Was ich da bei deutschen und österreichischen Unternehmen gesehen habe, das ist derart skandalös und dilettantisch, dass es jeder Beschreibung spottet. Mit dem Buch wollte ich aufzeigen, was in Firmen falsch läuft und wie die Mitarbeiter mit der Situation besser umgehen können.
derStandard.at: Ist das eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren derart potenziert hat?
Wehrle: Absolut. Früher gab es relativ klare Regeln, mit welchem Konzept man erfolgreich sein kann. In den letzten Jahren hat der Einfluss der Globalisierung zugenommen. Und da, wo einmal Regeln waren, herrscht jetzt Chaos. Es wird immer irrationaler, immer kurzfristiger entschieden. Börsenorientierte Unternehmen schauen primär auf die Quartalszahlen und Mittelständler reduzieren Personal, nur um kurzfristig besser dazustehen. Die langfristige Sichtweise, die früher in Familienbetrieben dominierend war, also von Generation zu Generation, ist völlig unter die Räder gekommen. Viele Manager wechseln schon nach kurzer Zeit die Firma. Der Mist, den sie hinterlassen, fängt erst danach so richtig zu dampfen an.
derStandard.at: Es geht also nur um den persönlichen, kurzfristigen Erfolg?
Wehrle: Ein Beispiel dazu aus meinem Buch: Ein großer Technologiekonzern hat die Regel erlassen, dass Gäste nur mehr bei Meetings, die länger als vier Stunden dauern, bewirtet werden dürfen. Und zwar nur mit einer Flasche Mineralwasser und einem Stück Obst. Da sitzen Investoren, die Millionenaufträge platzieren wollen. Etwa ein reicher Araber, der Hunger bekommt, in den konzerneigenen Shop geht, hier eine Dose Kekse kauft und die dann mit den Mitarbeitern teilt. Man glaubt etwas zu sparen, indem man so einen nebensächlichen Posten wie die Bewirtung streicht. In Wirklichkeit spart man nur das eigene Image zusammen, was dem Unternehmen letztendlich sehr viel Geld kostet.
derStandard.at: In Ihrem Buch erwähnen Sie weitere Grotesken. In einer Firma erhalten Mitarbeiter eine Prämie, wenn Sie am Ende des Jahres keinen Krankenstandstag aufweisen.
Wehrle: Das ist eine typische Geschichte, wie eine Verdachtskultur, die im Management vorherrscht, zum Unglück führt. Der Chef eines mittelständischen Betriebes hat sich beim Blick in die Statistik gedacht, meine Mitarbeiter haben viele Fehltage, diese möchte ich reduzieren. Und hat eine Prämie ausgeschrieben. Für alle, die bis ins nächste Jahr ohne Fehltage auskommen. Dann kam eine Grippewelle und alle haben sich krank in die Firma geschleppt. Die Viren haben sich schlagartig ausgebreitet, bis irgendwann die halbe Firma lahm lag. Das Resultat der Maßnahme war, dass die Zahl der Krankenstandstage in etwa um ein Drittel gestiegen war. Laut einer Studie kostet es den Unternehmen viel mehr Geld, wenn kranke Mitarbeiter zur Arbeit kommen, weil die Kranken unkonzentriert arbeiten oder weil sie eben andere anstecken.
derStandard.at: Eine Aufgabe des Managements, das den Mitarbeitern zu vermitteln?
Wehrle: Absolut. Wenn ein Klima des Vertrauens herrscht, dann spüren das die Mitarbeiter und agieren dementsprechend. Besteht eine Verdachtskultur, dann wird den Mitarbeitern suggeriert, sie könnten Schummler oder Abkassierer sein und geraten automatisch unter Rechtfertigungsdruck.
derStandard.at: Ein weiteres Beispiel aus Ihrem Buch ist, dass ein Mitarbeiter via Intranet von seiner Degradierung erfährt. Können Sie den Fall schildern?
Wehrle: Ein Mitarbeiter einer Abteilung hat immer wieder mal ins Intranet geschaut, weil dort neues Personal vorgestellt wurde. Dann sah er, dass seine eigene Abteilung in zwei Monaten einen neuen Vorgesetzten bekommen sollte. Er wusste nichts davon, konfrontierte völlig verärgert seinen Abteilungsleiter damit und fragte ihn: "Warum wissen wir noch nicht, dass Sie uns verlassen?" Der Abteilungsleiter wurde dann völlig blass, weil er auch nichts davon wusste. Auf diesem Wege hat er von seiner eigenen Degradierung erfahren. Das ist ein typischer Fall, nämlich dass die Unternehmensleitung oft nicht mit den Mitarbeitern spricht und einfach über ihre Köpfe hinweg entscheidet.
derStandard.at: Es kommt auch vor, dass Firmen umziehen, ohne ihre Mitarbeiter über die Beweggründe zu informieren.
Wehrle: Ein Chef hat, nur um den eigenen Fahrtweg zu verkürzen, den Standort der Firma ans andere Ende der Stadt verlegt und damit den Großteil seiner Mitarbeiter einen viel längeren Weg zugemutet. Alleine das wäre schon ein Skandal, dazu kommt noch die Heuchelei, dass er sich nicht dazu bekennt, sondern sagte, es war eine Eigenbedarfskündigung des Firmengebäudes. Mitarbeiter für dumm zu verkaufen, ist die größte Sünde der Firmen.
derStandard.at: Sie vergleichen Firmen mit Restaurants, wo man als Kunde keinen Einblick in die Küche, also hinter die Kulissen hat. Ist die Diskrepanz zwischen Sein und Schein so groß?
Wehrle: Die ist gigantisch. Man hat als Kunde zumeist Respekt vor Unternehmen, wenn man das große Konzerngebäude sieht oder einen Blick auf die Umsatzzahlen wirft. Schaut man aber durch das Schlüsselloch, sieht man einen Kindergarten, ein heilloses Chaos. Meetings sind hier ein interessantes Thema. Die werden immer mehr und mehr durchgeführt. Letztlich ist eine hohe Anzahl an Meetings nie ein Hinweis dafür, dass eine Firma gut läuft, sondern ganz im Gegenteil ein Beweis, dass Chaos herrscht und sich verschiedene Abteilungen ins Gehege kommen.
derStandard.at: Geht das von Ihnen beschrieben Chaos nur von den Chefetagen aus, oder wird es von den Mitarbeitern inspiriert?
Wehrle: Auf den ersten Blick kann man sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn Sie einen Arzt besuchen, merken Sie schon alleine am Agieren der Sprechstundenhilfe, ob der Arzt kundefreundlich ist, oder nicht. Es färbt vom Chef auf die anderen ab. Aber was bringt es, wenn man sich darauf zurückzieht? Gar nichts, denn als Mitarbeiter hat man die heilige Pflicht, eine Firma zu suchen, in der man sich wohlfühlt. Wenn man nur über die Firma lästert und keine Konsequenzen zieht, dann schädigt man sich selbst und wird zu einem Rädchen im Getriebe des Irrsinns.
derStandard.at: Jobwechsel als einzige Alternative oder doch "aussitzen"?
Wehrle: Die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Jeder vierte Selbstmord geht auf Probleme am Arbeitsplatz zurück. Das sind sehr ernste Probleme, weil viele Menschen zu lange in unzumutbaren Situationen verharren. Sie bleiben im Krokodilsgraben sitzen, bis sie dieser Irrsinn verschlingt. Man muss die Leute ermutigen, sich nach Firmen umzuschauen, wo eine andere Kultur herrscht, wo man sich nicht verbiegen muss und ein erfülltes Arbeitsleben findet.
derStandard.at: Was ist die Lösung? Komplette emotionale Distanz zum Arbeitsleben?
Wehrle: Ich sollte mir immer bewusst machen, dass es sich um eine Geschäftsbeziehung handelt. Viele verwechseln das und denken, es sei eine einzige, große Familie, wo der Chef der Schwiegervater ist. Aber wenn es der Firma schlecht geht, wird man wie ein Stück Müll entsorgt. Ich muss immer im Kopf haben, dass die Firma nicht meine, sondern ihre eigenen Interessen verfolgt. Hat man das internalisiert, kann man sich immer noch engagieren – und auch die eigenen Werte außerhalb des Büros verwirklichen.
derStandard.at: Im Buch haben Sie eine Art Frühwarnsystem, wie man schon im Vorfeld – zum Beispiel im Bewerbungsverfahren – rausfiltern kann, ob es sich um eine "Irrenhaus"-Firma handelt. Wie?
Wehrle: Das ist ein wichtiger Punkt, weil man ja nicht ins Irrenhaus eingewiesen wird, wenn man jetzt eine Firma so bezeichnen mag, sondern man weist sich durch die Bewerbung selbst ein. Ein Beispiel: wenn eine Anzeige immer wieder für dieselbe Stelle erscheint, scheint die Sache einen Haken zu haben. Vielleicht hat die Firma einen allzu hohen Anspruch, vielleicht sind da schon viele abgesprungen.
derStandard.at: Und sonst?
Wehrle: Oder die Firma sucht jemanden "zum nächstmöglichen Zeitpunkt". Das kann auf ein fürchterliches Chaos hindeuten und dass die einen Feuerwehrmann brauchen, der den Arbeitsbrand löscht, oder jemand ist kurzfristig gegangen oder rausgeflogen.
derStandard.at: Bei Vorstellungsgesprächen?
Wehrle: Man bekommt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch und es heißt darin beispielsweise, "wir übernehmen Ihre Reisekosten nicht". Das ist ein starkes Signal, dass Mitarbeiter nicht gut behandelt werden. Ein einfacher Tipp ist, beim Vorstellungsgespräch zu schauen, wie die Leute auf dem Flur aussehen. Sind die fröhlich oder als Trauerprozessionszug unterwegs? Wie reden die Leute miteinander?
derStandard.at: Sie postulieren die Macht der Arbeitnehmer, um Firmen zu boykottieren. Wie weit ist das in der Praxis verbreitet?
Wehrle: Es gibt eine Riesenmacht der Arbeitnehmer, nur haben die noch gar nicht erkannt, wie mächtig sie sind. Früher konnte ein Fabriksbesitzer die Leute am Fließband nach Belieben austauschen. Jeder, der auf der Straße stand, war geeignet, diesen Job zu machen. Heute sind die meisten Arbeitnehmer Spezialisten, die über ihren Bereich besser Bescheid wissen als ihre Chefs.
derStandard.at: Können hier Bewertungsportale eine Rolle spielen?
Wehrle: Wenn sich Leute noch mehr austauschen, etwa über Arbeitgeberplattformen, und die Diskrepanz zwischen Sein und Schein von Firmen noch transparenter machen, dann wird es eine Evolution geben. Die guten Mitarbeiter werden bei jenen Firmen mit einer gesunden, demokratischen Kultur landen und die schlechten bleiben bei den Irrenhaus-Firmen hängen. Was wiederum im Niedergang dieser Unternehmen resultieren wird.
derStandard.at: Ist das ein Prozess, der schon großflächig im Gange ist?
Wehrle: Es hat schon angefangen, wird aber noch dauern. Gefragte Spezialisten können schon heute weltweit anheuern. Wenn Unternehmen diese permanent vergraulen, fangen sie irgendwann an, ihre Philosophie zu überdenken. Das kann man mit einem Gasthaus vergleichen. Solange der Wirt eine volle Gaststube hat, wird er sein Essen nicht infrage stellen.
derStandard.at: Die "Macht der Arbeitnehmer" betrifft aber eher den qualifizierten Bereich?
Wehrle: Nicht nur, wenn man sich zum Beispiel den Bereich des Handwerks vor Augen führt, wo auch überall gute Leute gesucht werden. Auch als Handwerker habe ich eine gewisse Macht, für wen ich arbeite und was ich mit mir machen lasse. Man muss hier Grenzen setzen. (om, derStandard.at, 28.3.2011)