David Marusek: "Wir waren außer uns vor Glück"
Kartoniert, 200 Seiten, € 15,40, Golkonda 2011
Die Monatsauswahl beginnt mit einer guten Nachricht für alle diejenigen, die im Zweifelsfall vor englischsprachiger Literatur eher zurückscheuen: Mit David Marusek gibt's einen der interessantesten Autoren, die in den vergangenen Jahren die Bühne der Science Fiction betreten haben, jetzt erstmals auch auf Deutsch zu lesen. Der Golkonda-Verlag hat Maruseks Kurzgeschichtenband "Getting To Know You" (für Details hier die Nachlese) in leicht abgeschlankter Fassung herausgebracht. Weggefallen sind ein paar kürzere Erzählungen, die für sich allein stehen. Enthalten sind in "Wir waren außer uns vor Glück" dafür alle Geschichten – fünf insgesamt, zwei davon in Novellenlänge -, die sich in eine gemeinsame Future History einordnen lassen.
Wir betreten eine von Nanoprozessoren durchflutete Welt des 22. Jahrhunderts, in der die omnipräsenten Minimaschinchen zu einer Konstante geworden sind wie die Luft und das Wasser. Im menschlichen Körper sorgen sie unter anderem für Gesundheit, quasi-ewiges Leben und nicht zu vergessen geistige Vernetzung mit dem globalen Kommunikationssystem. Ein strahlendes Hightech-Paradies, das auch sehr, sehr dunkle Schatten wirft – zum einen auf die Umstände und den Preis seiner Errichtung, worauf in "Wie wir uns kennenlernten" und "Kraut und Kohl, oder: Wie wir Amerika gesundschrumpften" näher eingegangen wird. Zum anderen auf die – nennen wir's mal so – laufenden Kosten des Systems. Denn außer nützlichen Smartactives schwirren auch jede Menge Nasties herum, Nachfolgegenerationen einstiger Biowaffen, die einen menschlichen Körper binnen kurzem in rote Suppe verwandeln können. Mehrere Verteidigungsbarrieren stellen sich ihnen entgegen: Die Städte hüllen sich in die schützenden Membranen ihrer Baldachine, in den Straßen und Häusern patrouillieren kleine robotische Milizschnecken, die BürgerInnen routinemäßig auf eventuelle Verseuchungen "kosten", zudem trinkt man täglich seinen Visola-Cocktail, der den körpereigenen Nano-Haushalt im Gleichgewicht hält. Selbst diejenigen, die auf der Sonnenseite Edens leben, mussten sich also damit abfinden, dass ihr Alltag einem permanenten Kriegszustand auf molekularer Ebene gleicht.
Die zentrale Geschichte "Wir waren außer uns vor Glück", die auch der Ausgangspunkt für die beiden Romane "Counting Heads" und "Mind Over Ship" war, schildert, wie ein privilegierter Bürger durch eine simple Fehlfunktion in tiefste Tiefen stürzt. Zugleich spiegelt der traurige Fall des Samson Harger den späteren Niedergang des gesamten Systems wider. Denn skurrilerweise hat Marusek das Ende der Welt, die er in mehreren Erzählungen und vor allem den beiden Romanen überaus detailreich entwirft, ein Jahrzehnt zuvor bereits in der Erzählung "Das Hochzeitsalbum" vorweggenommen. Und das nicht einmal als zentrales Motiv, sondern lediglich als Hintergrundrauschen zur eigentlichen Handlung – und als Beschreibung einer Phase in der Geschichte der Zukunft, die mit diesem Kollaps nicht enden wird. "Ein Junge im Cathyland", ursprünglich als Kapitel des "Hochzeitsalbums" geplant, geht genauer auf die Phase des unmittelbaren Danach ein. Durch die Augen des jungen Mikol verfolgen wir mit, wie eines der letzten Erbstücke der Hightech-Ära aufgespürt wird. Und melancholischer könnte ein Epilog kaum ausfallen: Am Anfang beobachtet Mikol, wie Trümmerstücke und die Leichen ehemaliger Weltraumbewohner als Sternschnuppen zur Erde fallen, am Schluss reagiert er auf das Gesehene wie das Kind, das er ist und das gar nicht begreifen kann, dass es gerade das Ende einer Epoche miterlebt hat.
"Das Hochzeitsalbum" habe ich ja bereits anlässlich von "Getting To Know You" als eine der besten SF-Erzählungen der vergangenen Jahre gepriesen. Hier zeigt sich besonders gut, wie Marusek transhumane Szenarien, die bei anderen AutorInnen oft recht kalt rüberkommen, mit einer sehr menschlichen Seite versehen kann. Ob es sich dabei um einen "echten" Menschen oder eine Daten-Existenz handelt, spielt nicht notwendigerweise eine Rolle, wie das Schicksal des Sims Anne zeigt, einer ihrer selbst bewussten virtuellen Kopie der originalen Anne, die als "Schnappschuss" erstellt wurde, um die Freude des Hochzeitstags für die Ewigkeit festzuhalten. Niemand ahnt zu dem Zeitpunkt, wie wörtlich dies noch zu nehmen sein wird. Marusek verschmilzt in der Folge die Beschreibung einer gesellschaftlichen Emanzipationsbewegung mit fast schon metaphysischen Elementen – zumindest geht es um das Leben nach dem Tod -, und dies wird nicht nur den zuvor erwähnten Kollaps auslösen, da liegt auch ein echter Hauch von Ewigkeit in der Luft. Beeindruckend.
Nach zwei Romanen und reihenweise Kurzgeschichten hat man sich an die Nomenklatur eines Autors gewöhnt. Ist also ziemlich witzig, statt vertraut gewordener Begriffe wie proxy oder belt valet nun plötzlich solche wie Stellvertreter bzw. Abzug oder Gürtelbutler zu lesen – und fast schon eine Neuentdeckung. Allen, die Marusek noch nie gelesen haben, sei ans Herz gelegt: Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen! Was auch immer heuer noch an Science Fiction auf Deutsch erscheint, "Wir waren außer uns vor Glück" wird am Ende des Jahres unter den Top Ten rangieren. Und für alle, die in der gleichen bedauerlichen Lage sind wie ich, dass sie schon alles von Marusek kennen, heißt es geduldig weiter warten: Aus seinem aktuellen Romanprojekt macht er noch ein ziemliches Geheimnis. Lassen wir uns überraschen!
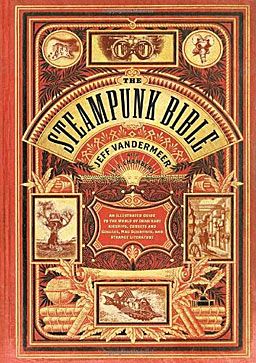
Jeff VanderMeer: "The Steampunk Bible. An Illustrated Guide to the World of Imaginary Airships, Corsets and Goggles, Mad Scientists, and Strange Literature"
Gebundene Ausgabe, 224 Seiten, Abrams Image 2011.
Steampunk ist eindeutig das Genre der Stunde ... und nach ein wenig Nachdenken bin ich zu der Meinung gekommen, dass dies ein durchaus erfreulicher Umstand ist. Einfach deshalb, weil Steampunk zwar ein gewisses - ohnehin sehr großzügig definiertes - Setting vorgibt, in Sachen Plot-Vielfalt aber einen sehr viel größeren Freiraum lässt als die beiden vorangegangenen Modewellen "Vampire" und "Zombies"; mögen sie in Frieden ruhen. Und lange. Natürlich kreist auch Steampunk trotz aller wachstumsbedingten Aufsplitterung um eine Mitte. Die wurde mal auf eine (nicht 100 Prozent ernstgemeinte) Formel gebracht, die da lautet: STEAMPUNK = Mad Scientist Inventor [invention (steam x airship or metal man / baroque stylings) x (pseudo) Victorian setting] + progressive or reactionary politics x adventure plot. Jeff VanderMeer, ein Autor des Ungewöhnlichen, der zusammen mit seiner Frau Ann bereits mehrere Steampunk-Anthologien zusammengestellt hat, gibt diese Formel zwar wieder, hat sich für seinen wagemutig "The Steampunk Bible" betitelten Bildband aber sehr bemüht, das Genre aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten. Wer mit Steampunk bislang noch gar nichts zu tun hatte, bekommt hier eine umfassende Einführung - und alle anderen zumindest eine Sintflut an phänomenalen, fantastischen, wahnwitzigen, göttlichen Bildern. A world seen through aviator goggles, kurz: eine Augenweide!
Auch wenn dies hier eine Rubrik für LeserInnen ist, macht Literatur nur einen Teil des Phänomens Steampunk aus; und nicht einmal notwendigerweise den größten. Wem dieser Aspekt in "The Steampunk Bible" zu kurz kommt, der kann sich besagten Anthologien VanderMeers widmen - plus/oder einer Auswahl der zahllosen Pendants anderer HerausgeberInnen, die in den vergangenen Jahren nur so aus dem Boden geschossen sind. VanderMeer beginnt den Literaturabschnitt erwartungsgemäß mit den beiden Übervätern Jules Verne und H. G. Wells, die er im Kontext ihrer Zeit und ihrer unterschiedlichen schriftstellerischen Gewichtungen vorstellt. Letztere spiegeln sich in einem Spannungsverhältnis zwischen Eskapismus und Bewusstsein für gesellschaftliche Missstände wider, welches das Genre bis heute prägt. Auch auf weniger bekannte Steampunk-Vorläufer wie das US-amerikanische Krawallblattgenre der Edisonade oder chauvinistische japanische Abenteuerromane um die Jahrhundertwende wird nicht vergessen. Die erste eigentliche Steampunkwelle kam in den 1980er Jahren ins Rollen, mit Romanen von K.W. Jeter (hier die Nachlese zur Rezension von "Die Nacht der Morlocks"), der zugleich der Erfinder des Begriffs "Steampunk" war, sowie von James Blaylock und Tim Powers. Plus, unabhängig davon und ein wenig später, "Die Differenzmaschine" der beiden Cyberpunk-Aushängeschilder Bruce Sterling und William Gibson. Der Roman erscheint 2012 übrigens nach 20 Jahren in einer Neuedition bei Heyne, Vorfreude ist angebracht!
Und auch wenn die heutige Titelvielfalt suggeriert, dass das Genre immer schon dick da war, verebbte diese erste Welle bald wieder. Es sollte eine lange Pause folgen, die bis in die späten Nuller Jahre anhielt, als Gail Carrigher, Jay Lake, Cherie Priest und all die anderen Sterne auf den Plan traten, die heute am Genre-Himmel strahlen. In dieser eigentlich recht langen Interregnumsphase waren es eher Romane, die auch Steampunk-Elemente verwendeten (siehe etwa Stephen Baxters großartige "Time Machine"-Fortsetzung "Zeitschiffe"), die das Fähnlein hochhielten. Und Comics, sei es "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" oder "Hellboy" - beide Vorlagen für Verfilmungen. In der Tat ist vielen Steampunk eher ein filmischer als ein literarischer Begriff: Da hätten wir etwa das Will-Smith-Vehikel "Wild Wild West" (das keiner so recht mag; wusste übrigens gar nicht, dass der Film auf einer TV-Serie aus den 60er Jahren beruht), die noch viel misslungenere Neuverfilmung der "Time Machine", die ganz im Gegensatz dazu fantastischen Animes "Das Schloss im Himmel" und "Das wandelnde Schloss" von Hayao Miyazaki, andere Animes wie "Steamboy", die Steampunk/Fantasy-Verschmelzung "Der Goldene Kompass" und ungewöhnliche Einzelfälle wie "#9" oder "Die Stadt der verlorenen Kinder". Und die Liste ist keineswegs vollständig - auf Christopher Nolans "The Prestige" hat VanderMeer vergessen, und viele weitere Beispiele gäbe es auch noch. Kein Wunder, dass Steampunk gerne für Filmproduktionen aufgegriffen wird, die Optik macht eben einfach was her.
Kein Wunder auch, dass die Steampunk-AutorInnen von heute sich weniger auf literarische Vorbilder berufen als auf einerseits Filme (inklusive der kunterbunten Jules-Verne-Verfilmungen der 50er und 60er Jahre) sowie andererseits und vor allem auf Steampunk als gelebte Subkultur - ein real existierendes Phänomen, das seit den 90ern kontinuierlich gewachsen und vor allem in den USA und Großbritannien beheimatet ist. VanderMeer widmet diesem Aspekt zwei lange Abschnitte. Im (Irr-?)Glauben, dass dies den LeserInnen hier am wenigsten wichtig ist, überspringe ich mal den Teil, der sich - inklusive Modestrecken - um selbstgemachte Outfits und Accessoires dreht - also all die Möglichkeiten, seiner individuellen Steampunk-Persönlichkeit respektive Steamsona Ausdruck zu verleihen. Ebenso viel Raum erhält nämlich der Abschnitt zu Kunst & Handwerk, der zwar ein Pendant zu dem über die Mode darstellt, aber irgendwie die spektakuläreren Bilder liefert. Und was für welche! Abgesehen von einer Bastelanleitung am Ende gibt's hier unter anderem die mechanischen Riesentiere der französischen Ausstellung Machines of the Isle of Nantes zu bestaunen, die Schrottskulpturen des US-amerikanischen Maschinenparks Forevertron oder auf der mehr praktischen Seite Computer im Design des 19. Jahrhunderts und andere Erzeugnisse von Datamancer und dem Steampunk Workshop. Zu den kursiv gesetzten Begriffen lege ich übrigens jedem eine Google-Search ans Herz, ebenso wie zum Schneckomobil The Golden Mean, dem Raygun Gothic Rocketship oder der Comic- und Waffenbastel-Wunderkammer des Doctor Grordbort.
In Kunst und Handwerk der Bastler bzw. Tinkers drückt sich vielleicht am besten aus, was die Philosophie hinter Steampunk ausmacht: DIY, Individualismus und Kreativität werden großgeschrieben, statt steriler Fließband-Technologie, die ihre Funktionen hinter einer glatten Oberfläche verbirgt wie das iPad, geht es - in den Worten von Altmeister Miyazaki - um the inherent warmth of handicrafted things. Die Form muss gleichermaßen beeindruckend sein wie die Funktion, und beide sollen verstanden werden: Nur wer die Geräte, die er benutzt, auch selber bauen bzw. reparieren kann, hat einen nachhaltigen Zugang zu Technologie und ist für die Katastrophe, auf die unsere nicht-nachhaltige Zivilisation möglicherweise zusteuert, gerüstet (im Netz findet sich übrigens sogar "A SteamPunk's Guide to the Apocalypse" als pdf-File zum Download, nur so für alle Fälle). Womit wir wieder beim Ausgangspunkt angelangt wären, dem oben genannten Spannungsverhältnis zwischen Eskapismus und Gesellschaftskritik.
In "The Steampunk Bible" kommen einige AutorInnen zu Wort, die betonen, dass die Vergangenheit keinesfalls verklärt werden darf und beispielsweise in einem Roman auch auf die - heftigen - sozialen Schattenseiten des viktorianischen Zeitalters und seiner literarischen Derivate einzugehen ist. Viele beherzigen dies - es gibt aber auch jede Menge AutorInnen, die lediglich ein geiles Setting für schwülstige Romanzen und Krimis suchen und Eskapismus in Reinkultur betreiben. SF-Veteran Michael Moorcock hat bereits gallig vorgeschlagen, das Genre in "Steam Opera" umzubenennen, weil es doch viel öfter um Geschichten aus der Upper Class als um solche aus der Welt der ArbeiterInnen ginge, die wirklich im Dampf der Maschinen lebten. Überhaupt der Name: Jay Lake (Autor der ab 2012 auch auf Deutsch erscheinenden "Mainspring"-Trilogie und leider nicht in VanderMeers Buch enthalten) sieht den Genrenamen höchst nüchtern und betrachtet -punk lediglich als Anhängsel, das eine neue Modeströmung bezeichnet, analog zu -gate (wie in Water- oder Nipplegate) für einen Skandal. VanderMeer und seine Ko-Herausgeberin S. J. Chambers lassen aber primär jene zu Wort kommen, die die - angestrebte oder tatsächliche - Ideologie des Genres betonen und "Punk" ganz klar mit der Philosophie des Do-it-Yourself gleichsetzen.
Wird "The Steampunk Bible" nun ihrem anspruchsvollen Namen gerecht? Wenn man sie mit ein paar apokryphen Evangelien ergänzt, auf jeden Fall. Die wären dann im Internet zu finden. Das Buch hat eine eigene Website, auf der auch zahlreiche weiterführende Links zu finden sind, für die auf Papier kein Platz mehr war. Und wenn man schon mal im Netz hängt, kann man auch gleich exotischen, aber ergiebigen Stichwörtern wie "Muslim Steampunk" nachgehen oder sich auf YouTube ein Bild von den vielen im Buch enthaltenen Film- und TV-Serientipps machen (z.B. "Mutant Chronicles", "The Secret Adventures of Jules Verne", "BraveStarr" und das originale "Wild Wild West") - darunter auch solche, die nur hier zu finden sind wie die "Adventures of the League of STEAM". Auf jeden Fall ist "The Steampunk Bible" ein grandioses Coffee Table Book. Und übermäßig bierernst muss man das Ganze ja auch nicht nehmen. Wie Steampunk-Pionier James Blaylock über sein Genre sagt: "I like the intellectual / scholarly efforts to explain and define it but the costumes and the goggles with gears sprouting from the corner and the steam-powered rayguns are simply a lot of fun."
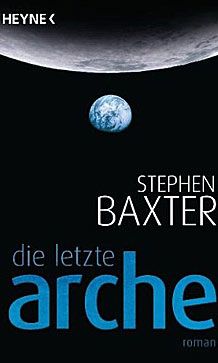
Stephen Baxter: "Die letzte Arche"
Kartoniert, 687 Seiten, € 10,30, Heyne 2011.
Stephen Baxters Weltuntergangsroman "Die letzte Flut" ("Flood") endete - ein fantastisches Bild - mit der sanften Überflutung des Mount Everest, dem letzten verbliebenen Stückchen Land, nachdem der Meeresspiegel in einem niemals für möglich gehaltenen Ausmaß angestiegen war. Keine Klimaerwärmung war die Ursache, sondern das Austreten von Wassereinlagerungen, die es einer vor einigen Jahren veröffentlichten Studie nach möglicherweise (und im Roman eben tatsächlich) im Erdmantel gibt. Den langsamen Untergang der Menschheit schilderte Baxter im Stil einer mehrere Jahrzehnte umspannenden Chronik bis zum Jahr 2052, festgemacht an einer Gruppe von WissenschafterInnen, die eine gemeinsame Vergangenheit verband.
Die Fortsetzung "Die letzte Arche" (2009 als "Ark" erschienen) greift diese Form auf und geht dafür zunächst zu einer Weggabelung im Jahr 2041 zurück, als einige der Hauptfiguren von "Flood" voneinander Abschied nahmen. Diesmal wechseln wir jedoch die Perspektive und bleiben bei denen, die wir damals in "Flood" aus den Augen verloren hatten. Der neue Schauplatz der Handlung ist Colorado, wo eine Weltraum-Arche gebaut wird ... und weil Baxter Prozesse oft wichtiger sind als Einzelpersonen, klettern wir nach diesem kurzen Zwischenstopp erst mal weiter auf der Zeitlinie zurück und lassen uns schildern, was sich in Colorado seit den frühen Jahren der Weltflut so getan hat. Von nun an wird es dann aber chronologisch weitergehen, bis 2041, 2052 und schließlich sogar darüber hinaus.
LaRei ist der Name eines Netzwerks von Superreichen, in dem sie sich ursprünglich über Themen wie gute Schulen und exklusive Ferienorte ausgetauscht hatten - durch die globale Katastrophe mutiert es unversehens zum Survivalisten-Pool. Eine süße Pointe ist, dass die multimilliardenschweren Mitglieder übereinkommen, wie Terroristenzellen vorzugehen, um unabhängig voneinander ihre jeweiligen Archen zu bauen. Ein Schiff war es in "Flood" - hier nun soll es ein interstellares Raumschiff sein. Für Baxter ist dies zugleich Gelegenheit, ein paar ältere und neuere Konzepte aus der Wissenschaftsgeschichte einzubauen: Vom niemals verwirklichten Atombomben-Antrieb des US-amerikanischen Orion-Programms der 60er Jahre bis zum "Warp-Antrieb", zu dem in den letzten Jahren einige ernstzunehmende - wenn auch rein theoretische - Abhandlungen in Wissenschaftsmagazinen erschienen sind. Stichwort "theoretisch": Dass die ProjektbetreiberInnen innerhalb weniger Jahrzehnte - und inmitten einer zerfallenden Infrastruktur - die graue Theorie in die Praxis umsetzen sollen, ist nicht ganz so leicht zu schlucken; anders gäbe es aber keinen Roman. Ohnehin geht lange Zeit nichts weiter, bis die US-Regierung selbst den - in den Worten des neuen Befehlshabers - Schwuchtelschuppen in Colorado übernimmt.
Im Prinzip ist das ganze Projekt Irrsinn, eine Maschine, die mit Fleisch und Blut und falschen Hoffnungen betrieben wurde, wie es an einer Stelle heißt. Der ganze Mammutaufwand wird betrieben, um gerade einmal 80 Menschen in ein anderes Sternsystem mit einem (hoffentlich) bewohnbaren Planeten schicken zu können. Eine weit größere Zahl von KandidatInnen wird von Kindheit an auf diesen Zweck hin trainiert - unter ihnen Holle Groundwater (was für ein Name in dem Kontext!!!), eine graue Maus, die aber im Verlauf des Romans noch stark an Konturen gewinnen wird, und die geborene Leaderin Kelly Kenzie. Eine wichtige Rolle wird später noch Grace Gray spielen, jenes Mädchen, das an der Weggabelung von 2041 aus Band 1 herüberwechselt. Was uns auch schon zum größten Problem der Hauptfiguren hinführt: Nicht nur dass im Verlauf des Programms erbarmungslos ausgesiebt wird, es stoßen auch nach Jahren noch immer wieder Neulinge aus irgendwelchen Interessengruppen dazu, die keinerlei Training absolviert haben, aber langjährige KandidatInnen den Platz kosten. Unzählige persönliche Tragödien spielen sich ab - parallel zur eskalierenden Grausamkeit in der schrumpfenden Welt. Der Umgang mit den trostlosen Massen der Eye-Dees (eine Verballhornung von Internal Displaced Persons, also Flut-Flüchtlingen aus dem eigenen Land) wird brutaler - man wundert sich nicht und ist doch schockiert, als die erste Vergasung beschrieben wird. An Bord der Arche wird sich die schleichende Verrohung dann in kleinerem Rahmen fortsetzen. Wobei ich hierzu lieber nicht mehr sagen will - der Klappentext verrät gefährlich viel über das Schicksal der Mission (ich würde ihn überblättern).
Nachdem Baxter beschlossen hat, doch noch einmal recht ausführlich auf den Ablauf der Weltflut einzugehen, gliedert sich/zerfällt "Die letzte Arche" in zwei Hälften und damit zugleich in zwei komplett unterschiedliche Genres - das eine ein Apokalypse-Plot, das andere eine Space Opera, Unterabteilung Generationenschiff. Eine knifflige Aufgabe, vielleicht sogar eine Lose-Lose-Situation. Dass wir es bei "Flood"/"Ark" mit dem eher ungewöhnlichen Format einer Duologie zu tun haben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Baxter das Projekt ein wenig aus den Händen geglitten ist. Die Existenz zweier weiterer Archen wird in Band 1 kurz erwähnt - eine davon hat nun ihr eigenes Buch erhalten, die dritte hingegen wird am Ende von Band 2 eher beiläufig mit abgehandelt. Sinn und Zweck des Raketenschwarms, den Russland in Band 1 recht ominös hinaus ins All geschickt hatte, wird sogar nur in einem Nebensatz aufgeklärt. Darüber hinaus lässt Band 2 selbst einige offene Fragen bzw. Schauplätze, auf die nicht mehr eingegangen wird, zurück. Irgendwie drängt sich mir der Eindruck auf, dass Stephen Baxter bei der Idee für "Flood" das Gefühl bekam, dass er Stoff für mehr als ein Buch vor sich hatte ... und dann während des Schreibens von Nummer 2 merkte, dass er doch nicht für drei reicht.
Trotz alledem ist "Die letzte Arche" überaus spannend zu lesen, von der grandiosen Kulisse ganz zu schweigen. Es ist bloß nicht hundertprozentig befriedigend. Ein sehr guter Roman ... aber das vor allem deshalb, weil er von einem Autor stammt, der große Routine darin hat hervorragende Romane zu schreiben.
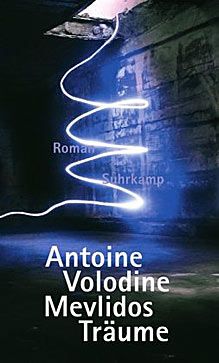
Antoine Volodine: "Mevlidos Träume"
Gebundene Ausgabe, 445 Seiten, € 27,70, Suhrkamp 2011.
Am Ende der Geschichte - um nicht zu sagen, am Ende von allem ... dort sind wir in "Mevlidos Träume" angelangt. Nach all den geplatzten Träumen von Revolutionen für die gerechte Sache, nach dem Schwarzen Krieg und Genoziden an kleinen Randvölkern wie den Spaniern oder den Chinesen, nach Veränderungen der Umweltbedingungen, die die Erde zu einem Albtraum in Grau und Schwarz gemacht haben, auf den ein riesenhafter Vollmond herabgrinst (solange er sich nicht nach Lust und Laune am Firmament versteckt). In einer Stadt, die Ulang-Utan heißt und von Straßen mit internationalisierten Namen durchzogen wird. Dort sind wir also. Formal. Tatsächlich sind wir nirgendwo und nirgendwann: Wir wussten nicht einmal mehr, zu welchem Erdzeitalter wir gehörten, wie es an einer Stelle heißt.
Einfach eine in sich geschlossene fiktive Welt zu konstruieren und diese - wenn überhaupt - der unseren als Spiegel vorzuhalten, ist nicht die Sache des französischen Autors, der sich unter anderem Antoine Volodine nennt. Dementsprechend lässt sich auch der Begriff "Science Fiction" nicht wirklich auf den Roman anwenden, der im Original 2007 als "Songes de Mevlido" erschien. Er greift zwar Elemente des Genres auf, zielt aber - mehr noch als das 2005 erschienene "Dondog", zu dem es einige Parallelen gibt - in eine abstraktere Richtung. Das Konkrete und das Allegorische verschmelzen miteinander - etwa wenn geschildert wird, wie die Hauptfigur Mevlido über eine Wiedergeburt in diese düstere Welt kam: Der Akt der Reinkarnation beginnt mit bürokratischen Formalitäten, wird zu einer eiligen Fahrt durch ein kriegsverheertes Land und gipfelt darin, dass Mevlido in ein Abwasserrohr kriecht, das am anderen Ende in eine Gebärmutter mündet. Das Motiv der Wiedergeburt mag an das Lebensrad des buddhistischen Samsara erinnern - doch statt eines Voranschreitens mit Hoffnung darauf, aus dem Zyklus des Sterbens und Wiedergeborenwerdens ausbrechen zu können, scheint es hier nur ein Auf-der-Stelle-Treten oder gar ein Zurückfallen zu geben. Was letztlich durchaus als Urteil über die Barbarei der Menschheit zu werten ist.
Auf der Gegenwartsebene lebt Mevlido, mittlerweile an die 50, als Polizist im Ghetto Hühnerhof Vier von Ulang-Utan. Seine Wohnung teilt er sich mit einer Frau, die so wie er den Partner verloren hat, das heruntergekommene Viertel mit anderen Menschen (respektive "Hominiden"), die sich ziellos dahintreiben lassen, erwachsen gewordenen Kindersoldaten und Alt-Bolschewistinnen, die bizarre Slogans wie "Überlebender, bereite Attentate gegen den Mond vor!" oder "Schlüpfe in einen Sack mit den Töchtern des Zufalls!" skandieren. Was aber bei weitem nicht die ungewöhnlichsten BewohnerInnen des Viertels sind; da gäbe es noch miteinander kommunizierende Spinnen (ja nicht mit denen sprechen, wurde Mevlido im pränatalen Briefing eingeschärft) und Schwärme von mutierten Vögeln, teilweise anthropomorph und fließend in Menschen übergehend.
Die Menschheit unterscheidet nicht mehr zwischen Leben, Tod und Träumen, wurde Mevlido erklärt - im seltsamen Limbus der Romanwelt gerinnt daher alles zu einer nebelhaften Halbexistenz. Alles, was es an Grenzen und Unterscheidungen geben könnte, wird von Volodine sukzessive verwischt. Real erscheinende Begebnisse werden nachträglich zum Traum erklärt, zugleich sind Träume der einzige Kontakt Mevlidos zu den Organen, die ihn einst in diese Welt schickten. Und so fragmentarisch und ineffektiv wie dieser Kontakt ist auch die Art, in der Mevlido seinem diffusen Auftrag - der Menschheit helfen ... und wenn es nur beim Sterben ist - nachgeht. Parameter wie "Weltrevolution" und "proletarische Moral" sollen Mevlidos Handeln bestimmen - doch zugleich ist die Revolution längst versandet und wird im Krakeelen des Altweiber-Bolschewismus sogar noch zum Witz.
Und wir sind nicht nur nirgendwo und nirgendwann, wir sind auch niemand. Volodine spiegelt Figuren und führt sie wieder zusammen - das mag einen an Hal Duncans "Vellum" erinnern (um innerhalb des Genres zu bleiben) oder auch (um etwas weiter auszuholen) an die Stationendramen August Strindbergs wie "Das Traumspiel" oder "Die große Landstraße"; zumindest wäre das meiner Schwedischlehrerin als erstes eingefallen. Wenn abwechselnd in dritter, erster und sogar zweiter Person erzählt wird, drängt sich auch bald die Frage auf, wer dieser Ich-Erzähler ist, der an einer Stelle behauptet, nur einen Meter von Mevlido entfernt zu sein. Einige Rezensenten geben sich der Vermutung hin, dass sich Volodine hier selbst ins Spiel bringt. Klingt durchaus plausibel - und schon wären wir bei Kurt Vonnegut und die Ähnlichkeit zwischen "Hühnerhof Vier" und "Schlachthof 5" ist vielleicht doch kein Zufall gewesen.
Auf jeden Fall nutzt Volodine den Roman, um noch einmal in expliziten Worten sein Manifest des "Post-Exotismus", unter dem er sein Schaffen gern subsumiert sähe, an den Mann und die Frau zu bringen. Ob diese Wortspende in einem Erzähltext wirklich nötig war, sei dahingestellt. Wer sich im Verlauf von "Mevlidos Träume" bereitwillig auf die Auflösung aller Gewissheiten eingelassen hat, braucht keinen Verweis auf ein ohnehin schwammiges Konstrukt als Rettungsboje. Und wer in einem Roman klare Verhältnisse bevorzugt, der geht mit ihr unter.

A. Lee Martinez: "Zu viele Flüche"
Broschiert, 390 Seiten, € 10,30, Piper 2011.
Nach der geballten Düsternis der vorangegangenen Bücher braucht's ein Gegengift, da kommt ein frischübersetzter Roman vom neuen Star der Funny Fantasy gerade recht. "Frischübersetzt", weil "Too Many Curses" aus dem Jahr 2008 stammt und damit älter ist als das bereits vor einem Jahr auf Deutsch erschienene "Monster". Und in der Zwischenzeit hat A. Lee Martinez schon zwei weitere Romane fertiggestellt - der Mann aus Texas ist ein produktiver Autor!
Wie so oft bei Martinez ist der Ausgangspunkt ein unmögliches Arbeitsverhältnis: Nessy, eine Koboldin mit hündischen bzw. füchsischen Merkmalen (siehe Coverbild) kümmert sich um das Schloss ihres Herrn, des Schwarzmagiers Margle. Der Text führt sie als Schlossverwalterin, der Klappentext als Putzfrau - einigen wir uns auf Facility-Managerin. Was unter anderem auch beinhaltet, Kübel voller Gehirne ins schlosseigene Bestiarium zu schleppen - doch damit nicht genug: Nessy muss auch mit der Gewissheit leben, dass ihr auf Arbeitnehmerrechte pfeifender Boss sie irgendwann einmal nur so aus einer Laune heraus umbringen wird. Was er auch tatsächlich tun will, ungeschickterweise aber beim Versuch scheitert und selbst zu Tode kommt. Womit sich eine gaggeladene Ereigniskette in Gang setzt, die stark an ein Boulevard-Stück im Theater - Typ "Pension Schöller" - erinnert. In der Tat werden wir den ganzen Roman hindurch das Schloss nicht mehr verlassen; Haupt- und Nebenfiguren flitzen von Kammer zu Kammer und produzieren dabei Situationskomik am laufenden Band. Auf den ersten Seiten vielleicht noch ein wenig stotternd, doch rasch findet man sich im bewährten Martinez-Groove wieder.
Nessy ist eine durch und durch ehrliche Haut, pragmatisch und sympathisch - ganz dem Role Model der pflichtbewussten jungen Frau entsprechend, wie es auch bei Terry Pratchett immer wieder gerne auftaucht. Allen voran natürlich die aufstrebende Hexe Tiffany Weh, zu der übrigens kürzlich erst ein neuer Roman auf Deutsch erschienen ist ("Das Mitternachtskleid" bei Manhattan-Goldmann). Nun ist Nessy aber - teils zu ihrem Glück, teils zu ihrem großen Leidwesen - nicht allein im Schloss: Schon eher präsentiert sich dieses als Sammelsurium von (Ex-)Personen, die irgendwann einmal Margles Zorn erregt haben und von ihm zu ihrem Nachteil verändert wurden; inklusive Margles Mutter und Bruder. Der Ritter Sir Thedeus, der sein Dasein jetzt als Flughund fristet, hat noch Glück gehabt - andere existieren nun als Echo, als Organsortiermaschine, als Gesicht, das in einem Einweckglas schwimmt, oder im Falle von Walter als blutige Schrift an der Wand (weshalb Nessy zu jeder Unterhaltung mit ihm einen feuchten Wischlappen mitbringen muss). Nicht zu vergessen Das Ding Das Verschlingt und Das Ding Das Nervt ... alles in allem ein untotes Muppet-Show-Ensemble, das Nessy schon vor genug Herausforderungen stellen würde ...
... wenn Margles Tod nicht alles noch viel schlimmer gemacht hätte. Da steht zum Beispiel plötzlich die Zauberin Tiama die Narbige vor der Tür und erhebt Anspruch auf Margles Nachlass - und es steht zu befürchten, dass sie eine noch schröcklichere Arbeitgeberin wäre. Eine rachedurstige Dämonin, die Margle lange Zeit gefangen hielt, bricht aus - und auch wenn ihr erster Schritt in die Freiheit zu einem peinlichen Desaster gerät, wird weiter mit ihr zu rechnen sein. Ein Höllenhund tappt durchs Schloss und droht Nessys untote Freunde der Reihe nach aufzufressen ... mal ganz davon abgesehen, dass die Abdrücke seiner glühenden Klauen nie mehr ganz vom Boden wegzukriegen sind. Die geheimnisvolle Tür Am Ende Des Flurs spottet ihrem Namen und beginnt ebenso herumzuwandern wie die leeren Rüstungen aus Margles Waffenkammer - ja, das Schloss selbst regt sich allmählich, endlich von seinem Herrn befreit. Und irgendwo muss auch noch der Rache-Mechanismus lauern, den Margle für den Fall seines Ablebens todsicher irgendwo installiert hat. Doch hinter welchem der zahllosen Ärgernisse verbirgt er sich? Man könnte verzweifeln, doch Nessy bleibt ihrem Motto treu: Eine Aufgabe nach der anderen.
Wo es sich gerade anbietet, zieht Martinez einige Klassiker der Phantastik - von Lewis Carroll über Edgar Allan Poe bis zur Artus-Legende - durch den Kakao. Teilweise ergibt sich die Komik dabei aus den Dada-Gesprächen, die die einzelnen Figuren miteinander führen. Etwa wenn der Schädel des Demontierten Dan und die herumwandernde Tür miteinander Geheimnisse austauschen ("Knarz knarz quietsch?"). Doch meistens liegt sie weniger in dem, was sie zueinander sagen, sondern wer es ist, der da so völlig alltägliche Unterhaltungen führt. Seien es eingetopfte Blumen, Leichen im Badewasser, beleidigte Nacktschnecken - oder das einstige Schwert im Stein, nach einigen Ortswechseln nun zum Schwert im Kohl herabgesunken. Es lobt Nessy zwar für ihren lauteren Charakter im Allgemeinen, herausziehen lässt es sich von ihr dennoch nicht: "Sei bitte nicht beleidigt. Ich muss sehr hohe Maßstäbe anlegen." Gehen wir ruhig davon aus, dass Nessy auch diesen Schlag wegstecken und der harmlose Spaß von "Zu viele Flüche" zu einem versöhnlichen Ende finden wird.
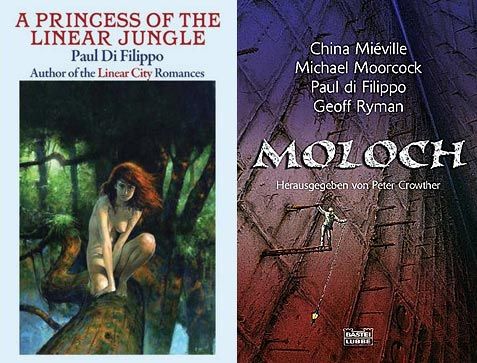
Paul di Filippo: "A Princess of the Linear Jungle"
Gebundene Ausgabe, 91 Seiten, PS Publishing 2010.
Der mit einer Gabe für schräge und sehr schräge Einfälle gesegnete US-Amerikaner Paul di Filippo ist seit den 90ern literarisch aktiv und hat sich seitdem als ausgesprochen produktiver Autor erwiesen. Dennoch ist bislang kaum etwas von ihm auf Deutsch erschienen. Zu den wenigen Ausnahmen zählt seine Novelle "A Year in the Linear City", die 2005 in der Bastei-Anthologie "Moloch" enthalten war (darum zur Ergänzung das Bild rechts). Kann also gut sein, dass der eine oder die andere sich noch an einen Schauplatz der ungewöhnlicheren Art erinnern wird: eine Stadt, die sich - beinahe jedenfalls - in nur einer Dimension erstreckt.
"Beinahe" heißt: Links und rechts einer Broadway genannten endlosen Straße ist Platz für jeweils einen einzigen Häuserblock, dahinter liegen auf der einen Seite ein Fluss, dessen jenseitiges Ufer nicht erreichbar ist, auf der anderen Seite die Schienen der - gleichermaßen endlosen - städtischen Eisenbahn und hinter diesen ein nicht betretbares glosendes Ödland. Nicht von ungefähr weckt Letzteres Assoziationen an die Hölle, denn am Himmel kreisen nicht nur eine Jahreszeiten- und eine Tagsonne, dort schweben auch Pompatics genannte Entitäten, die Sterbende augenblicklich aufsammeln und entweder zu The Other Shore oder auf die Wrong Side of the Tracks tragen. "Corpses? What's that?" fragt daher die Protagonistin von "A Princess of the Linear Jungle" einen Möchtegern-Anatomen; der "natürliche" Tod in der Linearen Stadt kennt so etwas wie sterbliche Überreste nicht.
Und dieses Paradebeispiel in Sachen Worldbuilding erstreckt sich über eine niemandem bekannte Distanz: Jeweils 100 Häuserblocks bilden eine Gemeinde bzw. ein Borough. Hunderttausende oder vielleicht Millionen von ihnen und ebenso viele menschliche Kulturen reihen sich - jeweils eingeklemmt zwischen Fluss und Schienen - aneinander. Niemand erinnert sich daran, wer die Stadt gebaut hat, doch wird vermutet, dass sie ganz wie das Universum selbst unbegrenzt, aber endlich ist. Ob sie auf einer kreisförmigen Struktur, einem Möbiusband oder etwas noch Komplizierterem liegt, weiß keiner. Als Stadtgottheit wird jedenfalls ein Ouroboros verehrt, also eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Und um das Maß voll zu machen, handelt es sich dabei um keinen bloßen Mythos - wer in die Kanalisation hinuntersteigt, stößt bald auf den Körper der Schlange (und kann sich verbotenermaßen ein paar Schuppen abbrechen, die als Glücksbringer begehrt sind). Gag am Rande: Ganz wie bei Terry Pratchetts Sternenschildkröte Groß-A'Tuin tobt auch hier ein akademischer Streit darüber, ob die Schlange männlich oder weiblich ist.
Mit dem Stichwort "akademisch" sind wir auch schon mitten in der Handlung von "A Princess of the Linear Jungle". Per Flussdampfer reist die junge Merrit Abraham aus ihrer Heimat ins Universitäts-Borough Wharton, um "Polypolisologie", die Wissenschaft der Linearen Stadt, zu studieren. Geld hat sie keines und muss daher in der Nikolai Milyutin Pinakothek & Wunderkammer jobben, doch bald angelt sie sich den ebenso populären wie selbstverliebten Professor Arturo Scoria, der eine Expedition nach Vayavirunga vorbereitet: einen Dschungel, der drei Boroughs überwuchert hat und wider alle Erwartungen - ein unscharfes Foto scheint es zu beweisen - doch noch von Menschen bewohnt sein dürfte. Das Rätsel der Stadt an sich wird zwar auch in dieser Novelle nicht gelüftet (Wo werden eigentlich all die Rohstoffe gewonnen, die täglich per Eisenbahn angeliefert werden? Das fragen sich nicht nur die StadtbewohnerInnen). Doch stößt die von der Revolverpresse begleitete Expedition auf allerlei Versatzstücke aus der Pulp-Kultur, von einer (natürlich ebenso schönen wie nackten) Dschungelprinzessin bis zu gar seltsamen halbmenschlichen Wesen. Expedition und Novelle enden mit einer Antiklimax, die der ganzen Erzählung einen fragmentarischen Charakter verleiht, aber irgendwie auch eine nette Pointe ergibt.
Der eigentliche Reiz liegt aber ohnehin unter der Handlung. Die Pulp-Verweise werden noch einmal extra unterstrichen, indem der Erzählung ein Auszug aus Edgar Rice Burroughs' "A Princess of Mars" vorangestellt ist. Zudem zitiert Merritt gerne Passagen aus den reißerischen SF-Geschichten eines gewissen Diego Patchen ... der wiederum war die Hauptfigur in di Filippos älterer Novelle "A Year in the Linear City": Ein kosmogonischer Autor, der ständig für die Anerkennung seines Genres gegenüber der Mainstream-Literatur kämpft und in seinen Geschichten so "exotische" Phänomene wie das Telefon, den Mond, einen Tod ohne metaphysische Entfernung der Leichen oder eine Tierwelt mit mehr als vier Spezies erfindet. Die metafiktionalen Aspekte von "A Year in the Linear City" setzen sich in "Princess" fort - und wenn Merritt plötzlich ein Abenteuer, wie es ihr Lieblingsschundautor erfunden haben könnte, selbst erlebt, beißt sich die Katze (bzw. Schlange) genauso in den Schwanz, wie es das gigantische Ding unter den Fundamenten der Linearen Stadt auch tut.
Vor allem anderen bietet Paul di Flippo aber ein sprachliches Erlebnis - nämlich dann, wenn wir die Welt durch Merrits Augen sehen. Etwa wenn sie nach einem flotten Dreier in Löffelchen-Stellung zwischen zwei Körpern aufwacht: The other carnal bookend could be claimed by a middle-aged, balding fellow whose potbelly failed to diminish a penis easily twice as large, even flaccid, as any it had previously been Merritt's privilege to inspect up close. Der wohlsituierte Stil tut das seinige, "Princess" eine Anmutung von 19. Jahrhundert zu geben, doch ist di Filippos Wortschatz nicht notwendigerweise altmodisch, er ist einfach groß. Wer bei einer seiner längeren Erzählungen kein einziges Mal zum Wörterbuch greift, vor dem ziehe ich den Hut und wälze mich im Staub (und dieses Angebot gilt nicht nur für deutschsprachige LeserInnen, sondern auch für Native Speakers). Di Filippos Mischung aus Sprachverliebtheit und augenzwinkernder Erzählweise kann allerdings - je nach Dosis - auch frustrieren: Ein Buch, in dem der Gonzo-Humor des Autors besonders bizarre Blüten trieb, habe ich mal entnervt an die Wand gepfeffert und bin dann noch ein paar Mal darauf herumgehüpft. Doch keine Angst, "Princess" gibt sich da gnädiger. Ist man an der Einstiegshürde der beiden Monstersätze, die die erste Seite im Alleingang bestreiten, erst mal vorbei, kann man wohlig in eine Erzählung eintauchen, deren sprachliche Üppigkeit die streckenweise wüste Handlung adelt. Und auch über einige lästige Satzfehler hinwegtröstet.
P.S.: "Moloch" ist zwar vergriffen, aber noch recht einfach nachzukaufen. Und es lohnt sich: Außer di Filippos "Ein Jahr in der linearen Stadt" bietet die Anthologie drei weitere Attraktionen. Geoff Ryman zeigt in seiner Satire "S.A.S." ("VAO"), was passiert, wenn die Computerhacker unserer Tage dereinst im Altersheim landen, und Phantastik-Urgestein Michael Moorcock reaktiviert in "Firing the Cathedral" noch einmal seinen alten "Helden" Jerry Cornelius; psychedelisch wie gewohnt. Das eigentliche Highlight aber ist die gruselige Erzählung "Spiegelhaut" ("The Tain") von China Miéville. Sein Protagonist kämpft sich durch ein postapokalyptisches London, das zum Ziel einer Invasion durch Wesen von der anderen Seite des Spiegels wurde - ein altes Motiv der Phantastik, aber genial umgesetzt. Eine Empfehlung zum antiquarischen Stöbern!
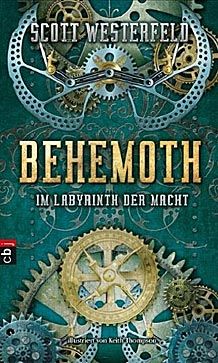
Scott Westerfeld: "Behemoth. Im Labyrinth der Macht"
Gebundene Ausgabe, 507 Seiten, € 18,50, cbj 2011.
Seit dem Vorgängerband "Leviathan" (hier die Nachlese) ist in Scott Westerfelds alternativer Steampunk-Vergangenheit der Erste Weltkrieg voll ausgebrochen. Zwar wird er zwischen denselben Machtblöcken ausgetragen wie in unserer Welt, doch tragen sie hier - entsprechend der jeweils verwendeten Technologie - die Namen Mechanisten und Darwinisten; man könnte es auch einen Clash zwischen den beiden Subgenres Dieselpunk und Biopunk nennen. Die Mechanisten (Deutschland und Österreich-Ungarn) werfen das in die Schlacht, was in einer Rezension recht treffend beschrieben wurde als "das, was die Familie Krupp erfunden hätte, wären ihnen die Transformers bekannt gewesen". Die Darwinisten hingegen (England, Frankreich und Russland) setzen auf genetisch veränderte Tiere. Damit bleiben wir immer noch in den Gefilden jener Wesen, die in Japan Kaijū, also in etwa "Monster", heißen. Bloß geht es hier vor allem bei den größeren Exemplaren wie dem fliegenden Leviathan eher in die Richtung der abgedrehten Anime-Reihe und Spielzeuglinie "Beast Wars", die uns Wahnsinnigkeiten wie den Waspinator oder das Ultrawildschwein Razorbeast beschert hat.
Das Osmanische Reich, Schauplatz des im Original 2010 erschienenen Romans "Behemoth", gehört der Form nach zu den Mechanisten, nimmt aber eine Art Mittelstellung ein, was sich auch im bevorzugten Design ausdrückt. In japanischen Kategorien wären dies Mecha, also Maschinen, die die Form von Lebewesen nachahmen. Als der Leviathan der britischen Luftmarine in Istanbul vor Anker geht, stapft ihm ein 50 Fuß hoher mechanischer Elefant als Gangway entgegen; behängt überdies mit opulenten Zierteppichen. Das ist einerseits ein hübscher Verweis auf den Stahlelefanten in Jules Vernes "Das Dampfhaus", zugleich aber nur ein Vorgeschmack auf die speziell osmanische Verknüpfung von Prunk und Mechanik - allenthalben hängt ein Geruch nach Kohle, Motoröl und Weihrauch über der Stadt. Und wir müssen uns das alles nicht nur vorstellen, wir können es auch sehen: Wie schon "Leviathan" enthält auch "Behemoth" zahlreiche Illustrationen aus der Feder von Keith Thompson. Und die sind nicht nur nachträglich zum Text angefertigt worden - in einem Interview erklärte Westerfeld, dass er beim Schreiben in ständigem Austausch mit Thompson stand und sich manchmal von dessen Arbeit dahingehend beeinflussen ließ, besonders gut illustrierbare Passagen auszubauen.
Wie gesagt, der Erste Weltkrieg hat begonnen, und das bringt für die Hauptfiguren des Romans einige Einschnitte. Alek, der (noch) illegitime Sohn des ermordeten K.u.K.-Thronerben, sollte im Auftrag des Deutschen Kaiserreichs ermordet werden und hat sich ausgerechnet an Bord des Leviathan geflüchtet. Dort ist er zwar vor seinen Verfolgern sicher, muss aber zu Recht befürchten, dass ihm ein Schicksal in britischer Kriegsgefangenschaft bevorsteht. Also setzt er sich nach der Landung von Bord ab. Die Umstände zwingen ihn dazu, ein Tierchen mitzunehmen, das aus einem der drei Eier geschlüpft ist, die Charles Darwins Enkelin Nora Barlow - nicht nur wegen ihrer Abstammung eine ehrfurchtgebietende Gestalt - nach Istanbul mitgebracht hat; was ja der eigentliche Zweck der Leviathan-Mission war. Auf den ersten Blick wirkt dieses Tierchen wie ein Verwandter von Ahörnchen und Behörnchen; erst später zeigt sich langsam, was wirklich in ihm steckt.
Und dann ist da noch die junge Schottin Deryn, die sich als Bursch maskiert als Fliegerkadett an Bord des Leviathan eingeschmuggelt hat. Nachdem die Leviathan-Reihe unter "Young Adult" läuft, fokussieren die Romane stark auf die beiden jugendlichen ProtagonistInnen. Zum einen, wie sie sich parallel zueinander bei waghalsigen Kletterpartien, Spionage- und Sabotageaktionen bewähren und zumindest sich selbst beweisen, dass sie trotz ihrer jeweiligen "Mankos" - er ein gut behüteter Adelsspross, sie eben eine Sie - etwas taugen. Und sehr stark geht es auch um Vertrauen unter erschwerten Bedingungen: Nicht nur, dass sie formal auf entgegengesetzten Seiten stehen, sie müssen auch ihre jeweiligen persönlichen Geheimnisse voreinander verbergen. Auch wenn sie inzwischen Freunde sind und zumindest nach Deryns Wunsch gerne auch mehr ... was gleich die nächste Problemserie mit sich bringt.
Istanbul schildert Westerfeld, der einmal mehr anderen AutorInnen ein Recherchevorbild sein könnte, als brodelnden Hot Spot in Sachen Spionage und Gegenspionage - vergnügt kommentiert von einem US-amerikanischen Reporter, hinter dem sich vermutlich der Autor selbst verbirgt. Zudem steht die Stadt am Vorabend eines Umsturzes: Nachdem die Revolte der Jungtürken in dieser Welt gescheitert ist, modelliert Westerfeld eine Revolution, die ihm nach eigenen Worten viel sympathischer ist: multikulturell und geschlechtlich gleichberechtigt. Generell ist der Ton der Romane ja recht menschlich (siehe Young Adult). Außer vielleicht, wenn ein Schiff voller deutscher Matrosen zum Absaufen gebracht wird ... da hält sich die Empathie dann doch in Grenzen. Auch in Band 2 bleiben die omnipräsenten Deutschen wieder komplett gesichtslos. Vielleicht eine Art historisch vorauseilende Nazi-Dämonisierung - was aber schon der einzige Kritikpunkt an Westerfelds Reihe wäre.
Nicht oft genug kann man indessen auf das grandiose Ambiente hinweisen: Sei es ein drachenköpfiger Orient-Express oder ein Schlachtschiff, das mit einer Blitze werfenden "Tesla-Kanone" ausgestattet ist, sei es die Idee, dass die Dardanellen mit verminten Netzen abgesperrt sind, um Angriffe von Riesenkraken abzuwehren. Nicht zu vergessen ein Steampunk-Traum von Bibliothek, komplett mit Lochkarten-Katalog, Rohrpostkanälen und mechanischen Läufern, die Bücherstapel durch die Marmorsäle tragen. Ein wenig schade ist, dass der titelgebende Behemoth nur zu einem Kurzauftritt kommt. Nachdem der biblische Meeresriese Leviathan in die Luft und das Landungetüm Behemoth ins Wasser gewechselt ist, müsste Band 3 der Logik nach eigentlich "Beherie" heißen und ein über Land stapfendes Monster präsentieren. Englischsprachige LeserInnen können schon ab Herbst sehen, was da auf unsere HeldInnen zukommt; der Buchtitel allerdings wird "Goliath" sein.
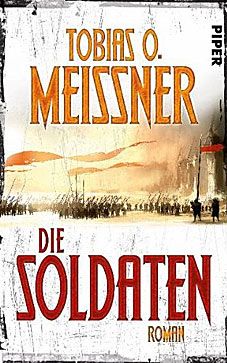
Tobias O. Meißner: "Die Soldaten"
Broschiert, 499 Seiten, € 17,50, Piper 2011.
Gibt's nun so etwas wie "Military Fantasy" (als Pendant zu Military SF) oder nicht? Da gehen die Meinungen auseinander - aber falls nicht, könnte man den Begriff für Tobias O. Meißners jüngsten Roman einführen. Der in Berlin ansässige Fantasy-Star experimentiert bekanntlich gerne ein wenig mit Genre-Gepflogenheiten. Nicht immer geht die Rechnung auf, aber es kommt doch eine Menge Interessantes dabei rum - so auch in diesem Fall. "Die Soldaten" scheint in Summe fast eher für SF-LeserInnen, die das hochtechnologische Szenario mal gegen ein eisenzeitliches tauschen wollen, gedacht als für das Hardcore-Fantasypublikum. Kurz aufgezählt, was es alles nicht gibt: Eine alte Prophezeiung, einen vom Schicksal erwählten Protagonisten, eine Queste rund um einen magischen Gegenstand, eine eindeutige Unterscheidung von Gut und Böse, eine Liebesgeschichte oder überhaupt einen vorausberechenbaren Handlungsverlauf.
Dass das Buch bislang trotzdem sehr gut von den LeserInnen aufgenommen wurde, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass es in derselben Welt angesiedelt ist wie Meißners großer Zyklus "Im Zeichen des Mammuts". Dankenswerterweise lässt es sich aber komplett unabhängig davon lesen. "Die Soldaten" spielt einige Zeit, nachdem das fast einen ganzen Kontinent umfassende Reich der Menschen einen Feldzug gegen die im Nordosten lebenden Affenmenschen unternahm; ein desaströser Fehlschlag. In einer Talsenke des Gebirges, welches das Reich von der Felswüste der Affenmenschen trennt, liegt wie ein Kork im Flaschenhals die Festung Carlyr. Und dorthin wird Leutnant Eremith Fenna - mit 32 fast schon ein Veteran - abkommandiert, um eine neue Kompanie aufzubauen, da die Festung infolge des Feldzugs unterbesetzt ist.
Fenna ist eine spannende Figur: Schwer traumatisiert davon, dass seine Heimatstadt durch eine Naturkatastrophe (wiederum kein Fantasy-Stereotyp) entvölkert wurde, verfolgen ihn die Bilder von Scheiterhaufen mit Kinderleichen in seinen Träumen. Möglich, dass seine persönliche Geschichte sein Weltbild verzerrt, doch gibt es einige handfeste Anzeichen dafür, dass das Reich tatsächlich einem schleichenden Niedergang entgegentaumelt. Mit Galgenhumor wälzt Fenna auf dem beschwerlichen Weg zur Festung die Idee, unter dem Bauch seines Pferds hängend zu reiten, um ein bisschen Schatten zu haben - damit wird etwas eingeführt, das sich wie ein roter Faden durch den ganzen Roman ziehen wird: ein ständiger Widerstreit zwischen kritischer Vernunft und Pflichtgefühl. Da werden Fenna und die ihm zur Seite gestellte Akademie-Absolventin Loa Gyffs über Sinn und Unsinn von Befehlen streiten, der Festungskommandant auf die Unfähigkeit akademischer Strategen schimpfen und höchst defätistische Theorien darüber entwickelt, was der eigentliche Sinn des damaligen Feldzugs gewesen sei. Und die Heilerin Ilintu meint einmal ganz 68er-mäßig: "Soldaten sind Narren! Sie lassen sich missbrauchen und töten im Namen irgendeiner Sache, irgendeines Landes oder Interesses." Von einem niemals hinterfragten, ehernen Bund zwischen dem gerechten Herrscher und seinen SoldatInnen ist hier nicht viel zu merken.
Von der Struktur her spaltet sich der Roman in zwei extrem unterschiedliche Teile. Im ersten geht es um den Aufbau der Kompanie: Da wird aus einem bunten Haufen - vom gutmütigen Fettsack über einen Vater zweier im Feldzug gefallener Soldaten und einen rücksichtslosen Ehrgeizling bis zu allerhand unsoldatischen Schwachmaten - eine echte Einheit geschmiedet. So sehr, dass Fenna allmählich Vatergefühle für seine Rekruten entwickelt und diese "Kinder" die aus seinen Träumen verdrängen. Ein David Weber hätte seine Freude an diesen Kapiteln: Meißner beschreibt Übungen und Manöver und vergisst auch auf die Infrastruktur bis hin zur festungseigenen Schneiderin nicht - all das glücklicherweise aber bei weitem nicht so ausgewalzt wie bei Weber. Der Ton ist unbeschwert, überhaupt erscheint die Festung anfangs wie eine Art "Big Brother"-Gelände. Die Rekruten - die laut Kommandant ja "bespaßt" werden wollen - treten bei einem Hindernisparcours inklusive Punktevergabe an, was sich später beim klassischen Manöver "Die Flagge erobern" wiederholt. Die Sprache ist modern und hat einen Hauch von Sportberichterstattung, wie es in einigen Momenten von Meißners früherem Roman "Die Dämonen" auch schon der Fall war.
Dann folgt ein staunenmachender Wechsel im Ton, und zwar in eine sehr viel düsterere Richtung ... sehr gut passend zum Inhalt. Denn war das Soldatensein bislang eher ein Spiel, wird schlagartig Ernst daraus, als die frischgebackene Kompanie in ihre ersten Einsätze im Affenmenschengebiet geschickt wird und die ersten Verluste zu beklagen hat. Wenn Fennas Männer durch ein schwefelgelbes Land voller Gefahren ziehen, wirkt dies wie eine Expedition auf einem fremden Planeten; ihren ersten wirklichen Kampf führen sie bezeichnenderweise gegen Tiere. Dieser Kampf endet in völligem Chaos und verstärkt die Auflösungserscheinungen, die sich zuvor bereits angedeutet hatten bzw. zwischen den Hauptfiguren diskutiert worden waren. "Wir führen Krieg gegen ein Märchen", denkt Fenna einmal, denn den eigentlichen - oder angeblichen - Gegner haben sie immer noch nicht gesehen. So löst sich langsam jede Gewissheit auf - bis hin zu der, welche Seite die "richtige" ist. Das, zusammen mit ein paar dramaturgisch wirklich ungewöhnlichen Entscheidungen in den Schlusskapiteln, macht "Die Soldaten" zu einem außergewöhnlichen Fantasy-Roman. Könnte sich wieder ein wenig verschleifen, falls der Roman nur der Auftakt zu einem Mehrteiler sein sollte - besser wäre es aber, wenn Meißner es kompromisslos bei diesem Buch beließe.

Jonathan Strahan (Hrsg.): "Engineering Infinity"
Broschiert, 400 Seiten, Solaris 2010.
Das hab ich jetzt davon, mich öffentlich darüber zu freuen, Hannu Rajaniemis "Quantum" (hier die Nachlese) sicherheitshalber auf Deutsch gelesen zu haben. Einen Monat später klopft er mit der Kurzgeschichte "The Server and the Dragon" schon wieder an die Tür und haut mir - diesmal auf Englisch - außer Dyson-Statiten und Casimir-Vakuum auch noch holeships, darkships und was nicht gar um die Ohren. Erstaunlich, dass dabei etwas so Poetisches herauskommen kann. Die Erzählung dreht sich um einen künstlichen "Server", der im Auftrag des galaktischen Netzwerks ein abgelegenes Sonnensystem in einen Smartdust-Komplex umbaut. Daten strukturieren die physische Welt, riesige Räume und Zeitspannen werden überbrückt ... und so ganz nebenbei wird auch noch ein Baby-Universum erschaffen. Die Geschichte berührt, ohne dass organisches Leben oder etwas auch nur entfernt Menschenähnliches darin vorkäme.
An dieser Stelle ein Gruß an User/in Freya Nakamachi-47! Falls Sie sich jemals gefragt haben, was aus Ihrer Namensvetterin nach den Geschehnissen von "Kinder des Saturn" geworden ist, hier die Antwort: Eine schreckschraubige Matriarchin einer Roboter-Stammlinie, die ihre Töchter mit den Worten "Now fuck off and have adventures and don't forget to write" in die Galaxis hinausschickt. So zu lesen in Charles Stross' Erzählung "Bit Rot", die sich allerdings um Freyas Nachfahrin Lilith auf deren Jahrhunderte währender interstellarer Reise dreht. Ein Strahlenunfall, der die Roboter zu ersatzteilhungrigen Zombies degenerieren lässt, verpasst der Geschichte einen guten Mix aus schwarzem Humor und Tragik. - Sowohl der Beitrag von Rajaniemi als auch der von Stross zählen - vom Autorennamen wie auch von der Qualität her - zu den Highlights der Anthologie "Engineering Infinity", mit der der rührige Australier Jonathan Strahan seinen Ruf als Herausgeber mit exzellentem Geschmack einmal mehr unterstreicht. Würden seine Anthologien nicht so viel Freude bereiten, müsste ich sie inzwischen gar nicht mehr lesen, um sie empfehlen zu können. 14 brandneue Geschichten von großteils sehr bekannten AutorInnen sind enthalten, der intendierte Schwerpunkt lautet Hard SF, also die Betonung von scientific detail or technical detail, and where the story itself turns on a point of scientific accuracy from the fields of physics, chemistry, biology, or astronomy, wie es im Vorwort heißt.
Dass Hard-SF-Veteran Stephen Baxter sämtliche Parameter erfüllt, dürfte niemanden überraschen. In "The Invasion of Venus" besucht ein Ministerialbeamter eine alte Freundin im ländlichen Essex, während ein künstlicher Komet ins Sonnensystem vordringt. Das Geschehen nur weitab vom Zentrum mitverfolgen zu können spiegelt die Rahmenhandlung wider - denn es ist nicht die Erde, auf die sich der Eindringling stürzt. Dass die beiden Supermächte, die einander hier bekriegen, der Menschheit gegenüber vollkommen gleichgültig bleiben, könnte die Geschichte sehr ernüchternd wirken lassen - erstaunlicherweise leitet Baxter aber eine optimistische Botschaft daraus ab. Zugleich korrespondiert die Erzählung sehr gut mit "A Soldier of the City" vom ungleich weniger bekannten Autor David Moles. Hier sind wir mittendrin im Krieg, der Schauplatz heißt "Babylon": Ein Schwarm von Städten, die um ein Schwarzes Loch kreisen und so gigantisch sind, dass eine mit 50 Milliarden EinwohnerInnen als "sparsely populated" gilt. Die Hauptfigur, der Tempelkrieger Ish, ist nur ein winziges Rädchen im Getriebe, welches Überwesen mit den Namen mesopotamischer Gottheiten steuern. Diese Verbindung von Mythologie mit härtester Hard SF illustriert auf schönste Weise, was Strahan als Sense of Wonder bezeichnet. Weniger überzeugend fällt diese Mixtur in "Judgement Eve" von John C. Wright aus: Hier wartet eine in nanotechnologischer Dekadenz schwelgende Gesellschaft auf die Apokalypse. Außer einem Galactic Will als Gottheit tummeln sich Versatzstücke aus biblischer und altgriechischer Mythologie in der fantasyhaften Handlung, und sprachlich "nutzt" der Autor das Ganze für pseudoaltertümelndes Pathos: "I will do no more shameful things, no matter at whose behest; but shall henceforth do only that in which I can take most pride." Uff. Wenigstens reißt der Twist am Schluss das Ganze noch ein bisschen raus.
Derlei Kitsch liegt einem Peter Watts gänzlich fern. Strahan weist im Vorwort noch einmal extra darauf hin, dass es sich beim Schöpfer der "Rifters"-Trilogie (hier die Nachlese) um keinen leichtverdaulichen Autor handelt. "Malak" dreht sich um die robotische Drohne Azrael, die im Nahen Osten Search-and-Destroy-Einsätze fliegt. Als Azraels Programmierung mit Fuzzy Logic aufgewertet wird, gerät er durch seinen neuen Entscheidungsspielraum in einen wachsenden inneren Konflikt. Anders als Rajaniemis Roboter-Geschichte ist diese hier Watts-typisch kalt. Kinder etwa sieht die Drohne so: Of thirty-four biothermals currently visible, seven are less than 120 cm along their longitudinal axes; vulnerable neutrals by definition. Fragt sich nur, wer unmenschlicher ist: Azrael oder seine Programmierer, die seine Tötungshemmung per Override-Funktion ausschalten. - Eine Hauptfigur in "The Birds and the Bees and the Gasoline Trees" von John Barnes ist ebenfalls ein künstliches Wesen - aber menschlich genug, dass es sogar schon einen Ehemann hatte. In der Geschichte wächst ein rätselhaftes Geflecht von gigantischen Dimensionen im antarktischen Ozean heran - Hard SF kommt hier vor allem in Form einer sehr originellen Variante von ozeanischer Eisendüngung ins Spiel.
Um jetzt aber nicht länger rhabarberrhabarbermäßig auf dem Wort herumzureiten: Hard SF war zwar die Ausgangsidee der Anthologie, doch räumt Strahan bereits im Vorwort ein, dass sich dies nicht hundertprozentig durchziehen ließ (steht ja auch ehrlichkeitshalber kein entsprechender Subtitel am Cover). So fokussieren einige AutorInnen stärker auf die menschlichen Aspekte. Kathleen Ann Goonan etwa evakuiert in "Creatures with Wings" einen Zen-Mönch mit Alien-Hilfe von der zerstörten Erde, was schließlich zu einer spirituellen Reise gerät. Altstar Gregory Benford, Autor des großen Romans "Zeitschaft", versucht sich einmal mehr am Thema Zeitkorrektur: In "Mercies" tötet ein selbsternannter Richter Dexter-mäßig angehende Serienkiller, findet aber selbst zunehmend Gefallen an Zeitaltern when men roamed wild and did vile things. Zugegeben, wirklich neu ist eine solche Ambivalenz nicht. Spannender ist da schon der seelische Zwiespalt, in dem sich der Vater einer von (technisch nicht näher erläuterten) Musik-Implantaten bzw. "Apps" abhängigen Tochter in "Watching the Music Dance" von Star-Autorin Kristine Kathryn Rusch befindet. Er verurteilt zwar den Wahn seiner Frau, das Mädchen künstlich verbessern zu wollen, in Sachen Präimplantationsdiagnostik und genetischer Korrekturen reißt's ihm jedoch durchaus Gedanken wie diesen raus: Not to know what kind of child you had - intelligence- and abilities-wise - for YEARS, after you'd invested time and energy and affection, in someone (someTHING) not quite optimal.
Einfach nur schön ist "Mantis" vom hierzulande noch unbekannten Robert Reed. Zwei KundInnen eines Fitness-Studios, in dem sogenannte Infinity Windows installiert wurden, beginnen an der Realität zu zweifeln. Denn diese Fenster öffnen zwar den Ausblick auf beliebige Szenen draußen in der Welt, doch werden die Bilder von Künstlichen Intelligenzen redigiert. Vielleicht ist ja nichts echt und sie sind selbst nur Teile einer Simulation, mutmaßen der Ich-Erzähler und seine Gesprächspartnerin - was viel raffinierter erzählt wird, als es in der Kurzbeschreibung klingt. Probleme mit der Virtualität hat zu guter Letzt auch ein alter Bekannter, den uns Karl Schroeder bereits in "Metatropolis" vorgestellt hat. In "Laika's Ghost" muss sich IAEO-Inspektor Gennady Malianov um den jungen Amerikaner Ambrose kümmern, der Googles Mars-Rover steuerte, dabei etwas Unerwartetes sichtete und nun sowohl vom Internet-Konzern als auch von US-Geheimdiensten und der Virtuellen Sowjetunion verfolgt wird. In der Einöde von Kasachstan werfen die beiden Protagonisten einen melancholischen Rückblick auf den Niedergang der echten UdSSR und ihres Weltraumpionierzeitalters. Doch wie sich zeigt, lebt "Laikas Geist" noch immer; und mit ihm - jetzt kommt's doch noch einmal - auch die Hard SF.
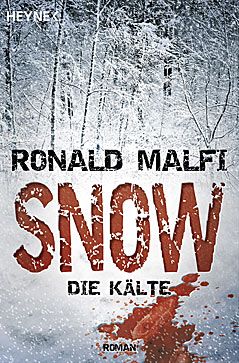
Ronald Malfi: "Snow"
Broschiert, 383 Seiten, € 9,30, Heyne 2011.
Als jemand, dem es im Traum nicht einfiele, brütende Sommerhitze mit den Worten "Hach, es ist so schön draußen!" zu beschreiben, habe ich mich begierig auf dieses Szenario gestürzt: Weihnachtlicher Kälteeinbruch in den USA, der Mittlere Westen versinkt im Schnee. Paradiesisch! Todd Curry ist da allerdings anderer Meinung. Der geschiedene Anwalt wurde am Chicagoer Flughafen O'Hare eingeschneit und verfällt auf die nicht ganz so vernünftige Idee, sich mit einem Mietwagen zu seiner Ex-Familie durchzuschlagen. Schafft er es nicht, hat er einmal mehr ein Versprechen gegenüber seinem Sohn gebrochen, und das gilt es um jeden Preis zu verhindern: Eines von vielen Standard-Handlungselementen, die der routinierte US-Autor Ronald Malfi in seinem jüngsten Thriller aufbietet. Malfi hat bereits eine ganze Reihe Romane an der Schnittstelle zur Mainstream-Literatur veröffentlicht (auf Deutsch ist bislang nur "Tod in Neverland"/"The Fall of Never" bei Otherworld erschienen). "Snow" hingegen - so auch der Originaltitel des 2010 erstveröffentlichten Romans - ist Genre-Literatur im engeren Sinne, soll heißen: Es werden vertraute Muster mit gerade so viel Neuem kombiniert, dass unter dem Strich gut abgesicherte Spannungslektüre herauskommt.
Mit auf die große Autofahrt durch das wabernde Weiß geht neben einem netten älteren Ehepaar vor allem Kate Jansen, ein selbstbewusste und für Todds Geschmack einen Tick zu direkte junge Frau. Vielleicht nicht ganz so glücklich verlobt, wie sie anfangs angibt ... das Potenzial für eine Liebesgeschichte zwischen zwei Survivalists ist zumindest da, Element 2. - Die Fahrt nimmt ein jähes Ende, als sie beinahe einen Wanderer überfahren, der vor ihr Auto läuft und sich in der Folge äußerst merkwürdig benimmt. Zu Fuß stapft die Reisegesellschaft weiter und gelangt bald darauf ins Kaff Woodson im Bundesstaat Iowa. Und hier schließt sich ein Kreis, der im Prolog des Romans geöffnet wurde: Denn die ersten Seiten gehörten einer Suspense-Passage, in der eine gewisse Shawna Dupree sich mit einem Gewehr in einem verwüsteten Laden verschanzt hat, der von den anderen belagert wird. Ort des Geschehens war bzw. ist, wie wir nun erfahren, natürlich Woodson. Auch das ist ein wohlvertrautes Muster, vor allem im filmischen Bereich, auf den "Snow" mehr als einmal ein Schielauge zu werfen scheint: Eine Action-Szene zu Beginn, um das Publikum gleich zu packen, dann Einführung der Hauptpersonen bzw. deren langsame Überführung aus ihrer normalen Welt in den Wahnsinn und schließlich volles Einsteigen in das anfangs nur skizzierte Szenario. Bewährt.
Spätestens hier muss der Faktor Eigenschöpfung/Neues ins Spiel kommen, und das sind klarerweise sie. Aus Shawnas Perspektive erfahren wir bereits auf den ersten Seiten, dass es sich dabei offenbar um veränderte Versionen von Menschen, die sie kennt, handelt. Kurzer Blick aufs Wetter: Die Sonne ist noch nicht untergegangen. *uff* Also schon mal keine Vampire ... im weiten Land der Körperfresser, das von Zombies bis zu außerirdischen Parasiten reicht, wäre das ja durchaus auch drin gewesen, und der Klappentext verrät dazu extra nichts. Also werd ich's auch nicht tun.
In seinen Wurzeln lässt sich das Szenario vom abgeschnittenen Städtchen, in dem eine nicht-menschliche Invasion stattfindet, vermutlich bis zu Lovecraft zurückverfolgen. Ein paar Aspekte von Malfis Invasoren, die in ihrer Optik übrigens keiner Corporate Identity unterliegen, wecken sogar besonders starke Assoziationen in diese Richtung. Viel näher aber liegen zwei andere Namen: Stephen King und Dean Koontz, wobei Malfi vom literarischen Vermögen her eindeutig näher bei Koontz anzusiedeln wäre. Glücklicherweise neigt Malfi aber weniger exzessiv als Koontz dazu, Schrecken zu behaupten und Intuitionen in den Raum zu stellen. Notwendig ist sowas ohnehin selten. Einmal heißt es etwa: [...] die ganze Gestalt strahlte etwas Entsetzliches und Böses aus. No na, besagte Gestalt hat sich gerade aus einem lebenden Menschen herausgeschält und dessen Blut durch die Gegend gespritzt - auszusprechen, welchen Eindruck sie auf den Protagonisten macht, wäre eher dann angebracht gewesen, hätte sie die gütige Aura von Mutter Teresa gehabt.
Sprachlich ist "Snow" im Stil eines Revolverblatt-Reporters gehalten, der möglichst griffige Schilderungen bieten will. Nahezu alles wird in Vergleichen beschrieben. Die können dann anschaulich sein - jemand grinst "wie eine Bauchrednerpuppe" - oder auch an den Haaren herbeigezogen: etwas macht ein Geräusch "wie der Schrei eines Pottwals" ... hat ja jeder Anwalt in seinem Erfahrungsschatz, wie ein Pottwal so schreit. Unterhaltsam ist so ein Stil aber allemal, und zwischendurch setzt Malfi ein paar kleine Highlights, etwa wenn sich eine der Hauptfiguren auf ihre letzten Atemzüge vorbereitet: Denk an glückliche Zeiten, an etwas Schönes, eine angenehme Erinnerung, ein wundervolles Erlebnis, das der allerletzte Eindruck sein soll, bevor dir dieser kleine Drecksack eine Kugel in den Kopf jagt ... Das ist ähnlich goldig wie eine ärztliche Anweisung à la: "Vermeiden Sie Stress! Unbedingt!!!"
Kurz gesagt: "Snow" ist ein typischer Horror-Burger, der nicht allzu schwer im Magen liegt. Die richtige Lektüre für einen langen Flug oder einen Tag im Strandbad.

Stephen Hunt: "Das Königreich der Lüfte"
Broschiert, 784 Seiten, € 10,30, Heyne 2011.
Aber hallo, das Buch kennen wir doch. Rechts, noch einigermaßen SFisch gestylt, die Version, in der "Das Königreich der Lüfte" vor zwei Jahren in der Science-Fiction-Reihe von Heyne erschienen ist - eine gute Gelegenheit, das geile Cover als Rundschau-Titelbild zu recyceln. Links, in passende Sepia-Töne getaucht, die aktuelle Version, mit der der Verlag seinen neuen Steampunk-Schwerpunkt einläutet. Ein durchaus würdiger Startschuss - die eingangs beschriebene Steampunk-Formel kommt hier jedenfalls in Reinkultur zur Anwendung.
Stephen Hunts Roman dreht sich um zwei halbwüchsige Waisen, die vor dem Hintergrund sozialer Unruhen, Polit-Morde und eines Putsches in ein wildes Abenteuer geraten; die vorherrschende Geschwindigkeit im Roman lautet Turbo-Boost. Eine genauere Inhaltsbeschreibung kann ich mir an dieser Stelle schenken und einfach auf die damalige Rezension verlinken. Ist die Umressortierung nun gerechtfertigt? Auf jeden Fall. Seinerzeit habe ich den Roman unter New Weird (light) eingeordnet; hauptsächlich deshalb, weil Hunts Welt diverse Ähnlichkeiten zu China Miévilles Bas-Lag aufweist. Als SF-Elemente könnte man betrachten, dass sich die Handlung offensichtlich auf einem anderen Planeten abspielt, dass Wolkenstädte und Roboter mit künstlicher Intelligenz vorkommen und seltsame physikalische Effekte auftreten. Für Steampunk sprechen das quasi-viktorianische Setting (soll heißen: imperialer Prunk oben, Elend und Arbeiteraufstände unten) und der allgemeine Stand der Technik - allem voran natürlich die beeindruckende Luftschiff-Flotte des Königreichs Jackals. Und besagte Roboter laufen mit Kohle.
Das Wichtigste an der Neuedition sind aber deren Folgeerscheinungen: Immerhin hat Stephen Hunt mittlerweile bereits fünf Romane geschrieben, die in der Welt von Jackals angesiedelt sind. Nummer 2, "The Kingdom Beyond the Waves"/"Das Königreich jenseits der Wellen", war vor zwei Jahren bereits angekündigt, ist dann aber doch nicht auf Deutsch erschienen. Im zweiten Anlauf und getragen von der Erfolgswelle des Steampunk, klappt's jetzt hoffentlich - im August soll der Roman um die Abenteuer der Archäologen-Amazone Amelia Harsh herauskommen.
Da gerade Fußball-WM läuft, kann ich momentan noch nicht genau sagen, wie viel Lesezeit übrig bleibt und welche Bücher in der nächsten Rundschau enthalten sein werden. Mit dabei auf jeden Fall ein sarkastischer schwuler Privatdetektiv, der sein Totem-Tier ausgerechnet in der Welt der Cartoons findet. Plus vielleicht ein kleiner Schwerpunkt zu a) Nazi-Mutanten oder b) dem Raumschiff Enterprise - je nachdem, welche Bücher zuerst eintrudeln. (Josefson)