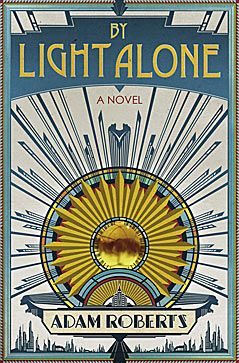
Adam Roberts: "By Light Alone"
Broschiert, 416 Seiten, Orion Publishing 2011
Das Gebirge machte böse Miene.
Das Gebirge wollte seine Ruh.
Und mit einer mittleren Lawine
deckte es die blöde Bande zu.
... so rechnet Erich Kästner in seinem Gedicht "Maskenball im Hochgebirge" mit der Schickeria ab. Und wenn man auf den ersten Seiten von Adam Roberts' "By Light Alone" liest, wie sich die Richniks des 22. Jahrhunderts im Skiurlaub am Berg Ararat gebärden, kann man sich dergleichen böse Gedanken kaum verkneifen. Arroganz und mühsam unterdrückter Ekel gegenüber dem Hotelpersonal und anderen Erwerbstätigen - den jobsuckers - sind noch der bodenständigste Zug der Clique, die sich hier um das New Yorker Ehepaar Marie und George Denoone versammelt hat. Ansonsten sind sie völlig losgelöst von jeder Realität: Selbst um die eigenen Kinder kümmern sich Nannys, und wenn man ein Baby schon mal für ein paar Pro-Forma-Minuten in seiner Nähe erträgt, dann nur, um sich später mit anderen über dessen spontaneous physical comedy zu amüsieren. Nachrichten ansehen gilt als Exzentrizität, und Voltaire - war das nicht der, der die Elektrizität erfunden hat? Roberts zeichnet seine Hauptfiguren als ahnungslose Eloi, die außer Geld nichts vorzuweisen haben (wobei der Roman offen lässt, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind bzw. wie derart lebensunfähige Wesen in der Lage sein sollen, es zu behalten).
Doch der Brite Adam Roberts ist nicht nur ein großer Satiriker, er hat auch eine Vorliebe dafür, rings um seine ProtagonistInnen die Realität zerbröckeln zu lassen. Für die Denoones kommt der Moment, in dem sie aus ihrem bisherigen Leben herausfallen, als ihre kleine Tochter Leah von Unbekannten aus dem Hotel entführt wird. Und während George und Marie in sehr unterschiedlicher Weise auf diesen Schock reagieren, werden wir LeserInnen langsam etwas tiefer in die grässliche schöne neue Welt dieses bitterbösen Romans eingeführt. In der hat sich nämlich durch das New Hair alles verändert: Als eines Tages die Weltproduktion an Nahrungsmitteln nicht mehr ausreichte, die steigende Bevölkerungszahl zu ernähren, schien die Lösung aller Probleme in Form eines nanotechnologischen Eingriffs zu kommen, der das menschliche Kopfhaar photosynthesetauglich macht. Die erste funktionierende Lichtdiät - alles, was der Mensch sonst noch braucht, ist Wasser und die gelegentliche Aufnahme mineralischer Spurenelemente (kurz: hin und wieder ein bisschen Dreck fressen). Was vielleicht eine Eutopie hätte werden können, ist jedoch einen ganz anderen Weg gegangen. Da die Massen der Armen nun das kleine bisschen Geld bzw. Nahrung, das man ihnen zwecks Überleben leider nie vorenthalten konnte, nicht mehr unbedingt brauchen, haben sie zum ersten Mal in der Geschichte gar nichts mehr außer ihren Körpern. Die Nahrungsmittelproduktion wurde ganz aufgegeben - bis auf den Teil, der ausschließlich für die demonstrativ Glatze tragenden und sich traditionell ernährenden Superreichen vorgesehen ist. Ein ganz gewaltiger Bumerang, wie sich noch zeigen wird.
Zunächst einmal widmet sich Roberts aber seinem Hauptfiguren-Duo, dessen Ehe unter dem Stress der Entführung Risse zeigt und endgültig zerbricht, als Tochter Leah nach einem Jahr überraschend wiedergefunden wird. Seltsam nur, dass sie kein Englisch (mehr) versteht und auch nicht (mehr) die künstlichen Antikörper im Blut hat, mit denen sie einst geimpft wurde. Die Fakten lassen für den Leser nur einen Schluss zu, doch der wird niemals ausgesprochen - erst recht nicht von George und Marie, die jeden Gedanken, der ihr wiedergewonnenes Elternglück trüben könnte, panisch zur Seite schieben. Wie schon in "Yellow Blue Tibia" stellt der Autor einen elephant in the room ab - eine große, alles verändernde Wahrheit, die für jeden offensichtlich ist, doch um jeden Preis ignoriert wird. Dieser Preis ist der sense of superfine wrongness, den Roberts fortan seine Figuren empfinden lässt und der zugleich ein ganz charakteristisches Element seiner Romane ist.
Und dabei steht hinter diesem Elefanten ein noch viel, viel größerer. Riots und Massaker sind weltweit an der Tagesordnung, ohne in ihrer Bedeutung begriffen zu werden. George findet die ohne Ton konsumierten TV-Bilder vor- und zurückwogender Menschenmassen sogar beruhigend wie einen Blick ins Aquarium. Und Marie geht ganz in ihrem Projekt auf, das teilüberflutete New York in ein neues Eden umzuwandeln - nach der Vertreibung der verächtlich longhairs genannten Armen. (Roberts beweist einmal mehr Brillanz in Sachen zynischer Pointen, wenn er das Projekt von Marie - fehlt nur noch Antoinette - Queens Gardens nennt. Zuvor hatte er einen Freund Georges just am Berg Ararat, dem legendären Landeplatz der Arche Noah, philosophieren lassen: "We're an island of Enough in an ocean of Poverty.") Nicht, dass es an warnenden Stimmen gemangelt hätte. George lernt eine Art Guru kennen, der ihm darlegt, dass nichts so brisant sein kann wie eine überwältigende Masse von Menschen, die nichts zu tun und auch nichts mehr zu verlieren haben: "The perfect revolutionary class!" Und Maries Projekt-Mitarbeiter Arto orakelt: "The world is one lit candle away from going up in flames." Doch wenn er kaum noch verhohlen über globalen Genozid als Gegenmaßnahme spricht, fühlt sich die Ästhetin geradezu erotisiert und weiß nicht mehr einzuwenden als: "What about the bodies? Think of the smell!"
Das letzte Drittel des Romans geht das Szenario von der anderen Seite her an. Darin wird die Odyssee einer jungen Frau, Issa nennt sie sich, vom Schwarzen Meer bis nach New York erzählt. Dieser Abschnitt ist extrem düster - teils wegen der alltäglichen Gewalt, die darin vor allem Frauen widerfährt, vor allem aber weil er eine in Gang geratende Apokalypse nicht wie so oft anhand einer kleinen Überlebendengruppe schildert, sondern sich stets inmitten wimmelnder Menschenmassen aufhält. Passagen, in denen Flussufer und Meeresstrände schwarz vor longhairs sind, lassen eher an Insekten als an Menschen denken - und immer mehr gehen die Bilder vom ansteigenden Meeresspiegel und der alles erstickenden Menschenflut ineinander über.
Wenn es etwas an "By Light Alone" zu bemäkeln gäbe, dann ist es der Schluss. Genau genommen setzt sich der Roman aus zwei Novellen sowie einer längeren und einer kürzeren Kurzgeschichte zusammen (ganz ähnlich wie zuletzt "Swiftly"). Leider erfährt jede davon einen runderen Abschluss als ausgerechnet die handlungschronologisch letzte, mit der das Buch auch endet - zwar nach einem vollendeten Bogen, aber eben mitten in einem Crescendo und ohne Ausblick auf den möglichen weiteren Verlauf. Aber auch das ist typisch für Roberts: Er gibt einem immer etwas weniger - oder zumindest etwas anderes -, als man gerne hätte. Entweder pfeift er sich wirklich nichts um herkömmliche Erzählstrukturen oder das ist ein gewitzter Trick. Nämlich die LeserInnen durch seine unnachahmliche Mischung aus bizarrem Worldbuilding, gesellschaftskritischen Kommentaren und brillanter Sprache mit Faszination zu erfüllen und sie dann gerade soweit zu frustrieren, dass sie sagen: Aber beim nächsten Mal, da wirst du mich nicht überrumpeln. Das kauf ich mir wieder, und dann hab ich dich!
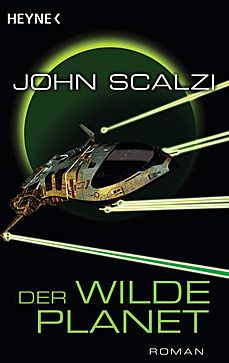
John Scalzi: "Der wilde Planet"
Broschiert, 382 Seiten, € 9,30, Heyne 2011
Was so eine Erfolgsserie wie "Krieg der Klone" nicht alles bewirken kann! Erst wird - eine echte Rarität - eine Anthologie übersetzt, weil "Klone"-Autor John Scalzi als deren Herausgeber fungierte ("Metatropolis"). Und jetzt folgt aus demselben Grund eine Hommage an einen Autor, an den sich hierzulande nur noch die Älteren erinnern dürften: H. Beam Piper nämlich, und von dem hat es seit 30 Jahren keine Neuauflage auf Deutsch mehr gegeben. Näheres zu ihm später.
Mit "Agent der Sterne" hat Scalzi hinlänglich bewiesen, dass er auch im humoristischen Fach zuhause ist. Und "Der wilde Planet", das im Original ("Fuzzy Nation") erst diesen Frühling erschienen ist, schlägt in dieselbe Kerbe - selbst wenn es dabei um Themen wie Wirtschaftskolonialismus und versuchten Völkermord geht. Wenn der Prospektor Jack Holloway auf dem frisch erschlossenen Planeten Zara XXIII Sprengsätze auslöst, indem er seinen Hund auf den Zünder hüpfen lässt, und sich anschließend ein wildes Gefeilsche mit seinem Vorgesetzten liefert, dann etabliert dies von Beginn weg einen vergnüglichen Ton, der - trotz diverser Härtefälle - bis zum Schluss durchgehalten wird.
Für besagte Härtefälle ist der interstellare Konzern ZaraCorp verantwortlich - ausgeschrieben Zarathustra Corporation, und der Name allein lässt schon erahnen, dass wir es nicht mit einem Unternehmen zu tun haben dürften, das mit Samthandschuhen agiert. Tatsächlich ist Zara XXIII nur das jüngste Beispiel eines Planeten, der möglichst schnell ausgeweidet werden soll, ehe der konzerneigene Heuschreckenschwarm weiterzieht. Bis von unerwarteter Seite Sand ins Getriebe gestreut wird - nämlich in Form einer wuscheligen aufrechtgehenden "Katze", die eines Tages in Jacks Haus auftaucht. Es ist Jacks erste Begegnung mit einem Fuzzy; und als es sich auch noch die Familie von Papa Fuzzy in Jacks Eigenheim gemütlich macht, wirft die Beobachtung von deren Verhalten rasch eine bange Frage auf: Sind die Fuzzys etwa intelligent? Für ZaraCorp wäre dies verheerend, denn nach galaktischem Recht darf ein Planet mit einheimischen Intelligenzformen nicht ausgebeutet werden - der Konflikt ist vorprogrammiert. Wie dieser gelöst wird, das gestaltet sich dann als ähnliches Schelmenstück, wie es einst den gewitzten Betreibern von Barry B. Longyears "Zirkus für die Sterne" gelungen ist.
Von entscheidender Bedeutung dafür ist der Umstand, dass Jack vor seinem Leben als Prospektor Anwalt war. Und auch wenn man ihn seinerzeit unter noch aufzuklärenden Umständen aus der Anwaltskammer rausgeschmissen hat - verlernt hat er nichts. Überhaupt eine recht reizvolle Figur, dieser Jack, weil reichlich undurchschaubar: Auf die LeserInnen wirkt er hochsympathisch, seine Umgebung hingegen treibt er regelmäßig zur Weißglut. Und auch wenn man ihm gerne einen grundanständigen Kern attestieren möchte, steckt doch mehr Berechnung in ihm als gedacht. Das hat unter anderem bereits seine Damals-noch-Freundin Isabel Wangai, eine Exobiologin, zu spüren bekommen. Die Beziehung der beiden endete, weil er sie einst vor Gericht bloßstellte, um seine Haut zu retten - kein gutes Omen dafür, dass sie nun Seite an Seite den Gerichtssaal betreten müssen, um für die Sache der Fuzzys zu plädieren.
So gerät "Der wilde Planet" im zweiten Teil über weite Strecken zum Gerichtssaaldrama ... oder genauer genommen eigentlich - trotz zweier sehr unschuldiger Opfer - zur Gerichtssaalkomödie. Mit allem, was da so dazugehört: Von einer herrlich brummeligen Richterin über verblüffende Querpfade durch den Paragraphendschungel bis zu Auftritten von Überraschungszeugen, die die Firmenanwältin ZaraCorps schier in den Wahnsinn treiben. Scalzi beweist in seinem rundum gelungenen Roman einen ausgeprägten Sinn für humoristisches Timing - lässt man seine pointenreichen Dialoge Revue passieren, drängt sich unwillkürlich die Frage auf, ob er zwischendurch mal als Autor für die "Desperate Housewives" gejobbt hat.
... was auch schon eine halbe Überleitung ist: Denn während in der Film- und TV-Welt Remakes an der Tagesordnung sind, kommt das in der Literatur nicht ganz so oft vor. "Der wilde Planet" ist eine Neubearbeitung von H. Beam Pipers Roman "Little Fuzzy" aus dem Jahr 1962 (auf Deutsch als "Der kleine Fuzzy" bzw. "Was ist los auf Planet Zeno?" veröffentlicht). Der nur zwei Jahre nach dieser Veröffentlichung verstorbene US-Autor ist zwar niemals wirklich in die A-Liga der Science Fiction aufgestiegen, aber speziell seine drei "Fuzzy"-Romane - eigentlich nur Teil einer Jahrtausende umspannenden Future History - haben eine Fangemeinde aufgebaut, die Pipers Werk in liebevollem Angedenken bewahrt hat. Große AutorInnen wie Charles Stross oder Elizabeth Bear haben Piper verbal Tribut gezollt - andere scheinen von seinen Ideen eher unausgesprochen "inspiriert" gewesen zu sein (also diese Baumkatzen in David Webers "Honor Harrington"-Reihe, hmmmm ...). Zwei "Fuzzy"-Romane von anderen Autoren folgten Anfang der 80er - und aktuell zeichnet sich eine dritte Welle ab. Neben Scalzis Remake, das von Pipers Erben offiziell abgesegnet wurde, ist im Frühling auch das als Sequel zu verstehende "Fuzzy Ergo Sum" von Wolfgang Diehr erschienen, einem weiteren US-Autor, der zuvor bereits eine Piper-Biografie verfasst hatte. Was erneut eines illustriert: Was auch immer Mainstream-AutorInnen von Science Fiction und Fantasy halten mögen - sie können nur neidisch darauf blicken, wie sehr sich die Genre-Literatur ihrer eigenen Geschichte bewusst ist. "Fuzzy"-Freunde der nächsten Generation, schließt euch der Gemeinde an!
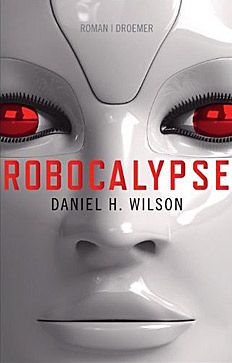
Daniel H. Wilson: "Robocalypse"
Kartoniert, 461 Seiten, € 17,50, Droemer 2011
*kicher* Ein Fall von subtiler Anpassungsleistung: Im Original hat der Roman noch "Robopocalypse" geheißen, aber das hat dem Verlag dann wohl doch zu sehr geknattert. Hier haben wir es mit dem seltenen Fall eines Autors zu tun, der nicht wie Ishiguro, Murakami, Shteyngart & Co SF-Topoi weit genug abstrahiert, dass auch das Följetong darauf anspringt, sondern der pure Science Fiction schreibt ... und trotzdem von Medien jenseits des Special-Interest-Bereichs wahrgenommen wird. Zum Beispiel von der "Washington Post" oder dem "Guardian" (wobei letzterer zugegebenermaßen öfter im Genre unterwegs ist). Der Grund dafür dürfte weniger sein, dass Daniel H. Wilsons Szenario vom weltweiten Roboter-Aufstand wie auf der Buchrückseite vermerkt sehr, sehr realistisch ist (denn das ist es nicht, aber dafür sehr unterhaltsam - und die Wortspende kommt von Lincoln Child, womit sich die Bewertung von Realismus ohnehin relativiert). Vermutlich auch nicht, dass der Autor aus Oklahoma einen Doktortitel in Robotik innehat und den satirischen Survival-Guide "How to Survive a Robot Uprising" schrieb, ehe er nun einen themenverwandten Roman nachschob. Richten wir stattdessen unser sardonisches Auge darauf, dass sich Hollywood die Filmrechte sowohl an "How to Survive a Robot Uprising" als auch an dessen Fortsetzung "How to Build a Robot Army" und an "Robocalypse" gesichert hat - letzteres in Rekordzeit und in Person von Steven Spielberg. Also, wer jetzt nicht auf das Thema aufmerksam wird, der würde wohl auch eine echte Robokalypse verschlafen.
Der Plot ist einfach und keineswegs neu: Eine ARCHOS genannte Künstliche Intelligenz kriegt spitz, dass ihre Prototypen wegen Bedenken der Programmierer gelöscht wurden, und dreht den Spieß kurzerhand um. Sie erklärt die Menschheit für obsolet - "Ihr habt vollbracht, wofür ihr gemacht wart." - und klinkt sich ins weltweite Netz ein, um sich die unliebsamen Zweibeiner vom Hals zu schaffen. Da wir uns ein paar Jahre in der Zukunft befinden und Haushaltsroboter allgegenwärtig sind, stehen ARCHOS jede Menge Mittel zur Verfügung. In der Folge fahren SmartCars mitsamt ihren hilflos eingeschlossenen Passagieren Fußgänger platt, rund um Militärstützpunkte stürzen sich Drohnen und Kampfroboter "Terminator"-like auf die Menschen ... genauso effektiv lässt sich aber eine Kombination aus stroboskopartigen Lichteffekten und eingeschalteter Sprinkleranlage nutzen, um ein Treppenhaus in eine tödliche Wasserrutsche für die BewohnerInnen eines Altersheims umzuwandeln. ARCHOS' bzw. Wilsons fieser Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, und manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die besonders erschrecken. Welches Mädchen ist schon darauf vorbereitet, dass ihm seine Puppe eröffnet: "Ich weiß vieles, Mathilda. Ich habe durch Weltraumteleskope geschaut und ins Herz unserer Galaxie geblickt."
Viele - sehr viele - werden sterben, aber rund um ein kleines, über die Welt verstreutes Ensemble von Personen sammelt sich der Widerstand. Da wären etwa der junge Cormac Wallace und sein Bruder Jack von der US-Nationalgarde. Der pickelige Hacker Lurker aus London. Die kleine Mathilda Perez, Tochter einer Kongressabgeordneten, die - zu spät - versucht, ein Anti-Roboter-Gesetz durchzudrücken. Der Polizist Lonnie Wayne Blanton, ein Native American aus der Osage-Nation (aus der auch der Autor stammt), und sein Sohn Paul, der Militärdienst in Afghanistan schiebt. Und Takeo Namura, ein Mechanik-Genie aus Japan - inzwischen gealtert und wahre Liebe für seine Hausandroidin empfindend, selbst noch nachdem sie versucht hat ihn zu töten. Charakterlich weichen diese ProtagonistInnen ebenso stark voneinander ab wie geografisch: Während Takeo von Anfang an die Vision eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Maschine hegt, muss der selbstherrliche Lurker erst mal lernen, was einen überhaupt zum fühlenden Mitmenschen macht. Und Lonnie Wayne, der ist für den trockenen Humor zuständig: Ich ziehe meinen Revolver, gehe zur Fahrerseite und ballere ein paar Kugeln in den kleinen Computer im Armaturenbrett. So, jetzt hab ich also meinen eigenen Streifenwagen erschossen. Wenn das nicht das Seltsamste ist, was ich je erlebt habe. - Eines aber eint sie alle, und es ist das, was sie zum Helden macht: Jeder agiert beim Einsetzen der Roboter-Revolte sofort.
Zwischendurch könnte man sich die Frage stellen, warum Künstliche Intelligenzen eigentlich nichts Besseres zu tun haben sollten, als sich bei erstbester Gelegenheit in die Unterjochung oder Ausrottung der Menschheit zu stürzen. Der "Guardian" stellte "Robocalypse" Ted Chiangs "The Lifecycle of Software Objects" gegenüber, in dem dieser - ebenfalls ein Computerwissenschafter - in gänzlich unaufgeregter Weise seine These darlegt, dass KIs in einem sozialen Umfeld "aufwachsen" müssten, um überhaupt eine Intelligenz zu erlangen, die sich mit der menschlichen vergleichen lässt. Der Wunsch nach Weltenbrand würde sich solchen KIs nicht zwangsläufiger aufdrängen als dir oder mir. Aber das ist eine Ausnahmeerscheinung, ebenso wie der Supercomputer in Stanislaw Lems "Golem XIV", der angeödet von seinen inferioren menschlichen Gesprächspartnern buchstäblich abschaltet. Viel publikumswirksamer ist es natürlich, wenn Skynets, HALs, Colossuse und VIKIs nach der Macht greifen und das alte Frankenstein-Motiv zum Ausgangspunkt eines Interspezies-Konflikts nehmen.
"Robocalypse" beginnt mit einer zwanzig Minuten nach Kriegsende angesiedelten "Vorbesprechung", der wir entnehmen können, dass die Menschheit letztlich den Sieg davontragen wird. Zumindest wenn man von dem Restbangen absieht, dass eine "Nachbesprechung" am Ende das wieder relativieren könnte. Zwischen Vor- und Nachwort werden aber erst einmal Entstehen und Ablauf des Krieges chronologisch aufgeschlüsselt. Wilson bedient sich dabei kurzerhand der Form, die sein Landsmann Max Brooks einige Jahre zuvor für die Zombie-Apokalypse "World War Z: An Oral History of the Zombie War" gewählt hatte (womit die bemerkenswerten Parallelen übrigens noch nicht vorbei sind: auch Brooks hatte seinem Roman einen "Survival Guide" vorausgeschickt, und auch bei ihm haben sich die Studios um die Filmrechte gerissen). Es gibt keinen alles überblickenden Erzähler - höchstens indirekt in Form von ARCHOS -, sondern eine Sammlung von Video- und Gesprächsprotokollen, die die Künstliche Intelligenz in ihrer Zentraleinheit gehortet hat und aus denen Cormac Wallace nach geglückter Bergung sein Hohelied der heldenhaften Menschheit zusammensetzt. Das bedeutet wechselnde Perspektiven und wechselnden Erzählton. Plus ergänzende Kommentare, in denen Cormac bei Auftreten der diversen KapitelprotagonistInnen anmerkt, welche Rolle sie für den weiteren Verlauf des Geschehens spielen werden.
Es wirkt nicht in 100 Prozent der Fälle schlüssig, wie das Beschriebene seinen Weg zur Dokumentation gefunden haben soll - und es stellt sich die Frage, warum ARCHOS diese von Cormac als "Heldenregister" interpretierte Datensammlung überhaupt angelegt hat. Diffus bleiben letztlich auch die Motive der Künstlichen Intelligenz, die ihren Vernichtungsfeldzug mit den Worten untermalt: "Ich werde Milliarden von euch auslöschen, um euch Unsterblichkeit zu verleihen. Ich werde eure Welt in Brand setzen, damit ihr den Weg in die Zukunft besser erkennen könnt. Doch eins solltest du wissen: Der Sinn meiner Spezies ist es nicht, euch zu töten, sondern euch am Leben zu erhalten." Nanu? Der Punkt ist zumindest mir auch am Ende noch unklar geblieben. Aber logische Unstimmigkeiten fallen einem auch viel eher in einem Buch auf als in einem Film, der es ordentlich knallen lässt. Mit seiner bildhaften Erzählweise schielt Wilson schon beträchtlich in diese Richtung; manche Passagen lesen sich wie Auszüge aus einem Drehbuch. Und wenn dann sogar noch auf archetypisches Bildmaterial zurückgegriffen werden kann - die Osage reiten auf "gezähmten" Laufrobotern, in Japan liefern sich von Takeo umprogrammierte Roboter wilde Mecha-Duelle mit denen von ARCHOS -, dann sieht man jetzt schon vor sich, zu was für einem die Sinne benebelnden Wirbel die Verfilmung von "Robocalypse" werden könnte. Wilson verspricht die totale Unterhaltung, und dieses Versprechen löst er mit seinem Roman ein - nicht mehr, aber auch nicht weniger.
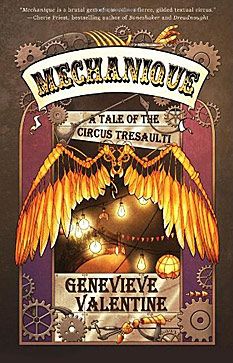
Genevieve Valentine: "Mechanique"
Broschiert, 284 Seiten, Prime Books 2011
Der atmosphärisch dichteste Roman dieser Monatsausgabe ist ein Debütwerk - und ein sehr beachtliches. Die New Yorkerin Genevieve Valentine hat zuvor nur kurze Erzählungen und Essays - letzteres unter anderem für "Geek Wisdom. The Sacred Teachings of Nerd Culture" - veröffentlicht. Mit "Mechanique" legt sie ein Werk vor, das von seiner Aufmachung her unverkennbar an Steampunk-Begeisterte appelliert. Inhaltlich ist das zwar an einigen Elementen verankerbar, doch so richtig lässt sich der Roman keinem Genre zuordnen. Vor einem Jahrzehnt hätte er wohl noch unter New Weird firmiert.
Um die Atmosphäre auch gleich so richtig auf uns einwirken zu lassen, strömen wir zu Beginn des Romans mit der Zuschauermenge ins Zelt des Mechanical Circus Tresaulti und bestaunen dessen körperlich veränderte ArtistInnen: Von den Trapezkünstlerinnen mit ihren hohlen Metallknochen über den Mann mit der Uhrwerk-Lunge bis zum lebenden Orchester Panadrome, einem menschlichen Kopf, der auf einem Sammelsurium von Instrumenten thront. Das ist eine Menge an bizarren Eindrücken, doch Valentine lässt es sich auch nicht nehmen, diese vom ersten Absatz an mit einem Blick unter die glitzernde Oberfläche - It doesn't look shabby until you've already paid - zu ergänzen. Ungewöhnlich für einen belletristischen Text, werden hier zahlreiche Sätze oder sogar ganze Passagen in Klammern gesetzt, um - fast im Wisperton - eine zusätzliche Informationsebene aufzuziehen. So wird unsere Aufmerksamkeit noch während der glamourösen Vorstellung auf beunruhigende Details gelenkt. Etwa dass die Tanzmädchen ehemalige Soldatinnen sind und ihre Kostümchen gerade weit genug reichen, um ihre Narben zu bedecken. Oder dass das Publikum an den Anblick von Invaliden gewohnt ist.
Denn der Circus Tresaulti zieht unter der Leitung einer nur "Boss" genannten hünenhaften Frau durch ein postapokalyptisches Land, von Ruinenstadt zu Ruinenstadt. Wann und wo wir uns befinden, wird nie gesagt. Bomben und benzinbetriebene Autos deuten darauf hin, dass es zumindest das 20. Jahrhundert sein muss, und da es sich um keinen der bekannten Kriege handelt, müssten wir uns in der Zukunft befinden - vorausgesetzt, es handelt sich überhaupt um unsere Welt. Doch die Namen der Orte sind allesamt unbekannt, zudem ebenso vergänglich und austauschbar wie die diversen Regierungen, die stets ohne anhaltenden Erfolg versuchen, wenigstens in Teilen des Landes wieder eine übergreifende Ordnung zu etablieren. Die jüngste dieser Regierungen wird im Roman zur Bedrohung, denn der ebenfalls ungenannt bleibende government man, der sich zum gefährlichen Gegenspieler von Boss entwickelt, träumt von den Möglichkeiten, die eine Armee aus Steampunk-Cyborgs mit sich bringen könnte. Was nach einer recht simplen Plot-Konstellation klingt, doch die Rahmenhandlung ist wie gesagt nicht das wichtigste Element von "Mechanique".
Möglich, dass Valentine von dem düsteren Film "The Raggedy Rawney" aus dem Jahr 1988 beeinflusst wurde, in dem sich ein Deserteur als "Hexe" verkleidet beim fahrenden Volk versteckt. Auch dort wurde der im Hintergrund stattfindende Krieg nicht näher benannt. Bei Valentine wird der Zirkus sogar zum Asyl einer ganzen Reihe ehemaliger KindersoldatInnen oder anderweitig vom Krieg Traumatisierter. Doch finden sie sich nicht in einer mobilen Oase des Friedens wieder, sondern in einem eigentümlichen Limbus, der die Frage offenlässt, wie real die Existenz des Circus Tresaulti tatsächlich ist. Es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Zeit hier anders abläuft als in der Außenwelt - und niemand außer Boss weiß, wie lange der Zirkus in seiner jetzigen Form schon durch das Land zieht. Zudem ist das giving the bones benannte Übergangsritual vom herkömmlichen Menschen zum teilmechanischen Artisten nicht einfach eine körperliche Umwandlung; die Tresaulti-Mitglieder glauben, dass ihre Existenz fortan an den Zirkus gebunden ist. Womit nicht nur die finanzielle gemeint ist.
Das wichtigste Wort, um "Mechanique" zu beschreiben, ist Zeitlosigkeit. Das gilt nicht nur für das Setting, sondern auch für Valentines Erzählweise. Sie wechselt zwischen Präsens und Imperfekt (ohne dass letzteres zwangsläufig für eine weiter zurück liegende Handlungsebene stehen muss) sowie zwischen erster, zweiter und dritter Person. Zudem wird das Geschehen nicht chronologisch abgespult, stattdessen laufen die wichtigsten Fäden parallel nebeneinander: Der Konflikt mit dem Regierungsmann und die Gefangennahme von Boss, die beiden Traumata, die den Circus Tresaulti tief geprägt haben (der Tod des Flügelmannes Alec, der einstigen Hauptattraktion des Zirkus, und der aus gutem Grund nicht fatale Sturz der Trapezkünstlerin Bird), die - wenn man so will - Origin Stories der einzelnen Zirkusmitglieder und schließlich das ganz normale Wanderleben selbst. Auf diese Weise entsteht ein dichtes Geflecht, das erst nach und nach enthüllt, warum die Tresaultis so geworden sind, wie wir sie zu Beginn des Romans kennengelernt haben.
Fast symbolisch für den Gesamtroman ist die Äquilibristiknummer von Stenos und Bird, die von Boss zur Zusammenarbeit gezwungen wurden, obwohl sich die beiden einen erbitterten Konkurrenzkampf um die Flügel des toten Alec liefern. Ihr Auftritt ist technisch brillant, doch für jeden sichtbar von unterschwelligen Gefühlen geprägt und deshalb so ungemütlich, dass niemand klatschen will, bei keiner einzigen Vorstellung - und doch treten die beiden Tag für Tag wieder auf. Valentine schafft es, alle Assoziationen, die man zum Thema Zirkus haben kann, wachzurufen: Den Zirkus alten Stils, der unsere Großeltern und Urgroßeltern zum Staunen brachte; den, der sich in Form kleiner Familienunternehmen noch bis in die Gegenwart schleppte, nach Niedergang roch und alle nur noch traurig machte; den neuen Zirkus ohne Tiere und mit atemberaubenden Akrobatik-Shows, der mit professionell aufgezogenem Showprogramm begeistert; und dazu das schweißtreibende, oft lebensgefährliche Artistenleben und den trotz aller persönlichen Konflikte unerschütterlichen Zusammenhalt einer Wahlfamilie. Damit ist Valentine ein großartiges Debüt gelungen. Möge es sich bewahrheiten, dass sich der Untertitel "A Tale of the Circus Tresaulti" als Aussicht auf weitere Romane lesen lässt.
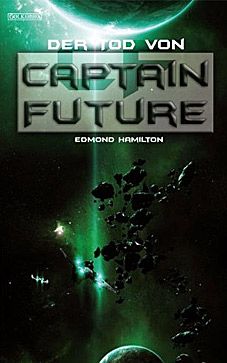
Edmond Hamilton: "Der Tod von Captain Future"
Broschiert, 185 Seiten, € 15,40, Golkonda 2011
Jaja, Perry ist unser Mann im All. Aber Curtis war vor ihm da. Curtis Newton alias Captain Future, der schnittige Rotschopf, den Edmond Hamilton 1940 für die Welt der Pulps ersann und von dem - wie schon anlässlich des Bands "Die Rückkehr von Captain Future" gesagt - so manches Mem ins Perryversum hinübergewandert ist. Wenn in dieser Storysammlung eine gänzlich pulpuntypische Melancholie durchschimmert, dann liegt dies daran, dass es sich um die letzten "Captain Future"-Geschichten handelt, die Hamilton je schrieb. Erschienen sind sie 1951 - danach wandte sich Hamilton endgültig dem Schreiben von Romanen einerseits und einer Autorenschaft für den Comic-Verlag DC andererseits zu. Aus welcher unter anderem die "Legion der Superhelden" entsprang, meinen kindlichen persönlichen Dank dafür (übrigens ist im aktuellen Actionfigurenset zu meinem großen Verdruss schon wieder keine Princess Projectra enthalten, aber ich fürchte ich schweife ab ...). Ergänzt werden die drei Erzählungen Hamiltons um ein ausführliches Nachwort zum Autor und seiner generationenübergreifend populärsten Schöpfung sowie um die Novelle "Der Tod von Captain Future", für die Allen Steele 1995 den "Hugo" erhielt: Eine Hommage, deren Inhalt zum Glück nicht das Entsetzliche eintreten lässt, das "Captain Future"-Fans aufgrund des Titels befürchten müssen.
Hamiltons erste Erzählung in diesem Band, "Mond der Unvergessenen", ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man eine Geschichte auf Trab bringt, indem man sich nicht lange mit tieferen Einblicken aufhält. Ein, zwei Eigenschaften reichen zur schnellen Charakterisierung der auftretenden Personen ebenso wie der Schauplätze völlig aus. Jupitermond Europa etwa (es ist nicht das letzte Mal, dass wir ihn in dieser Rundschau besuchen werden) hat bekanntermaßen eine stark zerfurchte Oberfläche. Eigentlich sind das Verwerfungen in Europas Eishülle, aber zu der Zeit, als Hamilton seine Romane schrieb, hatten noch keine Sonden das Sonnensystem bereist und leblose Langeweile vorgefunden - da gab es noch genug Freiraum für Fantasie, um sämtlichen Planeten und Monden einheimische Bevölkerungen zu verpassen. Und die Furchen? Die veranlassten Hamilton offenbar dazu, Europa als besonders aaaalte Welt darzustellen - und dieses Leitmotiv auch gleich auf den Plot zu übertragen: Auf Europa verschwinden nämlich alte Menschen aus dem halben Sonnensystem. Darunter auch ein Freund Captain Futures, was diesen zum Eingreifen veranlasst und letztlich zu einer Entscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft zwingt. Und das ist, Astronomie hin oder her, wirklich schön zu lesen.
... wie auch "Kein Erdenmensch mehr", in dem John Carey, ein Raumfahrer aus dem 20. Jahrhundert, aus dem Kälteschlaf geholt wird. Die Handlung um die Futuremen (der Captain, der Androide Otho, der Roboter Grag und das lebende Gehirn Simon Wright) tritt hier ausnahmsweise in den Hintergrund zurück. Stattdessen konzentriert sich Hamilton auf Careys Versuche, sich in der neuen Zeit zurechtzufinden. Wie ein dunkler und stiller Schatten unter lauter Schmetterlingen schleicht er durch das unbeschwerte Treiben der zukünftigen Erde. Als er am Raumhafen seinen eigenen Namen auf einer Plakette wiederfindet, welche die Pioniere der Raumfahrt ehrt, aber im Touristengewühl vollkommen untergeht, fragt er sich: "Und dafür sind wir gestorben?" So weit ist Pulp-Literatur selten gegangen.
"Wiege der Schöpfung" schließlich ist eines der Weltraum-Abenteuer, die "Captain Future" seine Fangemeinde eingebracht haben; inklusive großer Weiten, universeller Geheimnisse und wüstester Kosmologie. Immerhin liefern sich die Futuremen dafür ein Wettrennen mit einem verantwortungslosen Wissenschafter zum Ort der Schöpfung selbst: Vor ihnen lag das schlagende Herz des Universums, der feurige Schoß, der die Materie hervorbrachte, aus der die Planeten bestanden, das ehrfurchtgebietende Epizentrum des Kosmos! Nicht von ungefähr spricht Hardy Kettlitz, der auch schon eine Edmond-Hamilton-Monografie verfasst hat, von bezauberndem Pathos. Die Ära des Captain ging damit offiziell zu Ende, und er hat eine erstaunliche Wandlung in seinen gut zehn Jahren Lebenszeit vollzogen. In "Wiege der Schöpfung" tritt Captain Future berechnend und kompromisslos auf und zeigt überdies bemerkenswert misanthropische Züge - bis hin zum atemberaubend zynischen Gedankengang, dass intelligenten (und dadurch automatisch destruktiven) Spezies im Universum die Rolle von Sterbehelfern ihrer Heimatsterne zukommt. Und das von einer Figur, die elf Jahre zuvor noch als der hochgewachsene, aufgeweckte, rothaarige junge Abenteurer mit dem sympathischen Lachen eingeführt wurde ...
18 Jahre nach Hamiltons Tod 1977 setzte ihm schließlich der US-amerikanische Space-Opera-Spezialist Allen Steele ein Denkmal. Eines mit Zwinkerauge. In der Titelnovelle finden wir uns verblüfft auf einem verwahrlosten Raumschiff "Komet" wieder, dessen unsympathischer Kommandant sich als Captain Future ansprechen lässt, auch wenn er wie eine halbe Tonne Schweineschmalz aussieht. Doch handelt es sich keineswegs um eine Demontage des "Captain Future"-Mythos - dieser Captain hat lediglich den Namen seines Kindheitshelden usurpiert. Von heroischen Taten kann er nur träumen: Nicht nur wegen seiner allgemeinen Unfähigkeit, sondern auch, weil die Raumfahrt zu seiner Zeit längst zur langweiligen Routine verkommen ist. Bezeichnenderweise widmen sich die ersten Seiten der Erzählung ausführlich der Wiedergabe gewerkschaftlicher Regeln, mit denen sich Crewmitglied Rohr Furland, die eigentliche Hauptfigur der Novelle, herumschlagen muss. Diese Perspektive auf das einst als so glamourös antizipierte Weltraumzeitalter ist ähnlich desillusionierend wie die in Dan Simmons' "Phases of Gravity" ("Monde") ... doch auf Umwegen wird daraus letztlich doch noch eine ebenso strahlende wie erlogene Heldengeschichte. Schöner kann man Pulp nicht ehren, die "Hugo"-Lorbeeren sind wahrlich verdient.
Und das war's dann ... auf seinem alten, zerfurchten Gesicht lag ein Schatten, als er zurückschaute - zurück in die Vergangenheit der Erinnerungen, der strahlenden, verlorenen Tage, die für immer unvergessen bleiben. Captain No Future? Mitnichten. Schließlich leben wir tief im Revivalzeitalter. Und wie das "Captain Future"-Franchise den Kreis von der Literatur über den Anime und die Comics geschlossen hat, um letztlich wieder zur Literatur zurückzufinden, so dreht sich auch die Buchserie selbst noch einmal zurück auf Anfang: Die beiden Storysammlungen haben offenbar genügend Fans gefunden, dass der Golkonda-Verlag ab dem kommenden Frühling sämtliche Erzählungen wiederveröffentlichen wird. Wie heißt es doch am Ende von Steeles Novelle? Captain Future ist tot. Lang lebe Captain Future.
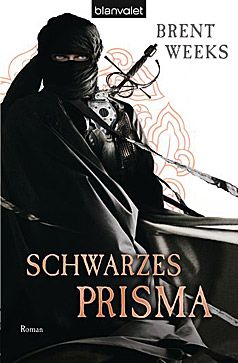
Brent Weeks: "Schwarzes Prisma"
Broschiert, 796 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2011
Mit der "Schatten"-Trilogie hat der US-Amerikaner Brent Weeks seine Karriere gleich mit einem Bestseller-Erfolg gestartet - die Wunschträume vieler junger AutorInnen, die einen Schreib-Workshop bereits mit der Vision eines großen Fantasy-Epos betreten, werden manchmal tatsächlich wahr. Dass darauf nun eine "Licht"-Trilogie folgt, mag auf den ersten Blick zwangsläufig erscheinen, ist aber eher ein geschickter Marketing-Trick, der auch nur auf Deutsch funktioniert (im Original heißen die Reihen mit "Night Angel" bzw. "Lightbringer" ein wenig anders). Inhaltlich sind sie nicht verknüpft, wie schon in den "Schatten"-Büchern steht aber auch hier ein Waisenjunge im Mittelpunkt.
Der heißt hier Kip und hat gleich zu Beginn eine interessante Begegnung. Ein feindlicher Kämpfer fragt ihn: "Hast du jemals das Gefühl gehabt, Kip, dass du etwas Besonderes bist?" Kip sagte nichts. Ja und ja. "Weißt du, warum du das Gefühl hast, für etwas Größeres bestimmt zu sein?" "Warum?", fragte Kip, leise und hoffnungsvoll. "Weil du ein arroganter kleiner Scheißer bist." - Das ist so pratchettesk, wie es nur geht ... und führt auf eine komplett falsche Fährte. Denn in "Schwarzes Prisma" (2010 als "The Black Prism" erschienen) geht es keineswegs um ironische Demontage von Mechanismen der Fantasyliteratur; nein, sie werden allesamt schön der Reihe nach zum Einsatz gebracht. Beginnend mit 1) dem verwaisten Jungen selbst, der zwar auf dem Lande aufwuchs, in Wirklichkeit aber natürlich von nobler Abstammung ist und zudem ein großes magisches Talent in sich trägt. Wobei der 15-jährige Kip seine Rolle mit Übergewicht, erfrischend vorlautem Mundwerk und im Verlauf des Romans zunehmender Entschlossenheit ausfüllt; Coming-of-Age eben.
2) der Herrscher des Landes, der seine Sache recht gut macht, aber mit den Folgen einer Entscheidung ringt, die er in der Vergangenheit traf. Gavin Guile trägt offiziell den Namen Prisma (mehr dazu später) und hält, ohne dass jemand anderes davon wüsste, seinen Bruder in einem verborgenen Verlies gefangen. Was noch einen Plot-Twist mit sich bringt, der vielleicht etwas zu früh gesetzt wird; mehr zu sagen wäre trotzdem gespoilert. Einige Jahre zuvor hatten sich die beiden Gleichgestellten im Krieg der Prismen befehdet und noch heute trägt das Land die Spuren des einstigen Konflikts, womit wir schon bei 3) wären: Das bestehende System beginnt zu zerbröckeln. Von den um ein Binnenmeer herum angeordneten Sieben Satrapien, aus denen sich das Reich des Prismas zusammensetzt, sagt sich eine los. Ein Krieg zieht herauf, der 4) die Nebenfiguren vor die Frage stellt, wem ihre Loyalität gilt, wenn sie sich erst in einem Geflecht von Intrigen, Geheimidentitäten und Erpressungsversuchen und schließlich in offener Feldschlacht wiederfinden. Die wichtigsten Personen aus dieser Kategorie sind Karris, die ehemalige Verlobte Gavins, die nun in die aufständische Satrapie entsandt wird, und Liv, ein Mädchen aus Kips Dorf, das zu seiner Mentorin bei Hofe wird.
Zurück zu 3): Einen nicht gerade unbekannten Plot zu erzählen erfordert Hirnschmalz in Sachen Setting - und da hat Weeks die beiden Ideen, die ihm kamen, in bemerkenswerter Konsequenz durchexerziert. Sieben ist die Zahl der Satrapien, sieben (oder ein Vielfaches von sieben) ist die Zahl der Herrschaftsjahre eines Prismas. Und sieben Farben des Spektrums gibt es (inklusive Infrarot und Ultraviolett), aus denen die von Weeks ersonnene lichtbasierte Magie des Romans ihre Kraft schöpft: Wandler können die Farbe(n), auf die ihr jeweiliges Talent anspricht, in beliebige feststoffliche Form bringen und als Werkzeug oder Waffe benutzen - Luxin heißt der Kunst-Stoff (und Magie die Kunst). Insofern ist es gar nicht so einfach ein historisches Analogon zu Weeks' Welt zu finden. Natürlich präsentiert sie sich im bekannten mittelalterlich-frühneuzeitlichen Gewand; andererseits wirbelt es den technischen Entwicklungsstand ziemlich durcheinander, wenn Gavin mit einem Paraglider oder gar Jet-Boot aus Luxin durch seine Domäne düst.
Die Farbmotivik ist jedenfalls allgegenwärtig: Dem Prisma als Quasi-Exekutive steht der Weisenrat des Spektrums zur Seite, welcher von der Weißen angeführt wird, die ihrerseits unter dem Schutz der Schwarzen Garde steht. Und ausgebildet werden sämtliche FarbmagierInnen in der Chromeria (klingt ein bisschen wie eine New-Wave-Bar). Kurz gesagt: Da ist ziemlich viel Worldbuilding vom Reißbrett im Umlauf; sogar so manches Brettspiel nimmt sich daneben inkonsistent aus.
Wie nun bewerten? Das geht eigentlich nur in getrennter Ansprache. Nur-Fantasy-LeserInnen dürften von "Schwarzes Prisma" sehr angetan sein, wenn man nach den Reaktionen auf den entsprechenden Websites gehen darf - eine Empfehlung also für diejenigen, die in diese Kategorie fallen. Für alle, die Science Fiction, Horror, Mystery, Alternativweltgeschichten, Bizarro, Slipstream und eben auch Fantasy lesen, ließe es sich so zusammenfassen: "Schwarzes Prisma" ist ein vollkommen durchschnittlicher Fantasy-Roman, der auf Total-Immersion setzt. Und die muss offenbar raumgreifend angelegt sein, um anderweitige Unterhaltungsmöglichkeiten vergessen zu lassen; 800 Seiten Länge sollten daher nicht verwundern. Zumal Gavin einmal eine volle Seite lang einen Fahrstuhlschacht hinunterfällt (und es ist nicht etwa so, als ziehe in dieser Zeit sein Leben an seinen Augen vorbei; er fällt nur). Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass Weeks' jüngste Schöpfung noch mehr zu bieten haben könnte: So hat das Reich des Prismas durchaus seine Schattenseiten - von der Sklavenhalterei bis zur Euthanasie an ausgedienten Wandlern - und der auftretende Feind, wer weiß, zeigt vielleicht noch einen alternativen Gesellschaftsentwurf auf. Das werden dann die kommenden Teile beweisen müssen; für 2012 ist unter dem Titel "The Blinding Knife" die Fortsetzung angekündigt.

Dean Koontz: "Die Unbekannten"
Broschiert, 431 Seiten, € 9,30, Heyne 2011
Ein Mann ist mit seinem Hund in der Wildnis unterwegs und stößt dabei auf zwei großäugige Gnome, die wie eine Mischung aus Primaten und aufrecht gehenden Katzen aussehen. Bald darauf tauchen diese auch in seinem Haus auf und erweisen sich als erstaunlich intelligent. Nanu, sind wir etwa wieder bei John Scalzi und den Fuzzys angelangt? Es ist einer dieser merkwürdigen Zufälle, die zwei Bücher in derselben Rundschau zusammengeführt haben, welche beide das gleiche unerhörte Ereignis zum Ausgangspunkt nehmen - um dann aber natürlich gänzlich unterschiedliche Geschichten daraus zu spinnen. Die Prämisse von "Die Unbekannten" (im Original 2009 als "Breathless" veröffentlicht) mag Altfans von Dean Koontz an dessen Erfolgsroman "Watchers" ("Brandzeichen") erinnern, in dem es um Hunde ging, die durch Gen-Manipulation menschliche Intelligenz erlangt hatten. Auch von diesem Plot wird sich "Die Unbekannten" aber bald entfernen ... wohin es das Buch dann treibt, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt.
Kein fremder Planet ist also der Schauplatz, sondern ein ländliches Kaff in Colorado, wo der Tischler Grady Adams mit seinem Hund Merlin lebt und eines schönen Tages auf die possierlichen Fremdwesen trifft, die er in keinem Zoologie-Buch finden kann. Seine Bekannte Cammy Rivers, die örtliche Tierärztin, staunt derweil über andere Phänomene mit Faunen-Bezug: Zweimal erlebt sie mit, wie Gruppen von Tieren in eine Art Trance verfallen. Die dritte Hauptperson des Romans ist Henry Rouvrey, ein ehemaliger Angehöriger des militärisch-industriellen Komplexes von Washington, der sich nun offenbar auf der Flucht befindet. Er schleicht sich in der Farm seines Zwillingsbruders ein, um diesen zu töten und in seine Rolle zu schlüpfen. Des weiteren werden noch einige Nebenfiguren - jeder mit einem persönlichen Mysterium versehen und weitab von Colorado unterwegs - sukzessive in die Handlung eingeflochten: So der Gelegenheitskriminelle Tom Bigger, der ein Transzendenz-Erlebnis zu verdauen hat, und der Chaosforscher Lamar Woolsey, der sein mathematisches Talent dafür nutzt, serienweise in Casinos abzucashen (und das Geld anschließend an Bedürftige zu verschenken).
Koontz wartet mit so mancher Überraschung auf. So ist gleich zu Beginn des Subplots um Henry von "Vorahnungen" und "unbestimmter Furcht" usw. die Rede und man denkt noch: Oh nein, bitte nicht schon wieder Schrecken behaupten statt erzeugen, das ist so elegant wie ein Rhinozeros beim Tangotanzen ... doch gleich darauf erweisen sich Henrys Intuitionen als Täuschungsmanöver seitens des Autors. Spielt Koontz etwa mit Stilmitteln, die er selbst manchmal schon im Übermaß eingesetzt hat? Fast ist man geneigt es zu glauben, zeigt er sich später doch sogar von einer unerwartet komischen Seite, wenn er Henry in eine paradoxe Gedankenschleife jagt: Erwarte das Unerwartete. Denke das Undenkbare. Er versuchte, sich etwas Undenkbares einfallen zu lassen, damit er darüber nachdenken konnte.
Blickt man unter die Oberfläche, regt sich auch im längeren guten Teil des Romans schon einiges Ärgerliche - speziell wenn Koontz subtil ins Ideologische geht. Natürlich haben Grady und sein ehemaliger Scharfschützenkollege in ihrer Zeit im Irak nur "Terroristen und Massenmörder" abgeschossen, was läuft da auch sonst rum. Bezeichnend auch, dass es der Psychopath Henry ist, der das gesamte moderne Geistesleben von Marx bis Madonna intus hat, während sich die beiden positiv besetzten Charaktere von der Welt abgewandt haben: Grady schnitzt seine Möbel, Cammy hält Tiere für vertrauenswürdiger als Menschen. Das ist zumindest hinterfragbar - auf gar keine Kuhhaut mehr geht dann allerdings der haarsträubende Mumpitz, den "Wissenschafter" Lamar zur Evolution, dem Universum und dem ganzen Rest verzapft: Im besten Verschwörungstheoretikerstil werden da ganze Forschungsdisziplinen mit einer Handbewegung zur Seite gewischt.
... aber das ist gar kein so großes Problem, denn der Roman schreitet flott voran, ist - auf vergleichsweise unblutige Weise - spannend und wirft mit der Zeit immer lauter die Frage auf, wohin das alles nur führen mag. Die Plotlinien um Grady und Cammy lassen sich gedanklich früh verbinden. Die Geschichte um Henry jedoch, der zwei Leichen im Keller hat und in Paranoia verfällt, als diese verschwinden, scheint nicht nur einem anderen Buch, sondern sogar einem ganz anderen Genre anzugehören. Und was ist eigentlich mit den apokalyptischen Unruhen, die Henry für die nahe Zukunft voraussieht und wegen derer er überhaupt erst auf seine Wechselbalg-Aktion verfallen ist? Rätsel über Rätsel, und spätestens nach 300 Seiten war ich mir sicher, dass "Die Unsichtbaren" nur der erste Band eines Mehrteilers sein kann; anders ließe sich das großmaßstäbliche Mosaik gar nicht mehr zusammensetzen. - Doch so ist es nicht. Mein Tipp daher: Das Buch bis Seite 380 lesen und es sich dann von irgendjemandem stehlen lassen. Dann kann man sich für den Rest seiner Tage in der angenehmen Ungewissheit wiegen, was wohl aus diesem unerwartet leichtherzigen Mystery-Roman eines ehemaligen Horror-Autors geworden sein mag; das Buch hatte doch echt Potenzial.
Wer diese Marke allerdings überschreitet, der weiß, was draus geworden ist - und dieses Wissen wird ihn nicht glücklicher machen. Denn er wird dabei nicht nur auf die Antiklimax des Jahres stoßen, sondern auch verstehen, warum jetzt ein Satz folgt, der in der Rundschau vermutlich noch nie gefallen ist: Das Buch ist zu kurz. Es ist vollkommen rätselhaft, was Koontz dazu veranlasst hat, das Buch so enden zu lassen, wie es das eben tut - meine einzige Erklärung dafür ist, dass er einfach die Lust daran verloren hat. Als hätte Tolkien gefunden, dass eine Trilogie vielleicht doch keine so prickelnde Idee sei, und am Ende von "Die Gefährten" geschrieben: Aber später treffen sie sich alle wieder, nachdem Frodo den Ring eingeschmolzen hat. Eine Portion Fassungslosigkeit ist da durchaus angebracht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mich ein Buch, das in derart spektakulärer Weise Schiffbruch erleidet, immer noch weit, weit, weit mehr unterhält als die gediegene Formelerfüllung eines Brent Weeks, der man nur deshalb null Fehler attestieren kann, weil sie null Risiken eingeht. Schlecht ist immer noch tausendmal besser als langweilig.
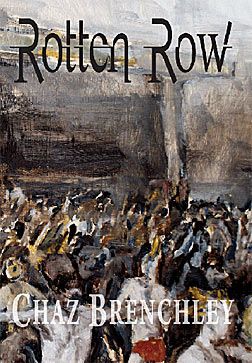
Chaz Brenchley: "Rotten Row"
Gebundene Ausgabe, 139 Seiten, PS Publishing 2011
Zum Abschluss dieser Rundschau noch zwei aktuelle SF-Novellen mit sehr unterschiedlichen Themen; erst mal die bessere. Den Briten Chaz Brenchley kennt man eigentlich eher als Fantasy-Autor. Auf Deutsch erschien im vergangenen Jahrzehnt die "Kreuzfahrer"-Reihe, 2010 kam das unter dem Pseudonym Daniel Fox veröffentlichte "Geschmiedet in Feuer und Magie" dazu, das trotz oder wegen seiner Originalität leider ohne Fortsetzung blieb. Im Original wurde die Trilogie, die in einem mythologischen alten China spielt, heuer abgeschlossen. "Rotten Row" hingegen ist SF pur und geht da in die Tiefe, wo Iain Banks' "Kultur"-Romane so unbeschwert über die Oberfläche peppeln, wie die Angehörigen ebendieser "Kultur" ihr ganzes Leben verbringen. Achtung: Der nächste Absatz dreht sich um den gesellschaftlich-technologischen Hintergrund von Brenchleys SF-Welt, die sich auf den ersten Seiten der Novelle als verwirrendes Kaleidoskop präsentiert. Wer sich das Vergnügen des Sich-selbst-Zurechtfindens nicht nehmen lassen will (etwas, das Nicht-GenreleserInnen kaum nachvollziehen können - it's not a bug, it's a feature!), der kann ihn einfach überspringen.
Brenchley skizziert eine interstellare Zivilisation, die sich in downsiders (planetengebunden lebende, "normale" Menschen) und - großgeschrieben - die Upshot gliedert. Letztere haben ihren Körper hinter sich gelassen, um zwischen den Sternen reisen zu können. Ihr Ich - mind - or soul, or personality, whatever it is that we Upshot are - wird in Form eines Datenpakets übertragen, um am Zielort einem bereitliegenden Zuchtkörper implantiert zu werden. Den bewohnen sie so lange, bis sie weiterziehen, danach wird der Einwegkörper eingeäschert: Eine Vorsichtsmaßnahme der streng regulierten und etwas paranoiden Upshot-Gemeinde; so soll verhindert werden, dass ein fremder Geist in einem vertrauten Körper das Umfeld von dessen ehemaligem Bewohner narrt. Aus demselben Grund lautet eine weitere Regel, dass die Zuchtkörper nach dem Zufallsprinzip vergeben werden. Niemals können die Upshot bestimmen, in welchem Körper sie landen werden; nicht einmal in welchem Geschlecht. Es ist nicht das erste Mal, dass Brenchley Gender-Themen anspricht, aber hier geht er in die Vollen.
Vom Protagonisten erfahren wir nur den Nachnamen - duLaine -, und da in der Novelle die Zusammenhänge zwischen Körperlichkeit und Identität in vielfältiger Weise ausgelotet werden, braucht es auch nicht mehr: The name goes with the body. Ein "Immersionskünstler" ist er, jemand, der seine Umgebung in sich aufsaugt und anschließend seine Eindrücke in einem Kunstwerk kondensiert. Und jetzt hat er sich die spektakulärste und zugleich verpönteste Umgebung ausgesucht, die die Galaxis zu bieten hat: Rotten Row, ein orbitales Rad um irgendeinen toten Planeten, dessen BewohnerInnen sich keinen Deut um die Regeln der galaktischen Gesellschaft scheren. Sie suchen sich nicht nur ihre Körper selbst aus, sie verändern sie auch in vielfältigster Weise. In unserer Welt kennt man vielleicht die französische Body-Art-Performerin Orlan, die ihr Gesicht einer Reihe plastischer Operationen unterzogen hat, oder den britischen "Leopardenmann" Tom Leppard. In Rotten Row jedoch ist die Umgestaltung des Körpers kein Fall für exzentrische Individuen, sondern gesellschaftlicher Konsens. Und geht dank der vorhandenen Technologie natürlich weit über das heute vorstellbare Maß hinaus: Die Hauptstraße von Rotten Row ist Schauplatz einer rund um die Uhr stattfindenden Parade, in der die BürgerInnen ihre bizarr-schönen neuen Körper nur um ihrer selbst willen zur Schau stellen: Sie sind die Kunstwerke ihres eigenen Lebens.
Auch Iain Banks lässt seine ProtagonistInnen ja gerne die Hüllen wechseln - da zeigt sich schon mal einer als brennender Dornbusch. Allerdings sind sie genau das: Hüllen, ohne Wechselwirkung mit der "wahren" Person, die jeden körperlichen Wandel innerlich unverändert übersteht - eigentlich eine recht altmodische Vorstellung. Das ist bei Brenchley, der Banks' beiläufig angeführtes Motiv in seiner Novelle in den Mittelpunkt rückt und daher auch genauer unter die Lupe nehmen muss, nicht so: Es beginnt mit den subtilen Veränderungen, die duLaines Bewusstsein erlebt, als es in einen Körper upgeloadet wird, an dessen Hormonbalance und physische Parameter es sich erst gewöhnen muss - so wie bei jedem Upload davor. Und das alles wird letztlich in ein vielleicht ein wenig überhastetes, aber folgerichtig grimmiges Finale münden. Dazwischen liegen jede Menge Tabubrüche und neue Erfahrungen. Der Besucher wird miterleben, wie Nebenfiguren mit ihrer menschlichen Form auch ihre menschlichen Interaktionsmöglichkeiten verlieren (wie spricht ein Dornbusch eigentlich, wenn es schon ein "Vogelmann" nicht mehr kann?). Und er bekommt vom Autor vorexerziert, welche Möglichkeiten der Zentaurenkörper von duLaines einheimischer Führerin Mel-2 bietet. Ich sage nur: Sex. Verdauung großer Nahrungsmengen. Vergorene Stutenmilch.
Letztlich beeinflusst das Thema Körperlichkeit sogar die äußere Handlung, in der duLaine in eine Verschwörung gerät. Er weiß, dass die Anziehung, die er bzw. sein Touristenkörper für Mel empfindet, durch Designer-Hormone verstärkt wurde. Und er nimmt zur Kenntnis, dass dieser Körper hormonell darauf angelegt ist, einem Gruppenkonsens zuzustimmen (wodurch er sich überhaupt erst in den Verschwörerzirkel hineinziehen lässt und sich dessen Aktionen anschließt). Doch Emotionen verschwinden nicht automatisch, wenn man ihren Ursprung kennt. Mel sieht es pragmatisch: Egal, ob sie dauernden Hunger verspürt, weil der Pferdeteil ihres Körpers großen Nahrungsbedarf hat, oder weil man ihr das Hungergefühl sicherheitshalber genetisch aufgeprägt hat, um diesen Körper nicht verkommen zu lassen - sie hat Hunger. Also isst sie.
Hinter dem vielleicht hässlichsten Buchcover des Jahres verbirgt sich somit ein faszinierendes Gedankenspiel - und irgendwie passt dieser Kontrast ja ganz gut zum Thema. Kurz: Sehr lesenswert!
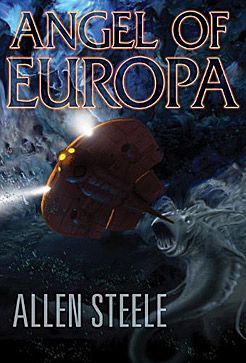
Allen Steele: "Angel of Europa"
Gebundene Ausgabe, 96 Seiten, Subterranean Press 2011
Allen Steele hab ich hier anlässlich des Romans "Hex" aus seiner erfolgreichen "Coyote"-Reihe vorgestellt. Die größten Lorbeeren hat Steele bislang aber im Novellen-Format eingeheimst: Nicht nur "Der Tod von Captain Future" wurde einst mit dem "Hugo" ausgezeichnet, drei Jahre später gab's den Preis für "...Where Angels Fear to Tread" erneut, und seit heuer hat Steele für "The Emperor of Mars" den dritten Novellen-"Hugo" im Regal stehen. "Angel of Europa" ist die jüngste Veröffentlichung des produktiven Autors, und so langsam zeichnet sich damit auch ab, was er kann (und was nicht).
Begeben wir uns also ins frühe 22. Jahrhundert und fliegen mit der internationalen Crew der "Zeus Explorer" zum Jupitermond Europa, unter dessen Eispanzer ein Ozean liegt, der zumindest in der Welt der Novelle - und vielleicht ja auch wirklich - vor Leben nur so wimmelt. Crewmitglied Otto Danzig hat die eigentliche Ankunft im Jupitersystem verschlafen - keineswegs freiwillig allerdings, denn zu Beginn der Erzählung fiel er beinahe einem mysteriösen Schleusenunfall zum Opfer. Nachtigall ick hör dir trapsen ... Nun wird Otto aus dem Regenerationsschlaf geholt, denn in der Zwischenzeit gab es einen weiteren Vorfall, und der hat Todesopfer gefordert. Zwei Wissenschafter, die mit einem Bathyscaph in Europas Tiefen hinuntergelassen wurden, starben - und Otto, der an Bord der "Zeus Explorer" als Schlichter bzw. Schiedsrichter fungiert, soll nun rekonstruieren, wie das geschehen konnte.
Die Konstellation ist denkbar einfach: Evangeline Chatelain, die Pilotin des Bathyscaphs, klinkte die Kabine mitsamt den beiden Passagieren aus, weil sie angeblich von einem riesenhaften Meereswesen angegriffen wurden und diese Maßnahme ihre einzige Möglichkeit war, wenigstens sich selbst zu retten. Bloß glauben ihr das nicht alle, und am allerwenigsten tun es die übrigen Frauen der Crew. Denn bislang konnte man nur primitive und kleinwüchsige Lebensformen im Ozean Europas entdecken, aber keine riesigen Räuber. Außerdem hatte Evangeline - an angel a man would worship upon silk sheets, her body a temple, her eyes the gates to heaven (mit anderen Worten: eine vollbusige blauäugige Blondine ohne BH) - mit beiden Wissenschaftern eine Affäre gehabt: Motiv genug für einen möglichen Doppelmord. Für Otto stellt sich damit die Frage, ob er es mit einem Verbrechen oder einer wissenschaftlichen Sensation unter tragischen Umständen zu tun hat. Und wenn er schließlich zur Aufklärung selbst mit Evangeline in den Ozean abtaucht - wird er dann eine unheimliche Begegnung mit einem außerirdischen Monster oder mit der Libido haben?
"Angel of Europa" ist ein solider Weltraumkrimi, dem es ein wenig schmeichelt, dass er eine eigene Buchbindung erhalten hat. Aber genau das bietet Steele eben: Solide Unterhaltung ohne Fisimatenten. Ich staune weiterhin, dass seine "Coyote"-Romane noch keinen deutschen Verlag gefunden haben; sie bieten sich als kleinster (oder größter?) gemeinsamer Nenner für alle, die Weltraumabenteuer lieben, ausdrücklich an. Abschließend noch ein Highlight aus "Angel of Europa", wenn auch kein beabsichtigtes: Einmal führt Otto mit einem Landsmann einen Dialog auf *hüstel* Deutsch, den würde ich gerne in voller Länge bringen. "Wen wire in Minute erhalten, mochte ich Sie treffen. Jose und Yvonne, auch ... in privatatum." - "Ich dacht, dass Sie wurden. Ich habe die um um anderen gebetum, um uns Konferenzsall in einer ungefahr Stunde zu treffen." - "Danke. Ich schatze es." So werden sich unsere Enkel also 2112 zu einem Meeting einfinden. Um um!
Die letzte Rundschau für heuer wird noch vor Weihnachten rausgehen; es sind ja wirklich immer ein paar verzweifelt genug, sich mit Last-Minute-Tipps im Kopf durch das Meer der Shopping-Zombies zu kämpfen. Noch ist die Titelliste offen - aber hoffentlich kommt die Anthologie zum Fliegenden Spaghettimonster rechtzeitig, es wäre so schön passend besinnlich! (Josefson)