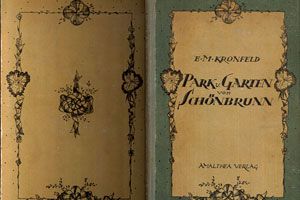
Eines der Bücher von Kronfeld über Schönbrunn.
Wien - Ernst Moriz Kronfeld, 1865 geboren, war nicht nur Theaterkritiker und Schriftleiter bei mehreren Wiener Zeitungen und Vorstandsmitglied der Concordia, sondern auch Botaniker und leidenschaftlicher Sammler. In den 1890er-Jahren trat er dafür ein, dass Frauen Medizin studieren dürfen, aufgrund der knappen Lebensmittel während des Ersten Weltkriegs veröffentlichte er Tipps zur Nutzung wildwachsender Gemüse. Er schrieb zudem Bücher über Pflanzen und deren Verwendung in der Medizin, er hielt Vorträge in der Urania, und sein ganz besonders Augenmerk galt dem Garten von Schönbrunn, zu dem er die größte Sammlung von Büchern, Bildern, Urkunden, Zeichnungen und Plänen hatte.
Spätestens 1940 versuchte er, seine Schönbrunnensia zu verkaufen, um die Flucht für sich und seine Familie finanzieren zu können. Der Antiquar Rudolf Engel bot sie der Nationalbibliothek an, aber diese war nur an Handschriften der Botaniker Franz Boos und Nicolaus von Jacquin interessiert. Die dafür gebotene Summe - lächerliche 100 Reichsmark - waren Kronfeld zu wenig.
Im Oktober 1941 erfuhr er, mittlerweile 77 Jahre alt, dass er zusammen mit seiner Frau nach Polen deportiert werde. Er wandte sich hilfesuchend an mehrere einflussreiche Menschen. Fritz Knoll, Rektor der Uni Wien, unterließ es, sich für den alten Herrn zu verwenden, aber eine unbekannte Person tat es - mit Erfolg. Kronfeld starb wenige Monate später, am 16. März 1942, zu Hause.
Seine Frau und seine Schwägerin wurden wenig später nach Treblinka transportiert und dort ermordet. Im November 1942 bot Antiquar Engel der Nationalbibliothek erneut Teile der Sammlung an - um 2500 Reichsmark. Sie kaufte aber nur die Handschriften.
Was mit den weiteren Konvoluten passierte, konnte die Provenienzforscherin Claudia Spring nicht in allen Einzelheiten ausfindig machen. Sie gingen jedenfalls - zum Teil nach dem Krieg über das Antiquariat Walter Krieg - an mehrere Institutionen: an das Theatermuseum, die Wien-Bibliothek, das Wien-Museum, das Naturhistorische Museum, die Bibliothek der Bundesgärten, das Schloss Schönbrunn und die Universität Köln.
Bezüglich der Konvolute in der ÖNB, im NHM, in der Wien-Bibliothek, im Wien-Museum und bei den Bundesgärten sprachen die Beiräte in den letzten Jahren Rückgabeempfehlungen aus. Eine solche hinsichtlich des Theatermuseums wird wohl noch folgen.
Die Schloss Schönbrunn Kultur- und BetriebsgmbH unterliegt - wie die Privatstiftung Leopold - nicht dem Rückgabegesetz. Dennoch ließen die beiden Geschäftsführer Wolfgang Kippes und Franz Sattlecker den Fall vom Rückgabebeirat prüfen. Sie werden die Kronfeld-Konvolute, 1993 erworben, nun zurückgeben. Eine solche Haltung würde man sich auch von anderen wünschen. (Thomas Trenkler, DER STANDARD/Printausgabe 11. Jänner 2012)