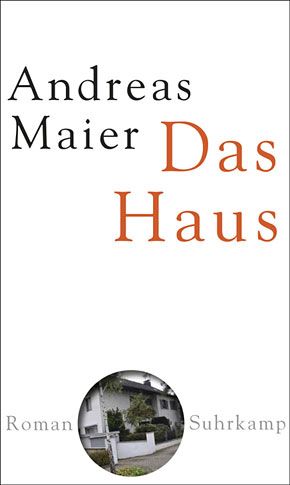
Andreas Maier: "Das Haus", € 17,95 / 164 S., Suhrkamp 2011
Wien - Die Veränderungen im Umland von Bad Nauheim sind bloß mit dem Mikroskop zu erfassen. In den Frühkindheitstagen des 1967 geborenen Heimatdichters Andreas Maiers rollt die zweite, nachhaltige Wohlstandswelle über die hessische Kleinstadt hinweg. Die wachsenden Familien drängen in adrette Eigenheime, aus deren Fenstern man auf die Ufer der Usa blickt. Das Herz der Häuser bilden pompöse Treppenaufgänge und mächtige Kellerstiegen, einschüchternde Gebilde für einen unerklärlich verängstigten Dreikäsehoch.
"Problemandreas" nennt sich der Held in Maiers Roman Das Haus, mit dem ein ehrgeiziges, über die Länge von elf Teilen erstrecktes Erzählprojekt in die vorderhand zweite Runde geht. Nichts an der kleinstädtischen Idylle mit ihren Mercedes-Fahrzeugen und ihren Cervelatwurstbroten scheint dazu angetan, ein Kind, und sei es noch so sensibel, in die Isolation zu stürzen. Mit guten, nachträglich ersonnenen Argumenten ist der Verstörung von "Problemandreas" in Wahrheit nicht beizukommen. Maier, der seine Kindheit weniger erinnert als sie aus Partikeln der Irritation neu zusammensetzt, entdeckt einen metaphysischen Riss. Dieser reicht quer durch die Vorgärten und wenig befahrenen Straßen, er erschüttert die einfachsten Gewissheiten und spaltet prompt den Boden unter Andreas' Füßen.
Fiasko Kindergarten
Der Bub will einfach nicht verstehen, dass er sozial zu sein hat. Das an der Schwelle zum Bewusstsein balancierende Alter Ego des Autors kann nicht begreifen, dass man Erwartungen an es richtet. Die erste Kindergartentag: ein Fiasko. Der arme Tropf steht mutterseelenallein im Kreise seiner Altersgenossen, er sieht, mehr noch erstaunt als angewidert, wie die schreiende Horde "kommuniziert und interagiert". Das Projekt Kindergarten wird eilends abgebrochen. Von nun an sitzt Andreas, so oft er kann, im Bastelkeller, baut Kriegsflugzeugmodelle und verliert jedes Gefühl für Zeit.
Es gehört zu den zahlreichen Vorzügen von Maiers Roman, dass er die Tragödie der kindlichen Untröstlichkeit an keinerlei Anomalie befestigt. Ärzte beugen sich über den Buben, können jedoch kein Gebrechen entdecken. Die kindlich-magische Welt dieses verstockten Neinsagers enthüllt ein Schwindelgefühl, das man in der Schwarzwald-Prosa Martin Heideggers vielleicht mit "Geworfenheit" übersetzt hätte.
Aber Maier leistet mehr als bloß die geläufige Kritik am Ungeist des "Schaffe, schaffe, Häusle baue". Noch in den abgesichertsten Bereichen unserer Wohlstandszonen finden sich Leerräume, die mit keinem Angebot zur Teilhabe künstlich zu besiedeln sind. Mehr noch: Es gibt tatsächlich ein Erlebnis von Ungeborgenheit, und dieses hängt in keiner Weise von den Repressionen einer Gesellschaft ab, die ihre gewalttätigen Teile versteckt, für alle möglichen Problemlagen Verständnis heuchelt.
Maiers geduldige Beschreibungsprosa wahrt eine Unentschiedenheit, die den Leser unausgesetzt zur Ergänzung, zur Besetzung von Leerstellen auffordert: Ist es jetzt der widerspenstige Andreas von 1975, dem ein monströser Kloß den Hals versperrt, bloß weil er wie Millionen andere in die Schule gehen soll? Oder erfindet der Autor Maier bloß nachträglich eine Welt, die an ihrer Unfähigkeit krankt, das Verhältnis von Distanz und Nähe wirksam zu bestimmen?
Maiers Sprache enthält sich klug eines nachgereichten Kommentars. Sie schmerzt in ihrer nüchternen Klarheit und macht das Gewimmel der mit sich und ihrer Wohllebigkeit überforderten Menschen zu einem unvergesslichen Erlebnis: "Vor meinen Augen verwandelten sich diese Menschen in Handlungsautomaten." Mehr Handlung braucht es nicht. (Ronald Pohl, DER STANDARD/Printausgabe 1.2.2012)