Der Zufall lauert an jeder Ecke: auf der Straße, im Wald ebenso wie in Archiven und Bibliotheken. Ihn zu erhaschen braucht Zeit, Muße und den Mut zum Irrtum. Dann kann er zu unerwarteten Entdeckungen führen. Karin Krichmayr hörte sich unter Forscherinnen und Forschern um, was der Zufall für sie bedeutet und wie er ihnen ins Netz gegangen ist.

Silvia Miksch, Informatikerin (TU Wien)
Ich habe nach meinem Doktorat zufällig einen ehemaligen Professor auf der Straße getroffen, und er hat mir eine Stelle für acht Monate angeboten. Ich habe sie angenommen, obwohl ich schon ein Jobangebot in der Wirtschaft hatte. Seitdem bin ich in der Forschung tätig.
Ich denke, Zufall spielt auch eine Rolle dabei, ob ein Paper akzeptiert wird oder nicht. Bei prestigeträchtigen Konferenzen liegt die Akzeptanzrate bei zehn bis 20 Prozent, und die Gutachter haben immer mehr zu tun. Das Gleiche gilt auch für Projektanträge und Bewerbungen für Professuren. Es ist auch relativ zufällig, mit welchen Menschen man in Kontakt kommt, wer offen ist für die eigenen Themen. Auf einer riesigen Konferenz habe ich zufällig Ben Shneiderman, einen Guru in Human-Computer-Interaction, kennengelernt, nur weil ich mich umgedreht habe und er hinter mir gegangen ist. So bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, und wir sind in Kontakt geblieben. Das hat auch Spuren in meiner Arbeit hinterlassen. Auch die kleinen Zufälle können viel ausmachen.

Thomas Bugnyar, Verhaltensbiologe (Uni Wien und Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Grünau)
Es war ein Zufall, dass ich überhaupt zur Kognitionsbiologie gekommen bin. Im ersten Semester an der Uni war ich zufällig im Sekretariat, als Unterschriftensammler für das Konrad-Lorenz-Institut gesucht wurden. So bin ich dort gelandet. Auch zur Arbeit mit Raben kam ich zufällig: Zwei meiner besten Studienkollegen haben Raben aufgezogen, und ich war überrascht, wie rege und flexibel sie waren. Das hat einen gewissen Eindruck gemacht. Dazu kam ein weiterer Zufall. Ich habe mein Studium mit einer Diplomarbeit zum Verhalten von Affen abgeschlossen und wollte auch dabei bleiben. Nach der Diplomprüfung hat mich mein Zweitprüfer und späterer Dissertationsbetreuer Kurt Kotrschal so nebenbei gefragt, ob ich nicht mit Raben arbeiten mag, die seien auch nicht anders als Affen, nur dass sie herumfliegen. Das habe ich zuerst nicht ernst genommen. Nach ein paar Wochen war ich dann einverstanden.
Bei meiner Arbeit mit Raben passiert es ständig, dass etwas herauskommt, womit ich nicht gerechnet habe. Als ich als Postdoc in den USA war, wurden gerade die Käfige umgebaut. Am Ende eines Tages habe ich mich umgedreht, um zu sehen, ob hinter einer Wand noch Werkzeug liegt. Da habe ich bemerkt, dass ein Rabe hinfliegt und genau in dieselbe Richtung schaut wie ich. Er hat sich offensichtlich an meiner Blickorientierung ausgerichtet und verstanden, dass ich hinter die Barriere geschaut habe. Dann ist er gezielt hinter die Barriere geflogen. Aus diesem Zufallserlebnis ist eine Versuchsanordnung für Blickfolgen von Raben entstanden, auf der eine Reihe von Arbeiten basiert.
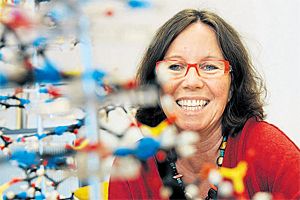
Renée Schroeder, Molekularbiologin, Wittgenstein-Preisträgerin (Max F. Perutz Laboratories)
Der Zufall spielt in der Grundlagenforschung eine wichtige Rolle: Dabei sollte ja nie von vornherein festgelegt werden, welches Ergebnis wann vorliegt. Die Wissenschaft muss auch durch finanzielle Mittel die Freiheit haben, sich irren zu dürfen und dabei vielleicht auf Dinge zu stoßen, an die sie anfangs nicht gedacht hat, die möglicherweise ein ganz anderes Problem lösen. Sie muss diese Chance aber auch erkennen. Meine Studenten sind oft ganz verzweifelt, wenn sich im Labor nicht bestätigen lässt, was sie davor in der Theorie für logisch gehalten haben. Ich sage dann immer, dass das ja gerade das Spannende ist, nur so entdeckt man Neues.
Die Natur ist eine Anhäufung von Zufällen. Ein Zusammenspiel von Elementen, die durch ihre enorm hohe Anzahl ein komplexes Gesamtbild ergeben. Einstein hat einmal gemeint: Gott würfelt nicht. Ich sehe das genau umgekehrt, da ich nicht an einen Designer- oder Würflergott glaube. Gewürfelt wird sehr wohl: Die Natur würfelt selbst.
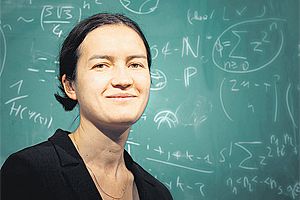
Goulnara Arzhantseva, Mathematikerin (Uni Wien), Foto: Arnold Poeschl
In der Mathematik gibt es für den abstrakten Begriff Zufall mehrere Interpretationen. Er kann sich auf die Möglichkeit beziehen, dass mathematische Strukturen oder Objekte in einer bestimmten wechselseitigen Beziehung zueinander stehen. Andererseits kann damit das einheitliche Verhalten zufällig gewählter Elemente (etwa Punkte auf einer Fläche) bezeichnet werden. Die Entdeckung einer solchen Beziehung oder eines solchen Verhaltens gilt als etwas sehr Schönes und nicht als abnormales Phänomen. Deshalb sind Mathematiker immer auf der Suche nach dem Zufall.
Ich erforsche Gruppen, also abstrakte algebraische Strukturen, die Symmetrien beschreiben – und damit die Harmonie und den Charme der Welt. Sie werden etwa zum Verständnis physikalischer Phänomene eingesetzt, in der Kryptografie oder zur Untersuchung von DNA-Sequenzen. In meinem vom European Research Council (ERC) finanzierten Projekt beschäftige ich mit unendlichen Gruppen. Zufall spielt hier in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Erstens, um Eigenschaften zu entdecken, die von den meisten unendlichen Gruppen geteilt werden. Und zweitens, um neue unendliche Gruppen mit überraschenden Eigenschaften zu erfinden. Mein Team und ich wollen ein Konzept der Zufälligkeit definieren, das Rückschlüsse darauf erlaubt, dass unendliche Gruppen mit den benötigten Eigenschaften mit positiver Wahrscheinlichkeit existieren.
Ich betrachte Intuition als einen Teil wissenschaftlicher Arbeit. Ich glaube, erfolgreiche Forscher improvisieren nicht, sondern können durch harte Arbeit, Beharrlichkeit und ein bisschen Talent vom Zufall profitieren.

Lutz Musner, Historiker (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften)
Zufälle sind nicht immer rein zufällig, es gibt immer Akkumulationen von Wissen, die bestimmte Entdeckungen wahrscheinlich werden lassen. Also ein unvorbereiteter Geist tut sich auch bei Zufallsentdeckungen schwer. Man braucht eine Art Fangvorrichtung, ein Netz von Fragen, in dem sich Zufälle verfangen können.
Das gilt auch für die Geisteswissenschaften, wo Bibliotheken und Archive die bevorzugten Orte des Zufalls sind. In Bibliothekssystemen, wo man Zugang zu den Magazinen hat und direkt in die Regale hineingehen kann, entdeckt man unter Umständen andere Bücher im Regal, die viel interessanter sind als das gesuchte. Viele Archive haben bei der Fülle des Materials nie eine vollständige Katalogisierung, dadurch ist ein Archiv immer ein Überraschungsraum. Ich forsche gerade über den Ersten Weltkrieg, und da finden sich in den Armeeakten auch Tagebücher, Briefe und persönliche Notizen. Das ist etwas, worauf ich spitze. Deswegen wird sich Forschung nie ganz auf digitalisierte Akten verlassen können. Denn das ersetzt den Besuch im Archiv nicht.
Um produktive Zufälle zu haben, braucht man Zeit, sich auch einmal im Material zu verlieren. Die Forschungsförderungseinrichtungen, sei es auf europäischer oder nationaler Ebene, schreiben jedoch vor, dass man Anträge sehr detailliert ausformulieren muss. Für Geistes- wie auch für Naturwissenschaften muss es Raum für Zufallsentdeckungen geben. Das ist das Salz in der Suppe. Das sollte man auch in der Ausbildung von Forscherinnen und Forschern betonen. Man sollte auch Umwege einplanen, die Zeit sollte man sich geben.

Edeltraud Hanappi-Egger, Organisationsforscherin (Wirtschaftsuniversität Wien)
Ich komme ursprünglich aus der Informatik. Dass ich jetzt eine Wirtschaftsprofessur an der WU innehabe, beruht auf zufälligen Weichenstellungen. Ich hatte im Zuge meiner Forschungsarbeiten zu sozialverträglicher Technikgestaltung realisiert, dass es ausgeprägte Geschlechterhierarchien in Organisationen gibt, als ich auf die Ausschreibung einer Professur für Gender und Diversity im Fach Betriebswirtschaft stieß. In diesem Sinne ist Zufall für mich die unerwartete und ungeplante Eröffnung von Möglichkeiten.
Es passiert immer wieder, dass ich plötzlich auf etwas aufmerksam werde und daraus dann die Begeisterung und die Ideen für Forschungsfragen ziehe. Das kann sein, wenn ich spazieren gehe, vor mich hin grüble oder ein spannendes Buch lese, und auf einmal "klingelt" es. Zufall braucht sicher auch Muße. Ich glaube daher, dass eine reine Output-Orientierung, die extreme Ökonomisierung und alleinige Exzellenzausrichtung in der Wissenschaft zu einer tendenziellen Abnahme der Kreativität und Innovationsfähigkeit führen und damit auch zu weniger Offenheit gegenüber dem Aufschnappen von zufälligen Gegebenheiten, gegenüber dem Erspüren von interessanten Dingen. Weil diese Ausrichtung oftmals ein sehr strategisches Verhalten erfordert und dies zum Verlust führen mag, auszuschöpfen, was der Zufall bietet.
(DER STANDARD, Printausgabe, 01.02.2012)