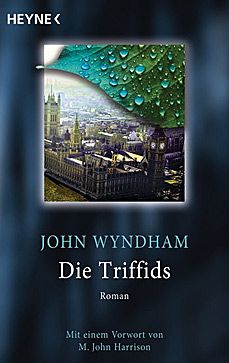
John Wyndham: "Die Triffids"
Kartoniert, 300 Seiten, € 9,30, Heyne 2012 (Original: "The Day of the Triffids", 1951)
Frühling ist's, die Triffids schlagen aus. Jetzt bitte all ihr Unglücklichen, die die jüngste Verfilmung auf Pro7 gesehen und gerade erst verdaut haben: Vergesst es. Der Roman ist viiiel besser. Dreimal ist John Wyndhams über 60 Jahre alter Klassiker bereits verfilmt worden (Was heißt "Klassiker"? Der hat seine eigene Zeile im Eröffnungssong der "Rocky Horror Show", das macht ihn mindestens zum Uberklassiker): Zum ersten Mal 1962 als Kinofilm, auf dem ... öhem ... vollen Stand der damaligen Tricktechnik und in der deutschen Version mit dem fantastisch hirnrissigen Verleihtitel "Blumen des Schreckens" zusätzlich belastet (das war natürlich das, worauf sich "And I really got hot when I saw Janette Scott fight a triffid that spits poison and kills ..." eigentlich bezog). Und dann noch zweimal als Mini-Serien der BBC, erst 1981 und dann eben in "modernisierter" Fassung 2009. Von den beiden ist die 1981er Version immer noch die bessere, obwohl - oder vielleicht auch weil - damals noch keine CGI zur Verfügung standen; so richtig überzeugend war aber auch die nicht. Vielleicht lässt sich etwas, das im Roman mal als wandelnde Mischung aus Sonnenblume, Steckrübe und Orchidee beschrieben wird, einfach nicht erschreckend genug inszenieren.
Die Handlung dürfte den meisten bekannt sein, hier nur eine Kurzfassung: Ein spektakuläres Leuchten am Himmel lässt globusweit die Menschen erblinden. Nur wer das Phänomen nicht sehen konnte oder wollte, hat sich das Augenlicht bewahrt. Wie Hauptfigur William Masen, der sich - Ironie, Ironie - in der entscheidenden Nacht in einem Londoner Krankenhaus von einer Augenoperation erholte. Während die Infrastruktur komplett zusammengebrochen ist und die wenigen Sehenden verzweifelt versuchen, den abertausenden Blinden beizustehen, ist Masen auch der erste, der vor der eigentlichen Gefahr warnt: Eben den Triffids, übermannsgroßen fleischfressenden Pflanzen, die man wegen ihres Öls auf eigenen Farmen züchtet. Biochemiker Masen hat auf einer solchen Farm gearbeitet und weiß, wie gefährlich die Triffids sind, da sie nicht nur tödliche Peitschenschläge mit einem Giftstachel austeilen können, sondern auf ihren Wurzeln auch noch mobil sind. Natürlich wird Masen aber erst ernstgenommen, als es längst zu spät ist und Millionen ausgebrochene Triffids in die Dörfer und Städte staksen, um sich an den hilflosen Blinden zu laben. Es bleibt nur noch die Flucht aufs Land und der Versuch, sich hinter Schutzwällen eine neue Zukunft aufzubauen.
Das mag jetzt bei manchen etwas zum Klingeln bringen - stumm herumschlurfende Menschenfresser und der Rückzug der Überlebenden in eine gut abgesicherte Trutzburg ... - und in der Tat gelten die Triffids als wichtige Einflussquelle für das moderne Zombie-Genre, also von George A. Romero an aufwärts. Wenn am Beginn von Danny Boyles "28 Days Later" Fahrradkurier Jim in einem Krankenhaus erwacht, ist das sogar ein direktes Zitat von Wyndhams Originalstoff. Der Ton war zu Wyndhams Zeiten allerdings noch ein deutlich anderer als bei den schwerbewaffneten, supertoughen Instant-Survivalisten, die uns das Genre heute als Vorbilder unterjubelt. Symbolisch dafür eine Passage im ersten Abschnitt des Romans, in der Masen mit einem Stein in der Hand vor einem Schaufenster steht und zögert, es einzuschmeißen. Zwar braucht er Nahrungsmittel - aber erst muss er sich dazu durchringen, die neuen Verhältnisse zu akzeptieren und die Schuldgefühle abzustreifen, dass er mit dem Steinwurf seinen kleinen Beitrag zum Untergang der Zivilisation leistet. Ähnliche Skrupel hegt zunächst auch die weibliche Hauptfigur, die Masen zur Seite gestellt wird: Josella Playton, eine junge Frau aus gutem Hause, die ein leicht skandalöses Erfolgsbuch geschrieben hat; offensichtlich eine Art "Feuchtgebiete" unter den Bedingungen der 50er Jahre. Damals war man ja noch zivilisiert.
Und diese gutstaatsbürgerliche Restwürde bewahrt man sich auch dann, wenn es ans Eingemachte geht. Also vor allem um die entsetzliche Frage, um wie viele Blinde man sich kümmern kann, wenn man selbst überlebensfähig bleiben will - und wie man unter diesen Bedingungen eine neue Zivilisation aufbaut. Zum Schmunzeln ist es dafür aus heutiger Sicht, wenn in typischem 50er-Jahre-Stil ein Soziologieprofessor auftritt und ganze zwei Tage nach der Katastrophe bereits einen Masterplan für die Gesellschaft der Zukunft aus der Hosentasche zieht. Vielweiberei inklusive, aber selbstverständlich streng seriös gemeint.
Die aktuelle deutschsprachige Ausgabe von "Die Triffids" ist eine merklich überarbeitete und vor allem ungekürzte Fassung der ursprünglichen Übersetzung. Dadurch fällt anders als z.B. in der Heyne-Ausgabe aus den frühen 80ern gleich auf der ersten Seite ein ganz zentraler Satz: "Dass ich das Ende der Welt verpasste [...], war schierer Zufall: wie Überleben es häufig ist, wenn man es genauer bedenkt." Masen bekennt im Roman seine klar biologistische Sicht der Welt, und wenn man John Wyndhams Romane insgesamt so Revue passieren lässt, wird man immer wieder auf das Motiv Biologie / Evolution / Angst vor der Ablösung durch eine neue Spezies stoßen. Fast noch bekannter als "The Day of the Triffids" ist "The Midwich Cuckoos", unter anderem von John Carpenter als "Dorf der Verdammten" verfilmt - in dem Fall ging die Bedrohung von gruseligen telepathisch begabten Kindern aus. In "The Web" waren es koloniebildende Spinnen, in "The Kraken Wakes" außerirdische Meeresbewohner - und in "The Chrysalids" wurde sogar versucht, die Evolution selbst zu stoppen.
Mal führt ein externer Faktor zur Katastrophe, öfter noch ist aber die Menschheit selbst schuld: Seien es Atomtests, die in "The Web" bei Spinnen eine kleine, aber folgenschwere Mutation auslösen, oder sei es die Nutzung der Triffids. Woher diese wirklich kommen, wird übrigens nie hundertprozentig geklärt, aber Wyndham ist ein Meister des Nahelegens. Er legt einem in Form von Masens Vermutungen nahe, dass es sich um künstliche Züchtungen handelt, die von Wirtschaftsspionen aus der Sowjetunion ausgeschmuggelt wurden. Und er legt einem nahe, dass das Leuchten am Himmel kein Meteorschauer war (und erst recht keine Sonneneruption wie in der jüngsten Verfilmung), sondern Teil einer satellitengesteuerten Biowaffe. Und er lässt bewusst offen, wessen Waffe. Die volle Wahrheit werden wir nie erfahren, ebensowenig wie Masen und seine Mitüberlebenden.
In der aktuellen Fassung sind auch einige Passagen enthalten, die man in der früheren Ausgabe wohl für unwesentlich hielt und rausgekürzt hat. Etwa ein melancholisches Lied, das die Hauptfiguren hören und auf dessen Text sie später anspielen werden. Oder der stille Doppelselbstmord eines jungen blinden Paars. Also Elemente, die vielleicht nicht die Handlung vorantreiben, die aber dazu beitragen, die Atmosphäre des Niedergangs zu verdeutlichen, in der sich die ProtagonistInnen bewegen. Das einzige, was der neuen Ausgabe im Vergleich zu der, die 1983 in der "Bibliothek der Science Fiction Literatur" erschien, fehlt, sind die Innenillustrationen. Aber vielleicht ist das ja auch gar kein Nachteil ... womit wir wieder beim Anfangsthema angelangt wären. Und ich muss wohl auch endgültig die Hoffnung begraben, von meinem Lieblingsmonster aller Zeiten irgendwann mal eine vernünftige Actionfigur zu bekommen.
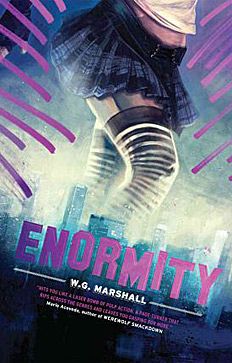
W. G. Marshall: "Enormity"
Broschiert, 270 Seiten, Night Shade Books 2012
It was a She, the thing that was coming - a She beyond all shes. A mega-Her beyond all dreams or imagining. A She-monster wreathed in rainclouds and forking lightning, faster than the waves and yet astronomically slow, her Hi-Top sneakers the size of battleships, her sky-high striped leggings dwarfing Catalina Island, The Pacific Ocean, the L.A. coastline, everything ... Wow, da hat sich jemand den Rat "Wenn du deinen ersten Roman schreibst, dann mach ihn GROSS" aber echt zu Herzen genommen. Im fantastischen, wahnsinnigen, supervergnüglichen "Enormity" stößt W. G. Marshall in Dimensionen vor, neben denen sich Godzilla wie ein hutzliger grüner Gnom ausnimmt. Und weil das Ganze mehr als nur eine Hommage an trashige B-Movies bzw. japanische Kaijū-Filme ist, wird der Debütroman des US-amerikanischen Autors derzeit auch überall mit Lorbeeren überschüttet. Da schmeiß ich gleich noch ein paar obendrauf.
In einem Prolog Marke Huch! dringen wir in einen skurrilen familiären Mikrokosmos ein, bestehend aus einem 26-Jährigen, der noch bei seinem Drachen von Mutter wohnt, selbiger und einem Nachbarn, der auf die Mutter scharf ist ... und sich vom Sohn breitschlagen lässt, als Adressat für eine Internet-Bestellung zu fungieren; von der Penisvergrößerungsausrüstung muss Mama schließlich nichts erfahren. Das Motiv der Vergrößerung, das später noch in allen möglichen und unmöglichen Varianten auftauchen wird, wäre damit gleich einmal elegant eingeführt - und wie sich zeigen wird, hängt diese Episode sogar mit der Haupthandlung zusammen. Die dreht sich allerdings um jemand anderen: Der Amerikaner Manny Lopes ist ein durch und durch unscheinbarer Zeitgenosse. Dass er seit einiger Zeit auf einer US-Militärbasis in Südkorea arbeitet, hat ihm auch nicht dabei geholfen, "seinen inneren James Bond zu entdecken"; stattdessen ist bloß seine Ehe aufgrund der Entfernung in die Brüche gegangen. Betrübt treibt er durch die Tage, unternimmt gelegentlich mal einen Ausflug mit seiner einzigen Freundin Karen Park, bis ...
... ja, bis er durch einen Zufall zu genau der Zeit an genau dem Ort ist, wo eine nordkoreanische Killerin, ein religiös verblendeter Überläufer aus den USA und eine quantenphysikalische Erfindung in verheerender Weise aufeinander treffen. Was daraufhin passiert, wird mit der Mutter aller Handwavings - einer vollen Seite physikalischen Kauderwelsches, das der Autor selbst in keinster Weise ernst nimmt - "erklärt". Wichtig ist aber ohnehin nur der Effekt: Manny wird künftig als Koloss von zwei Kilometern Höhe über die Erdoberfläche stapfen. Und wie sich etwas später zeigen wird, geht es besagter Killerin mit Namen Dorothy Lee nicht anders. Als wäre die - she was a hard-bodied go-go-doll with the head of Medusa - nicht vorher schon gruselig genug gewesen (Manny steht übrigens auf sowas ...).
Es folgen Szenen einer Annäherung an die Wahrheit aus verschiedenen Richtungen. Ganz im Stil eines "Big Dumb Object"-SF-Plots ist es geschrieben, wenn sich das Militär dem Epizentrum einer vorerst unbekannten Katastrophe von seismischen Ausmaßen nähert. Manny ist viel zu groß, um als Einheit wahrgenommen zu werden - so groß, dass er durch Atmung, Transpiration und Körperwärme die Atmosphäre durcheinander wirbelt und sich in seine eigene Sturmfront gehüllt hat. Vergnügt und mit dem Wissensvorsprung aus dem Klappentext ausgestattet verfolgen wir LeserInnen mit, wie sich die Einsatzkommandos durch eine "extraterrestrische" Landschaft von Haaren, Schweiß und Schuppen kämpfen und von bizarren Monstern - Bakterien und Milben - attackiert werden. Manny seinerseits rafft zunächst übrigens auch nichts. Er glaubt zu seinen Füßen eine Zivilisation intelligenter Insekten entdeckt zu haben und träumt schon von der Pressekonferenz, die er geben wird: "They're copying us. Mimicking our technology on a microscopic scale - incredible!" Bis ihm die Wahrheit dämmert, hat er leider schon ganze Landstriche zu Pulver zerstampft.
"Enormity" enthält einige zum Brüllen komische Passagen - etwa wenn sich die in Normalgröße verbliebene Karen irgendwo auf dem Körper des Giganten wiederfindet und die verzweifelten "Bitte halten Sie an!"-Anweisungen aus einem Hubschrauber auf sich bezieht, während Manny das Hochfrequenz-Gepiepse nicht einmal bemerkt. Oder wenn er ganz dringend pissen muss und nicht weiß, wohin er sich wenden kann, damit ihm niemand dabei zusieht ... Aber hier wechselt die Handlung bereits ins Tragikomische hinüber, und tatsächlich ist "Enormity" mehr als nur Klamauk (mit Millionen Toten, nebenbei bemerkt). Mögen sie auch bald mit kleinen Soldaten-Kolonien bevölkert und vom US-amerikanischen Militär respektive rachsüchtigen nordkoreanischen Altersheiminsassen(!) auf strategische Ziele zugesteuert werden, so bleiben die beiden Giganten Manny und Dorothy doch immer noch Menschen. Menschen mit sehr traurigen Lebensgeschichten und einer Zukunft, die mit einem Schlag so ungewiss geworden ist, dass darin vielleicht sogar eine Chance stecken könnte. Und als sie sich dessen bewusst werden, gerät das Geschehen endgültig aus den Fugen.
Durch seine tragischen Züge steht der Roman der 2007er Satire "Dainipponjin/Der Große Japaner" mindestens genauso nahe wie den klassischen Monsterfilmen selbst. "Gullivers Reisen" nennt W. G. Marshall als offensichtlichen Einfluss, man könnte aber auch - Stichwort todbringende Urinfluten - an dessen französischen Vorläufer François Rabelais und seinen Romanzyklus "Gargantua und Pantagruel" denken. Bud Spencers Lieblingsbuch, nebenbei bemerkt. Aber kulturgeschichtliche Querverweise mal außer Acht gelassen, "Enormity" ist alleine schon aufgrund der Sprache lesenswert. Durch ihre neue Größe lassen sich Dinge plötzlich mit Wörtern beschreiben - ein Seidenhöschen donnert wie eine Lawine zu Tal -, die einem sonst nie und nimmer dazu einfallen könnten. Und dieser so einfache Kniff funktioniert wieder und wieder und wieder, stets zu höchstgradig komischem Effekt. Ach ja, und noch etwas sei unbedingt erwähnt: Marshall schafft etwas, das wohl kaum noch jemand für möglich gehalten hätte - nämlich eine Sexszene so zu beschreiben, wie man es wirklich noch nicht gelesen hat. Hut ab! Der Roman der Stunde.

Marc Elsberg: "Blackout"
Gebundene Ausgabe, 799 Seiten, € 20,60, Blanvalet 2012
Dem Verbrechen ist er treu geblieben, nur in Sachen Schwere des Delikts hat der Wiener Krimi-Autor Marcus Rafelsberger unter dem Pseudonym Marc Elsberg nachgelegt, und zwar ganz erheblich: Immerhin werden in "Blackout. Morgen ist es zu spät" ganz Europa und bald darauf auch Nordamerika die Lichter abgedreht. Und während Untergangsromane in der Regel dazu angetan sind, mit wohligem Schaudern in sicherer und komfortabler Umgebung gelesen zu werden, macht einem Elsbergs Roman ebendiese Umgebung verdächtig - weil er ihre Abhängigkeit von einem einzigen Faktor, der Stromversorgung, in schwindelerregender Detailfülle demonstriert. Unsere tägliche Infrastruktur gib uns heute - sie ist bei weitem nicht so selbstverständlich, wie wir gerne denken. Falls wir überhaupt jemals darüber nachdenken.
Als wichtige Quelle für seinen Thriller nennt Elsberg den Bericht "Was bei einem Blackout geschieht: Folgen eines lang andauernden und großflächigen Stromausfalls" des deutschen Büros für Technikfolgen-Abschätzung, über den wir hier im vergangenen Jahr - außerhalb der belletristischen Parallelwelt - berichteten. Hier nur ein paar Aspekte, an die man beim Wort "Stromausfall" nicht gleich denkt und die im Roman allesamt ausgebreitet werden: Es verabschieden sich ja nicht nur Beleuchtung und HiFi-Geräte, auf dem Fuß folgen - Stichwort großflächig - Heizung, Zu- und Abwasserkreislauf, Kommunikationsnetze und das Transportwesen (ohne Strom laufen die Zapfanlagen von Tankstellen nicht). Was bald die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern unterbindet, deren Produktion parallel dazu ebenfalls zum Erliegen kommt. Und wenn - Stichwort langfristig - allmählich auch überall den individuellen Notstromaggregaten der Saft ausgeht, kommen auch noch Sicherheitsaspekte dazu, insbesondere was Industrieanlagen und Atomkraftwerke angeht. Von letzteren lässt Elsberg gleich mehrere in den GAU eintreten; auch weil er noch während des Schreibens von der Katastrophe in Fukushima überholt wurde.
Womit das Schreckensszenario übrigens immer noch nicht auf die Spitze getrieben ist, denn zwischendurch überlegt man in den europäischen Krisenstäben sogar, ob man nicht womöglich Opfer eines kriegerischen Akts geworden ist und vielleicht zurückschlagen sollte (bloß gegen wen?). Dass es überhaupt soweit kommt, dafür entwirft Elsberg einen mehrstufigen Akt des Cyberterrorismus. Eingeleitet wird er mit einem Hack der ohnehin immer wieder in der Kritik stehenden "intelligenten" Stromzähler vulgo Smart Meter. Die perfide gezielte Manipulation nimmt das kontinentale Stromnetz von zwei Seiten in die Zange und löst eine europaweite Kettenreaktion aus. Diverse (gerne ignorierte, im Roman aber allesamt in Erinnerung gerufene) Stromausfälle in den letzten paar Jahren haben auf lokaler bzw. regionaler Ebene bereits vorgemacht, was passiert, wenn die prekäre Balance im Netz zwischendurch mal verloren geht. Dass es - wie hier im Roman - danach nicht wieder in die Gänge kommt, dafür braucht es allerdings schon mehr. Und Elsberg liefert nach.
"Blackout" beginnt ohne lange Vorreden mit den ersten Ausfallserscheinungen am Tag 0. In der Folge springen wir in raschem Wechsel quer durch die EU, etwa zehn potenzielle HandlungsträgerInnen werden vorgestellt, von denen sich schließlich drei als zentrale Figuren herauskristallisieren: Piero Manzano ist ein Hacker (selbstverständlich "White hat") aus Mailand, der den Auslöser des Anschlags in Windeseile identifiziert. Die Tragik kommt dadurch ins Spiel, dass er seine Erkenntnisse nicht rechtzeitig an den Mann bringen kann und es für ihn angesichts der zerfallenden Infrastruktur immer schwieriger wird, zu den entscheidenden Stellen durchzudringen. Bald kreuzen sich seine Wege mit denen von Lauren Shannon, einer US-Journalistin, die für CNN in der zweiten Reihe jobbt, bis sie beschließt, auf eigene Faust loszuziehen, um die Story des Jahrhunderts zu finden. Komplettiert wird dies schließlich mit Francois Bollard, einem leitenden Europol-Beamten in Den Haag.
Man sieht schon: Alle Hauptfiguren sind dank ihres Hintergrunds mit einer Expertise ausgestattet, die sie über Otto Normalverbraucher hinaushebt - eigentlich ein recht traditioneller Ansatz bei Katastrophenthrillern. Zudem ergeben sich - etwa durch Verwandtschaft oder Wohnungsnachbarn - zwischen den ProtagonistInnen einige erstaunliche Querverbindungen. Witzigerweise wirkt das Kernensemble damit ähnlich verdichtet wie in dem sehr viel kleinformatigeren Blackout-Szenario "Schwarzfall", das der deutsche Autor Peter Schwindt vor zwei Jahren veröffentlicht hatte. Allerdings ist bei Elsberg ja die gesamteuropäische Bühne voll mit Nebenfiguren und StatistInnen. Und die leiden, ohne zu verstehen.
Soweit die Thriller-Ebene ... und "Blackout" ist ein ausgesprochen spannender Vertreter seiner Art. Aber eben nicht nur. Ich würde zwar nicht so weit gehen, es als "getarntes Sachbuch" zu bezeichnen, wie schon zu lesen war, aber Wissensvermittlung ist dem Autor offensichtlich ein Anliegen. Die Kombination aus beidem ist eine Marktnische, in der es sich ja bislang vor allem Frank Schätzing recht bequem gemacht hat. Parallelen gibt es zuhauf - wenn beispielsweise in "Blackout" eine Lagebesprechung im deutschen Bundeskanzleramt geschildert wird, auf der die versammelten EntscheidungsträgerInnen ein Gesamtbild der Katastrophe erstellen, dann ist dies praktisch ein Spiegelbild des Treffens im kanadischen Château Whistler in "Der Schwarm". Ganz wie Schätzing gibt Elsberg massenweise recherchiertes Faktenwissen über Technologie, Infrastruktur oder wirtschaftliche und politische Verflechtungen wieder. Der entscheidende Unterschied liegt im Takt: "Blackout" hat kurze Sätze, kurze Kapitel - und damit auch kurze Info-Abschnitte. So viele es auch sein mögen, sie sind nie lang genug, um die Handlung ins Stocken geraten zu lassen.
Im Kielwasser des "Schwarm"-Erfolges ist Werbefachmann Frank Schätzing ja nachträglich zu einer Art Meister der Meere für jegliche mediale Verwendung mutiert. Bei Elsberg ist die Hybridform aus Information und Unterhaltung gleich von Anfang an Konzept. Als sichtbare Ausformung dessen tourt der Autor derzeit nicht nur mit herkömmlichen Lesungen durch die Lande, ein Teil der Termine wird auch mit anschließenden Expertengesprächen über die reale Gefahr von Blackouts kombiniert. Ein Wien-Besuch steht übrigens unmittelbar bevor, nämlich am 27. März im Metropoldi im 17. Bezirk!
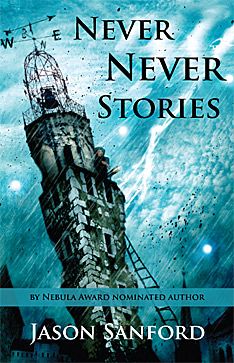
Jason Sanford: "Never Never Stories"
Broschiert, 242 Seiten, Spotlight Publishing 2011
Was, wenn am Himmel keine Wolken, sondern Raumschiffe entlangzögen? Zigtausende, vielleicht Millionen davon - manche winzig, andere kilometerlang. So viele, dass ihr endloser Strom das Ökosystem einer ganzen Welt prägt: All the ships contribute something to our world. Oxygen and carbon dioxide. Metal hail and organic particles. Water as rain, vapor, or ice. Every day our skies are filled with a thousand thousand ships, each one giving something before leaving again for the greater universe. So sieht es in der Welt der Wetterprophetin Tem aus, einem instabilen Ball aus Schlamm, der seine BewohnerInnen zwingt, ständig höher zu bauen, um nicht zu versinken. Und der Schlüssel zum - wundervoll berührenden - Geheimnis dieser Welt liegt nicht oben am Himmel, sondern tief unten zwischen den Fundamenten vergangener Generationen.
"SF Strange", so beschreibt der US-amerikanische Autor Jason Sanford seine Erzählungen, mit denen er vor allem im Magazin "Interzone" von sich reden gemacht hat. Auf Deutsch ist bislang noch nichts von ihm erschienen; unsere Nachbarn hinter der tschechischen Grenze hatten da in Sachen Übersetzungen schon mehr Glück. SF Strange ist eine gute Bezeichnung für das obige "The Ships Like Clouds, Risen by Their Rain" ... sollte sich davon übrigens jemand irgendwie an die poetischen Titelgebungen bei James Tiptree, Jr erinnert fühlen, liegt er vielleicht nicht falsch. Wohl nicht ganz zufällig heißt eine weitere Erzählung nämlich "When Thorns Are The Tips Of Trees".
Eines haben die beiden Geschichten sogar gemeinsam: Beide drücken auf ihre Weise aus, dass Leben gleichbedeutend mit Veränderung ist. In "Thorns" ist dies in die Beschreibung einer langsam voranschreitenden Seuche eingebettet, die ihre Opfer nach dem Tod zu kristallinen Gebilden erstarren lässt, in denen noch ein Echo ihres ehemaligen Bewusstseins nachhallt. Eine Variation zu diesem Thema bietet "Here We Are, Falling Through Shadows": Die Bedrohung ist hier noch frischer, der gesellschaftliche Zerfall hat gerade erst begonnen. Nichtmenschliche rippers greifen aus den Schatten und reißen Menschen mit sich in etwas hinein, das wie die Hölle wirkt. Das mag sich wie ein Horror-Plot anhören, wird sich dann aber doch noch als Science Fiction entpuppen, wenn es erstmals zu einer Kommunikation mit einem ripper kommt.
Vergleichsweise down-to-earth, wenn auch auf einem anderen Planeten angesiedelt, ist die Erzählung "Rumspringa", benannt nach jener Phase, in der die Teenager der Amischen noch einmal die Sau rauslassen dürfen, ehe sie sich bewusst für (oder gegen) das traditionelle Leben in ihrer Glaubensgemeinschaft entscheiden. Außenstehende bezeichnen die Amischen in den USA bekanntlich pauschal als "the English" - in Sanfords Erzählung sind die "Englischen" die Angehörigen der galaktischen transhumanen Gesellschaft. Bei Sanford kommt diese weniger gut weg als z.B. bei einem Iain Banks. Im Fluss befindliche Identitäten werden hier tendenziell als Haltlosigkeit geschildert - und den Amischen ist the emptiness of a society of self-centered people who could create anything they wished for natürlich erst recht ein Gräuel. Trotzdem werden VertreterInnen beider Kulturen zusammenarbeiten müssen, wenn auf einem frisch terraformierten Planeten mit Amisch-Kolonien eine Katastrophe bevorsteht. Beruhigenderweise hat Sanford eine Vorliebe für positive Enden - das gilt für diese Geschichte ebenso wie für obige Niedergangsszenarien oder auch "Millisent Ka Plays In Realtime", das ein hochtechnologisches Feudalsystem beschreibt, in dem die (horrenden) Preise mit Lebenszeit bezahlt werden müssen. Der Schuldenstand wird dem Körper mittels künstlicher Chromosomen eingeschrieben.
Eine Ausnahme von der Regel bildet das düstere "Peacemaker, Peacemaker, Little Bo Peep". Ein neues Massenphänomen breitet sich aus: Unter dem Einfluss eines kollektiven Traums rotten sich Normalos zu "Peace!"-kreischenden Mobs zusammen, um Gewaltverbrecher ebenso wie Polizisten und andere Ordnungskräfte zu lynchen. Eingeleitet wird das Ganze mit dem genialen Satz: "The sheep led the sheepdogs and wolves to pasture and prepared to gun us down." Einer Polizistin gelingt zusammen mit einem Schwerverbrecher die Flucht - und unterwegs entdecken sie, dass sie tatsächlich etwas gemeinsam haben, das sie von den "Schafen" unterscheidet. Einmal mehr klingt hier James Tiptree, Jr an, genauer gesagt die berühmte Geschichte "The Screwfly Solution".
Cordwainer Smith könnte dafür Pate für "Memoria" gestanden haben. Auch Smiths Weltraum war ja von fremdartigen Geistern bewohnt, die den Verstand derjenigen angriffen, die sich hinaus in die Vakuumkälte wagten. In Sanfords Geschichte - SF Strange, indeed! - pendelt ein lebendes Raumschiff zwischen parallelen Universen, nur um jede Version der Erde verwüstet vorzufinden. Hier sind die Geister verstorbener Menschen einer Barriere eingelagert, die die "Original-Erde" umgibt. Jede Passage durch diese Barriere fordert ihren Tribut, und so wird die Schiffscrew von SchwerverbrecherInnen begleitet, die sich freiwillig gemeldet haben, um als lebende Schutzschilde zu fungieren. Bemerkenswert, dass auch aus dieser Konstellation eine Geschichte von Hoffnung und Menschlichkeit erwachsen kann.
Zehn "Never Never Stories" sind in dieser Sammlung enthalten; zur Vollständigkeit noch die drei, die eher unter Fantasy als unter SF fallen: Die beste davon ist "Into the Depths of Illuminated Seas" und spinnt die seltsame Mär der Amber Toler, auf deren Körper die Namen derer, die auf See sterben werden, als leuchtende Tätowierungen erscheinen. "A Twenty-First Century Fairy Love Story" ist ... genau das. Also nett und gefühlvoll und ein wenig schwülstig. In "The Never Never Wizard of Apalachicola" schließlich macht sich ein Astronaut, der aus den Sümpfen Floridas stammt, auf, um den Hexer wiederzutreffen, der sein ganzes Leben - und sehr viel mehr, wie sich herausstellen wird - beeinflusst hat. - Dass die sehr gut geschriebene Feen-Geschichte hier als Schwachpunkt in die Akten eingeht, zeigt übrigens bloß, was für ein fantastischer Erzähler und Ideenentwickler Jason Sanford ist. Für alle, die den Sense of Wonder lieben, bietet diese Sammlung exzellenten und von Anfang bis Ende faszinierenden Lesestoff!
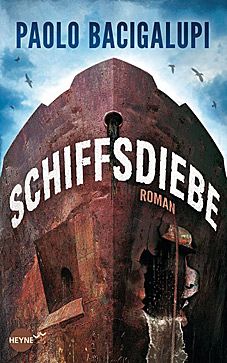
Paolo Bacigalupi: "Schiffsdiebe"
Kartoniert, 349 Seiten, € 15,50, Heyne 2012 (Original: "Ship Breaker", 2010)
Der Roman "The Windup Girl/Biokrieg" ist SF-Fans noch in bester Erinnerung, da kommen synchron zwei sehr gute Ergänzungen auf den Markt - eine Story-Sammlung (siehe nächste Seite) und ein Roman. Dass "Schiffsdiebe" in derselben Welt wie "Biokrieg" angesiedelt ist, machen einige Details klar: Etwa wenn vom vergangenen Ölzeitalter bzw. dem Zeitalter der Beschleunigung die Rede ist. Oder wenn wir einen der superschnittigen Klipper, die schon in "Biokrieg" erwähnt wurden, diesmal aus der Nähe betrachten dürfen - also einen der mit Wind- und Sonnenenergie betriebenen Hightech-Segler aus Kohlenstofffasern, mit denen man nun ressourcenschonend über die Ozeane pflügt. Vorausgesetzt, man kann sich die Passage leisten. Das in "Biokrieg" omnipräsente Thema der Biotechnologie spielt hier eine geringere Rolle, liefert aber ein neues Detail in Form der Halbmenschen: Chimären, in deren menschliche DNA - zwecks "angeborener Treue" - Gene von Hunden, Tigern und Hyänen eingebaut wurden. Ein solcher Halbmensch, Tool mit Namen, ist hier in einer Nebenrolle vertreten. Im heuer noch erscheinenden nächsten Roman "The Drowned Cities" wird Tool übrigens wiederkehren.
Schauplatz des Romans ist ein ironisch Bright Sands Beach benannter Abschnitt der US-Golfküste, nicht allzuweit entfernt vom versunkenen New Orleans und dem versinkenden Orleans II. Im seichten Wasser vor dem Strand dümpeln wie tote Wale die Wracks alter, nutzlos gewordener Öltanker. Und wie Wale werden sie ausgeweidet: Im Auftrag von Recycling-Konzernen krabbeln die Kolonnen der Schiffsbrecher (darum der Originaltitel, der deutsche ist unsinnig) über die riesigen Körper - die Erwachsenen außen, die Halbwüchsigen drinnen in den engen Schächten -, um Kupferkabel und sonstiges Restmetall zu bergen. Die Arbeit in der vergifteten Umgebung ist gefährlich, und dieser Alltag hat die in stammesartigen Clans organisierten Schiffsbrecher, die dem Plündergott und dem Rostheiligen huldigen, hart gemacht. Es ist eine Welt von wenig Mitteln, wenig Wahlmöglichkeiten und wenig Mitleid.
Im Mittelpunkt steht der Jugendliche Nailer, dessen Leben täglich zwischen der Kolonnenarbeit und der Angst vor seinem drogensüchtigen und gewalttätigen Vater kreist. Nur seine athletische Freundin Pima und deren Mutter geben ihm Rückhalt - bis eine Entdeckung nach einem Hurrikan sein Leben verändert. Der Sturm hat einen Klipper an Land gespült, an Bord finden Nailer und Pima das Mädchen Nita, das von sich behauptet, Erbin eines Konzerns zu sein. Nailer steht nun vor einem Zwiespalt: Soll er Nita als Ressource (von Schmuck bis zu Organen) oder als Mensch betrachten? Was auf eine moralische Entscheidung zwischen einem angenehmeren Leben und jeder Menge Probleme hinausläuft.
Anders als mit "The Windup Girl" wollte Bacigalupi mit "Ship Breaker" von Anfang an einen Jugendroman schreiben. Was nicht allein mit jugendlichen ProtagonistInnen getan ist, das hat auch auf die Erzählstrukur selbst Einfluss: Die Komplexität ist - vor allem in Hinsicht auf die globalen Rahmenbedingungen der Handlung - deutlich reduziert. Im Fokus stehen die Erlebnisse der Hauptfigur, der wir im Verlauf des Romans nie von der Seite weichen und die als positive Figur auch nie in Frage gestellt wird - idealerweise sollte es sich also um einen Sympathieträger handeln. Und insgesamt ist die Stimmung weniger düster als in "Windup Girl". Zwar wird Nailer mit jeder Menge Härtefälle konfrontiert, die aus Bacigalupis grimmigem Zukunftsentwurf resultieren, doch sind dies Bewährungsproben, die der Protagonist zu bestehen hat und die ihn reifen lassen sollen. Im konkreten Fall ausgehend von einem ganz klassischen Damsel-in-Distress-Plot, der problemlos auf andere Genres übertragbar wäre - etwa indem man durch einfachen "Suchen&Ersetzen"-Befehl die Konzernerbin zur Prinzessin macht.
Längst ist in der Genre-Literatur das Label "Young Adult" - der ganz große Trend der vergangenen Jahre - kein Zeichen für geringere Qualität mehr. Und "Schiffsdiebe" ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Eine Empfehlung also - man sollte nur vor dem Lesen daran denken, dass hier etwas andere Gesetzmäßigkeiten gelten.
Paolo Bacigalupi: "Der Spieler"
Kartoniert, 213 Seiten, € 15,40, Golkonda 2012
Aufmerksame LeserInnen werden bemerken, dass hier kein Hinweis auf den Titel der Originalausgabe steht - was natürlich nicht daran liegt, dass Paolo Bacigalupi plötzlich auf Deutsch zu schreiben begonnen hätte, sondern dass es in dem Fall kein 1:1-Original gibt. Die Kurzgeschichtensammlung "Der Spieler", die der Golkonda-Verlag nun herausgegeben hat, basiert zwar großteils auf dem englischsprachigen Band "Pump Six", den ich vor genau einem Jahr vorgestellt habe (hier die Nachlese). Einige Stories wurden allerdings nicht übernommen, dafür ist mit "Der Spieler" ("The Gambler") eine dazugekommen, die 2008 erstveröffentlicht wurde und für "Pump Six" offenbar knapp zu spät kam.
"Der Spieler" ist wie so oft in einer nahen Zukunft angesiedelt - liest man sich Bacigalupis Beschreibung des Alltags in einer Online-Redaktion durch und zieht nur ein bisschen an Technologie und Wirtschaftszynismus ab, könnte es glatt die nächste Woche sein. Hauptfigur ist der junge Ong, der als Kind aus Laos evakuiert wurde, als das Land einem Putsch zum Opfer fiel. Mutter und Vater - letzterer verteilte bis zum Ende regimekritische Flugzettel - hat Ong verloren; auf Umwegen ist er schließlich in den USA gelandet und arbeitet nun in der News-Redaktion irgendeines Mediengiganten. Dass Bacigalupi selbst entsprechende Berufserfahrung gesammelt hat, merkt man der Erzählung an. In der passend als Mahlstrom bezeichneten Flut der Infotainment-Produktion ist Quote alles, in Echtzeit werden die Klickzahlen gemessen und mit den Ratings der Konkurrenz und dem eigenen Aktienkurs korreliert. SDS (Sex, Dummheit, Schadenfreude) lautet die Devise, und weil das Publikum an dieser Priorisierung schließlich nicht ganz unschuldig ist, wird es später heißen: "Die Menschen wollen Geschichten, die gut ausgehen! Sie wollen lustige Geschichten. [...] Also schreiben wir alle das, was ihr lesen möchtet - nichts."
Ong nimmt sich in seinem News-Team wie ein Fremdkörper aus, schreibt betuliche, aber seriöse Artikel über Klimawandel und Behördenschlampereien, die kein Mensch liest, und bleibt stets höflich und bescheiden. Erst als ihm die Chance angeboten wird, eine Sensationsgeschichte zu landen, beginnt er zu begreifen, wie sehr seine Arbeit den kleinen Widerstandsakten seines Vaters ähnelt. Und dass die grelle Infotainmentfülle seiner neuen Heimat nur scheinbar das Gegenteil des "schwarzen Lochs" ist, als das sich das vom Weltnetz abgekoppelte Neue Königreich Laos nun präsentiert. In Wirklichkeit ist er nur von einem schwarzen in ein weißes Loch gefallen, in dem Populismus kritische Gedanken ebenso effektiv an den Rand drängt wie in Laos die Zensur.
Einmal mehr geht es in "Der Spieler" um einen Menschen, der vor eine Entscheidung gestellt wird, und einmal mehr lässt Bacigalupi die Geschichte in the frozen moment of delicious possibility enden, in dem diese Entscheidung fällt. So drückte der Autor es in "The Fluted Girl" aus, das in dieser Sammlung ebenfalls enthalten ist ("Das Flötenmädchen"). Im Mittelpunkt steht hier ein Mädchen, dem die Biotechnologie noch viel grausamer mitgespielt hat als dem "Windup Girl" Emiko in Bacigalupis gleichnamigem Erfolgsroman (auf Deutsch: "Biokrieg"). Fans dieses vielleicht besten SF-Romans der letzten Jahre dürfen sich darüber freuen, dass mit "Yellow Cards" ("Yellow Card Man") und "Der Kalorienmann" ("The Calorie Man") mindestens zwei Erzählungen in der Sammlung enthalten sind, die eindeutig in der Welt des Romans angesiedelt sind. Die übrigen, "Der Pascho" ("The Pasho") und "Die Tasche voller Dharma" ("Pocketful of Dharma"), sind schwerer zu verorten, handeln aber zumindest in sehr ähnlichen Zukünften.
Für Einzelheiten zu diesen Geschichten hier noch einmal der Verweis auf die Rezension zu "Pump Six", verbunden mit einer klaren Kaufempfehlung. "Der Spieler" ist eine ideale Ergänzung zu "Biokrieg", und in dem Fall auch eindeutig eine für erwachsene LeserInnen.
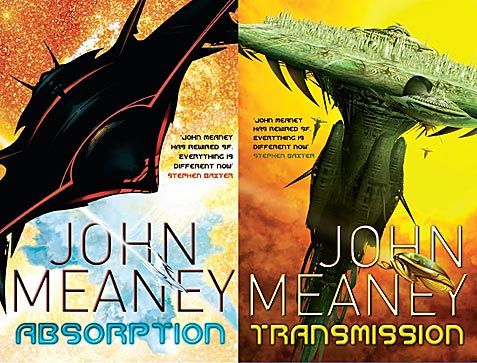
John Meaney: "Absorption" + "Transmission" ("Ragnarok" 1+2)
Broschiert, 416 bzw. 432 Seiten, Orion 2011/2012
John Meaney kennen wir in der Rundschau als Autor von "Tristopolis" und "Dunkles Blut", zwei ... sagen wir mal Ausstattungsschlachten mit sehr morbiden Requisiten. Paradoxerweise sind diese beiden Seltsamkeiten bislang die einzigen ins Deutsche übersetzten Romane Meaneys geblieben. Dabei macht der Brite vorzugsweise in Science Fiction - so auch in seiner aktuellen "Ragnarok"-Reihe, die sich inhaltlich sowohl auf seinen früheren "Nulapeiron"-Zyklus als auch den 1998er Roman "To Hold Infinity" bezieht. Aber keine Angst, die Hightech-Götterdämmerung lässt sich auch ohne Vorwissen lesen ... bzw. ist sie auch ohne Querverweise schon herausfordernd genug.
Meaney hat eine Vorliebe nicht nur für üppige Detailfülle, sondern auch für kreatives - und manchmal durchaus effekthascherisches - Wording, um all die schönen Gadgets und Gizmos der Zukunft zu beschreiben. Wenn beispielsweise die Bürgerin eines infotechnologisch totalvernetzten Planeten das Bewusstsein eines armen Mitbürgers hackt, dann liest sich das so: Vampire code ravened through barriers, spread like wildfire down paranerve channels, tearing and ripping, copying and plundering, taking the quantum state of Daniel's mind and copying it back to Rafaella's cache, to the waiting, hungry buffer, heisenberging the original brain-plus-plexweb into oblivion. "Heisenberg" zum Verb gemacht, das ist nicht ohne. Ähnlich wie bei Hannu Rajaniemi oder seinerzeit William Gibson können derlei technophile Wortkaskaden auf den ersten Blick abschreckend wirken. Ist man jedoch gewissermaßen erst mal im Flow drinnen, dann macht einem das keine Probleme mehr, im Gegenteil: Man kann es sogar genießen.
Und schielt man zwischen all den verschwenderisch ausgestreuten Neologismen, Details, Handlungspersonen und Schauplätzen durch, dann offenbart sich sogar eine recht einfache Geschichte. Deren Schnittstelle liegt auf dem Mond, wo im Prolog einige kristalline Wesen nach langem Schlaf erwachen und feststellen, dass sich im Kern der Milchstraße eine Dunkelheit ausbreitet. Um gegen diese anzukämpfen, werden Menschen in verschiedenen Zeitaltern und auf verschiedenen Welten rekrutiert. Gemeinsam ist diesen KämpferInnen in spe - allen voran ein junger Mann des Jahres 2603, eine Physik-Studentin der 1920er Jahre und ein Nordmann des Jahres 777 -, dass sie "Schatten" wahrnehmen, die ihre ZeitgenossInnen nicht sehen können. Gavriela Wolf, eine deutsche Jüdin, die ihre Ausbildung an der ETH Zürich angetreten hat, beobachtet solche Schatten bei einer faschistischen Versammlung. Der Nordmann Ulfr sieht sie rings um einen wandernden Skalden, der erst die Männer von Ulfrs Dorf zu einem Mord aufhetzt und dann die Stämme für einen großen Plünderzug - a-viking! a-viking! - vereinen will.
Zwischendurch erinnert "Absorption" etwas an Greg Bears "Die Stadt am Ende der Zeit": Die ausgewählten ProtagonistInnen können über die Zeitalter hinweg zueinander in Kontakt treten, zudem fallen immer wieder mythologische Anspielungen. Nicht nur, dass der Skalde an Odin wie Loki gleichermaßen erinnert, da wäre ja auch noch der titelgebende Ragnarök-Hintergrund an sich. Als Ulfrs Leute von einem Troll angegriffen werden, glaubt man schon, dass Meaney jetzt endgültig die Grenze zur Fantasy überschritten hat ... tja, gäbe es da nicht eine vierte Zeitebene im 22. Jahrhundert, die sich rund um eine Explorerin von der Erde und den Eingeborenen eines neuentdeckten Planeten dreht. Die beiden haben nämlich eine Kurzbegegnung mit den Angehörigen einer weiteren Alien-Rasse, die man zwar schon lange kennt, aber noch immer nicht versteht. Und diese Aliens hüllen sich in Körper aus Stein ... Connection, Connection! Vielleicht zumindest - Teil 2, "Transmission", wird dann einige weitere Querverbindungen zeigen.
Der Großteil von "Absorption" spielt sich indessen im Jahr 2603 auf dem von Menschen besiedelten Planeten Fulgor ab. Der ist ein Hightech-"Paradies", an dem von Hannu Rajaniemi über David Marusek und Gary Gibson bis zu Iain Banks so einige Autoren ihre Freude haben könnten. Steuerbare "Smartmaterie" wie quickglass oder quickstone lässt die Grenzen zwischen der feststofflichen Welt und dem virtuellen Raum des Skein verschwimmen, in dessen Info-Strömen sich die hypermultitaskenden Luculenti als höchste Kaste der Gesellschaft suhlen. Bis eine Luculenta auf das technische Erbe eines Ahnen stößt (eine direkte Anknüpfung an "To Hold Infinity"), von diesem verwandelt wird und sich zu einer Bedrohung entwickelt, wie Fulgor sie noch nie gesehen hat. Einer von apokalyptischen Ausmaßen, wie der mitreißende Schlussteil von "Absorption" zeigen wird.
Die Heldenrolle auf dieser Zeitebene übernimmt der gerade 18 gewordene Pilot Roger Blackstone ... und ich traue mich es kaum noch zu schreiben: Damit wird uns noch ein Szenario der abgefahrenen Art präsentiert, denn die in früheren Romanen bereits eingeführten Pilots sind eine interplanetar agierende Organisation, ihr Hauptquartier ist die außerhalb des normalen Raum-Zeit-Gefüges angesiedelte "fraktale Stadt" Labyrinth mit ihren unterschiedlichen Zeitströmen und unfassbaren Geometrien. - Wird alles langsam ein bisschen viel, nicht wahr? Dabei hab ich mich hier sogar bemüht, ein bisschen mehr an strukturellen Zusammenhängen zu spoilern, als sich NeuleserInnen auf den ersten paar hundert Seiten erschließt. Trotzdem sei gesagt: Meaney bietet hier echt faszinierende Lektüre. Und eine, die abseits all der Worldbuilding-Wahnsinnigkeiten auch berührende menschliche Seiten hat - etwa wenn wir mit Gavriela den unaufhaltsamen Siegeszug des Nationalsozialismus miterleben müssen. Der Nachfolgeband "Transmission" ist gerade erst herausgekommen und ich würde empfehlen, die beiden Bücher zusammen zu lesen, um aus der komplexen Handlung zwischendurch nicht rauszufallen. Oder vielleicht Geduld zu bewahren und gleich zu warten, bis der Abschlussband der Trilogie erscheint. Aber dann!

"Steam Worlds" (umfasst Jonathan Barnes: "Das Albtraumreich des Edward Moon" + Jo Walton: "Der Clan der Klauen")
Broschiert, 784 Seiten, € 10,30, Piper 2011 (Originale: Barnes: "The Somnambulist", 2007 + Walton: "Tooth and Claw", 2003)
So ganz sicher bin ich mir nicht, was ich von dem Format "Zwei Bücher in einem" - zumal von verschiedenen AutorInnen - halten soll. In jedem Fall ist es eine kostengünstige Erwerbung und unter den drei Doppeltiteln, die Piper Ende 2011 aus seinem Fantasy-Fundus zusammengestellt hat, greife ich hier den heraus, bei dem beide Hälften sehr lesenswert sind. "Das Albtraumreich des Edward Moon" hab ich ja seinerzeit bereits bei Erscheinen der Taschenbuchausgabe rezensiert, da kann ich mich hier mit einem Nachlese-Verweis begnügen. Kurzer Appetizer: Der Steampunk-Thriller dreht sich um die "geheime Geometrie" eines spätviktorianischen London voller übersinnlicher Umtriebe, Morde, Geheimdienste und -bünde; giftig schillernd und voller grotesker Details. Könnte durchaus eine Inspiration für China Miévilles "Der Krake" gewesen sein.
Ganz anders (und "anders" ist im Fantasy-Genre bereits ein Wert an sich) Jo Waltons "Der Clan der Klauen", der vielleicht ungewöhnlichste Drachen-Roman aller Zeiten. Die in Wales geborene und heute in Kanada lebende Autorin Jo Walton hatten wir in der Rundschau schon einmal mit "Farthing", dem Auftakt einer Alternativwelt-Trilogie, in der Großbritannien sich den Geistesströmungen der 30er Jahre ergibt und ebenfalls zur faschistischen Diktatur wird. Aktuell hat die Spezialistin für leise Töne mit dem Roman "Among Others" aufs Neue von sich reden gemacht.
Dass "Der Clan der Klauen" hier in einen Steampunk-Kontext gesteckt wurde, liegt weniger an der Eisenbahn, die im Roman ein paar Mal erwähnt wird, als an der beschriebenen Gesellschaftsordnung. Einer Gesellschaft von Drachen wohlgemerkt. Aber Achtung: Mögen Hüte tragende und in die Oper gehende Drachen von immerhin bis zu 20 Metern Körperlänge auf den ersten Blick auch absurd wirken, so hat das Ganze doch seinen Sinn. Der liegt freilich nicht in der Genesis dieser ganz speziellen Alternativwelt, da beschränkt sich Walton auf ein paar beiläufige geografisch-historische Verweise. Vielmehr gelingt es ihr damit, erstens gesellschaftliche Verhältnisse, wie sie bei uns bzw. in England im 19. Jahrhundert herrschten, zu überzeichnen. Und zweitens eine Literaturgattung, die ebendiese Verhältnisse hervorbrachten, nämlich den viktorianischen Roman, aufzugreifen und dann so geschickt abzuwandeln, dass das Ergebnis federleicht an der Grenze von Satire und Hommage dahintänzelt.
Die Handlung ist rasch erzählt: Das greise Oberhaupt der Familie Agornin stirbt. Als sich sein reicher Schwiegersohn Daverak mehr von der Erbmasse (=dem Leichnam) nimmt, als ihm nach Meinung der Blutsverwandten zusteht, bricht ein Erbschaftsstreit aus und Sohn Avan strengt einen Gerichtsprozess an. Im Mittelpunkt stehen aber nicht die männlichen Akteure, die den äußeren Rahmen der Handlung abstecken, sondern die Frauen, die dies ausbaden müssen; insbesondere Avans Schwestern Haner und Selendra, die beim ungeliebten Schwager Daverak beziehungsweise beim älteren Bruder Penn, einem Pfarrer, untergebracht werden. Ohne männlichen Schutz kann eine Frau nämlich nicht leben - und das ist hier wörtlich zu nehmen, denn Schutzlose dürfen ebenso wie schwächliche Kinder oder eben teure Verblichene verspeist werden; immerhin ist Drachenfleisch das einzige, womit man an Körpergröße zulegen und sich schließlich Schwingen wachsen lassen kann. Frauen haben aber gleich die doppelte Arschkarte gezogen: Sie sind nicht nur körperlich unterlegen, sie haben auch die fatale biologische Eigenschaft zu erröten, wenn sie sich in einen Mann vergucken oder sogar - noch schlimmer - von einem gegen ihren eigenen Willen bedrängt werden. Dauerhaft gebrandmarkt mit einem rosa Schuppenkleid bleibt ihnen dann nur noch die Wahl zwischen schneller Heirat oder einem Abschiedsauftritt als Hauptspeise.
Wer das jetzt immer noch absurd findet, möge sich die gesellschaftlichen Verhältnisse im heute gerne verklärten 19. Jahrhundert in Erinnerung rufen. Der über Frauen zwangsweise verhängte "Normalzustand" der Unmündigkeit war derselbe, Walton ironisiert lediglich das dahinterstehende moralische Wertesystem, indem sie eine Welt zeichnet, in der dieses System tatsächlich auf Naturgesetzen fußt. Das Ergebnis ist ein Jane-Austen-Szenario unter verschärften Bedingungen, bis zur Kenntlichkeit verzerrt, wie das so schön abgedroschen heißt. Also eine Welt, in der der Dienerschaft die Flügel auf dem Rücken festgebunden werden und eine Frau unter allen Umständen die Form zu wahren hat: "Ich habe im Esszimmer angefangen zu bluten. Es war beinahe komisch. Unsere Gäste wussten nicht, ob sie mir helfen oder mich fressen sollten."
Action-Freunde werden im "Clan der Klauen" nicht auf ihre Rechnung kommen. Wir bewegen uns zwischen Empfängen, Picknickausflügen und Abendessen, die Kapitel tragen Überschriften wie "Die Bedeutung von Hüten" oder "Ein ungehöriges Benehmen in der Unterhöhle". Es ist ein Sittenbild, das leicht und humorvoll daherkommt - wie's halt nur sein kann, wenn man sich unter streng auf Etikette bedachten Kannibalen aufhält. Und das trotzdem durchexerziert, wie unerbittlich sich ein starres gesellschaftliches Korsett auf Menschen ... pardon: Drachen auswirkt. Das ihnen das Ideal der romantischen Liebe vorgaukelt, während in der Praxis jeder Heiratsantrag nur Mittel einer wirtschaftlichen Überlebensstrategie sein kann. - Wie gesagt: Anders ist (zumindest für einen Vielleser wie mich) bereits ein Wert für sich, und dass dieser sehr andere Roman den World Fantasy Award gewonnen hat, ist ebenso überraschend wie hoffnungsvoll. Sogar mehr noch als der alle Stückeln spielende Schluss des Romans, den selbst vom ZDF verfilmte Kitschroman-Autorinnen nur mit roten Ohren zu Papier hätten bringen können.

Frank W. Haubold: "Die Kinder der Schattenstadt"
Kartoniert, 320 Seiten, € 13,40, Blitz 2012
Hier ein Buch, das mich ein paarmal zum Zurückblättern zwang, weil ich das Gefühl hatte etwas übersprungen zu haben. Wobei ich gleich vorausschicken darf, dass dies für mich bei weitem nicht so lästig ist wie der seeehr viel öfter auftretende Ablauf des Vorblätterns - immer dann nämlich, wenn sich ein/e AutorIn mal wieder in endlosen Beschreibungen unwesentlicher Dinge ergeht, um nur ja keine Lücken offen zu lassen. Das ist nun wirklich nicht die Vorgangsweise von Frank W. Haubold, der hier in der Rundschau bislang nur mit einigen Anthologie-Beiträgen vertreten war. Im Gesamtergebnis wirkt sein Roman "Die Kinder der Schattenstadt" zwar mitunter etwas disparat. Aber er langweilt nie.
Ein Episodenroman ist es genaugenommen, und fast könnten die Episoden sogar unterschiedlichen Genres entstammen. Es beginnt mit dem recht reißerischen Szenario einer Nazi-Massen(selbst)vernichtungswaffe, deren Einsatz am Ende des Zweiten Weltkriegs noch einmal gerade so abgebogen wird. Die ist im Auge zu behalten, sie kehrt am Ende wieder. Erst springen wir aber in der Zeit vor und schwenken zu einer Gruppe von Kindern um, die in einem DDR-Städtchen aufwachsen. Nun scheint die Geschichte eher in eine Stephen-King-Richtung zu gehen; besonders der Gedanke an "Es" liegt nahe, wenn ein Junge aus dieser Clique durch einen unterirdischen Tunnel kriecht und dabei einem übernatürlichen Wesen begegnet. Später wird dieser Junge, Fabian Rothenbach, immer wieder apokalyptische Visionen von einem "dunklen Vogel" haben, ohne dass diese Erscheinung jedoch Gut oder Böse zuzuordnen wäre.
Auch die Kindergeschichte bleibt nur eine Episode, in der Folge schreiten wir anhand von Fabians Leben durch die Zeit. Dabei vermischt Haubold ganz unterschiedliche Elemente. Mystery-Aspekte gesellen sich zu sehr authentisch wirkenden Passagen aus dem ganz normalen Leben, für die der in der DDR geborene Autor wohl eigene Erfahrungen verwenden konnte - sei es der Alltag in der Nationalen Volksarmee oder - sehr schön geschildert - ein Klassentreffen der Schattenstadt-Kinder im gewendeten Deutschland nach der Wiedervereinigung. Fabian wird schließlich eine Gefährtin vom anderen Ende der Welt zur Seite gestellt: Sirien Nakpradith, die sich in Bangkok zur Muay-Thai-Kämpferin ausbilden hat lassen, nachdem sie als Mädchen eine Begegnung mit dem Schicksal hatte. Sowohl Fabian als auch Sirien werden als Auserwählte bezeichnet - ein klares Fantasy-Motiv, das Haubold der Mischung ebenso beifügt wie später noch Science-Fiction-Elemente im letzten Abschnitt des Romans; plus einem Far-Future-Anhang, der nur in sehr vagem Zusammenhang mit der Resthandlung steht.
Nichtsdestotrotz lässt der Roman eine klare Struktur erkennen, man muss sie lediglich bei Fabians Gegenspieler suchen. "Der dicke Martens" gehörte einst derselben Clique an, ging dann jedoch eigene Wege. Die führten ihn vom Mord an seiner Großmutter (mit übernatürlicher Hilfe) über die bereits mit sehr viel höherem Gewaltaufwand durchgeführte Auslöschung seiner Mutter und ihres Lebensgefährten immer weiter, erst zu mörderischen wirtschaftspolitischen Ränken und schließlich bis in ein buchstäblich apokalyptisches Szenario hinein. Stufe für Stufe schreitet die Eskalation voran und mit ihr wechselt auch der Roman seine Gesichter.
Im Nachwort erläutert Haubold, dass der Roman eine langjährige Evolution aus diversen Überarbeitungen hinter sich hat und in seiner ursprünglichen Form bis in die 90er Jahre zurückgeht; man merkt es ihm durchaus an. Manchmal wirkt die Erzählung sehr kursorisch - der Tod einer Hauptfigur wird äußerst beiläufig erwähnt, eine dritte Person wird nachträglich als Auserwählter identifiziert, ohne jemals zu einer Fabian oder Sirien vergleichbaren Figur aufgebaut worden zu sein usw. Auch die zeitliche Einordnung fällt nicht immer leicht: Die Kindheit der ProtagonistInnen fühlt sich - für mich zumindest - weiter in der DDR-Vergangenheit zurückliegend an, als es das Alter von Fabian & Co zur Nach-Wende-Zeit zulässt. Genauso wie eine Zukunft, in der diverse SF-Technologie - allen voran ein "Energieschirm" über Europa - realisiert wurde, gewissermaßen einen Satz rückwärts macht, um noch zu Fabians Lebzeiten stattfinden zu können.
Alles in allem ist "Kinder der Schattenstadt" so ungefähr das Gegenteil dessen, was man in einem "Wie schreibe ich einen kompakten Genre-Roman"-Workshop unter die Nase gerieben bekäme. Eher schon wirkt es wie eine auf relativ wenige Seiten eingedampfte Sammlung von Geschichten, die aus einem gemeinsamen fiktiven Universum stammen und mal mehr, mal weniger zusammenhängen. Lücken inklusive. Andererseits: Ohne jetzt Frank W. Haubold und Cordwainer Smith in einen Topf werfen zu wollen oder zu können - aber was einen bei dem einen Autor fasziniert, das kann man dem anderen auch nicht vorwerfen. Und wie handwerklich-langweilig das Ergebnis sein kann, wenn jemand eben doch nach obigem Workshop-Leitfaden vorgeht, das wird das Buch auf der nächsten Seite zeigen.
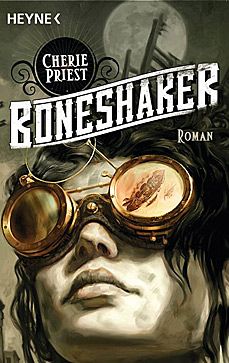
Cherie Priest: "Boneshaker"
Broschiert, 511 Seiten, € 9,30, Heyne 2012 (Original: "Boneshaker", 2009)
1880 schleppt sich der Amerikanische Bürgerkrieg an der Ostküste allmählich ins zweite Jahrzehnt - dass er in dieser Version der Welt in die Verlängerung gegangen ist, kümmert die Menschen auf der anderen Seite des Kontinents allerdings wenig. Und am allerwenigsten die BürgerInnen von Seattle, die seit langem in einer geteilten Stadt leben. Um die einstige Innenstadt wurde eine massive Mauer hochgezogen, nachdem der geniale Erfinder Leviticus Blue mit seinem Bohrfahrzeug (dem Boneshaker des Titels) erst reihenweise Gebäude zum Einsturz gebracht und dann auch noch eine unterirdische Gaslagerstätte angezapft hatte, was zum eigentlichen Verhängnis führte: Der austretende gelbe Giftnebel, Fraß genannt, raffte die armen StadtbewohnerInnen reihenweise dahin. Ein Teil von ihnen stand dann als Fresser wieder auf, you get the picture. Willkommen im "Clockwork Century Universe" der US-Autorin Cherie Priest, die nach dem Millennium erstmals in Erscheinung trat, sich binnen kurzer Zeit zur Vielschreiberin mauserte und mit dieser Reihe dann so richtig durchstartete.
Zur Handlungszeit liegt die Katastrophe bereits 15 Jahre zurück. Blues Witwe, Briar Wilkes, verdient ihren Unterhalt mittlerweile bei einem Knochenjob in der städtischen Wasseraufbereitungsanlage und wird aufgrund ihrer familiären Geschichte allseits gemobbt. Sohn Zeke ist das einzig Positive, das ihr ihr Mann hinterlassen hat. Zeke zu beschützen ist ihr ganzer Lebensinhalt - leider enthielt sie ihm deswegen auch die volle Wahrheit über die damaligen Ereignisse vor, und das erweist sich nun als Fehler. Der Teenager will mehr über seine Familiengeschichte wissen und stiehlt sich eines Tages in den eingemauerten Teil der Stadt davon. Als Briar dies erfährt, muss sie nicht lange überlegen und folgt ihm. Der weitere Verlauf des Romans besteht darin, dass die beiden gasmaskenbewehrt durch die gelben Nebel Seattles irren, überrascht feststellen, dass sich dort außer Zombies bzw. Fressern auch noch lebende Menschen aufhalten, und im hermetisch versiegelten Untergrund der Stadt mit dem Umstand konfrontiert werden, dass inzwischen ein neuer genialer Erfinder in Erscheinung getreten ist. Wirklich ein neuer, oder ist am Ende Zekes Vater doch noch am Leben?
Erzählt wird das Ganze so, wie man (und öfter noch frau) heutzutage in einem Genreroman eben erzählt, wenn keine Extravaganzen in Sachen Stil oder Struktur geplant sind. Wir haben zwei Hauptfiguren und beide sind Sympathieträger, weil keine Übermenschen - selbst die entschlossene Briar kommt im Verlauf der Ereignisse ganz schön ins Schwitzen. Die Briar/Zeke-Kapitel folgen im Reißverschlusssystem aufeinander, und gerne steht am Ende ein Cliffhanger. Vor allem aber ist typisch, dass ALLES erzählt wird. Ein Beispiel als Kontrast: Vor 60 Jahren ließ John Wyndham in seinen "Triffids" Hauptfigur William Masen einmal zwischendurch zu einer Nahrungsbeschaffungsmission aufbrechen ... und schon im nächsten Satz zu seinen Lieben daheim zurückkehren. Und da lag mehr an Handlungszeit dazwischen, als der ganze "Boneshaker" umfasst.
So etwas wäre für Priest und den Großteil ihrer heutigen KollegInnenschaft einfach u-n-d-e-n-k-b-a-r. Alles, was zeitlich zwischen Anfang und Ende des Romans liegt, sei für die Handlung als relevant zu betrachten und will daher auch beschrieben sein. Briar befragt einen Freund ihres Sohnes, wo Zeke geblieben ist. Sie sucht ehrenwerte Luftschiffkapitäne auf, um sich in den abgeriegelten Stadtteil befördern zu lassen, doch die verweisen sie auf weniger gut beleumundete. Sie sucht die weniger gut beleumundeten Kapitäne auf und trifft eine Vereinbarung. Sie fliegt mit einem weniger gut beleumundeten Kapitän in dessen Luftschiff mit. Sie lässt sich aus dem Luftschiff des weniger gut beleumundeten Kapitäns in die Stadt hinunter, usw. usf. So arbeitet sich Handwerkerin Priest lückenlos Station für Station weiter und wir sind immer live dabei. Nur aufs Klo dürfen die ProtagonistInnen allein gehen.
In einem mitunter ziemlich an "Resident Evil" erinnernden (Unter-)Grundszenario werfen sich Zombies gegen Türen, ballern Menschen mit Schusswaffen herum, stürzen Gebäude ein - und allenthalben wabert der Fraß. Immer wieder tauchen skurrile Nebenfiguren - eine alte "Indianerprinzessin" mit preußischem Gebaren oder eine einarmige Lady mit Steampunk-Prothese - aus dem Giftnebel auf, um kurz darauf wieder darin zu verschwinden; gegen Ende erfolgt dieser Wechsel derart im Schnelltakt, dass er eine ungeplant komische Note erhält. Überhaupt wird die ganze Zeit über sehr viel herumgerannt. Was letztlich aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die gesamte Handlung gegenstandslos wäre, wenn sich Briar nur einmal in all den Jahren ein paar Minuten Zeit genommen, sich zu ihrem Sohn ans Bett gesetzt und ihm erzählt hätte: "Also das mit deinem Vater damals, das war so ...".
Es wäre übertrieben zu sagen, Cherie Priest hätte eine erzählerische Stimme wie Donnerhall. Aber sie hat gute PR. Und die richtige Bestseller-Taktik, soll heißen: Sie nimmt von allem ein bisschen. Temporeiche Action plus ein Familiendrama fürs Gemüt plus ein paar Zugeständnisse an Steampunk-Unausweichlichkeiten wie Luftschiffe (die genau genommen eigentlich wenig Sinn machen, wenn sich die ganze Handlung innerhalb von Stadtgrenzen abspielt) oder famos klingende Bezeichnungen dampfbetriebener Gerätschaften wie Dr. Blue's Incredible Bone-Shaking Drill Engine oder Dr. Minnericht's Doozy Dazer. Und zumindest 2009, als Priest mit diesem Roman eine mittlerweile vier Bände umfassende Reihe startete, hat's auch noch nicht geschadet, die Mischung mit Zombies zu würzen. Wesentlich für ihren Erfolg - und diese Leistung darf man ihr auch nicht absprechen - dürfte aber der Umstand gewesen sein, dass Priest den Steampunk aus klischeehaften Frack-und-Zylinder-Biotopen wie London oder Paris in die Heimatstadt von Grunge und Bizarro geholt und ihn angemessen mit Schweiß, Dreck und Maschinenöl eingerieben hat. Drüben haben sie sich jedenfalls sehr gefreut, endlich eine Art "uramerikanische" Steampunk-Variante zu bekommen. Mag sie unter der punkigen Grind-Panier auch ein wenig hausbacken sein.

Alejandro Jodorowsky & Mœbius: "Der schwarze Incal", "Der Incal des Lichts" und "In tiefsten Tiefen" ("Der Incal" 1 - 3)
Graphic Novels, gebundene Ausgaben, jeweils 64 Seiten, € 15,80, Splitter 2011/2012 (Originale: "L'Incal noir", "L'Incal lumière" und "Ce qui est en bas", 1981 - '83)
Am 10. März hat die Comic-Welt einen der genialsten Geister verloren, die sie jemals hervorgebracht hat. Speziell Fans der Phantastik sind bei Jean Giraud alias Mœbius überreichlich auf ihre Kosten gekommen: Auf surreale Trips wie "Arzach" oder "Die luftdichte Garage" in den 70ern folgten in den 80ern unter anderem die Serie "Die Sternenwanderer", der vermutlich eleganteste "Silver Surfer" aller Zeiten in Zusammenarbeit mit Stan Lee oder der Zeichentrickfilm "Herrscher der Zeit". Von der Beteiligung am Design diverser Filmklassiker ganz zu schweigen, da wirkte der ebenso schön wie schnell zeichnende Franzose unter anderem an "Alien", "Tron" oder - optisch unverkennbar - an "Das Fünfte Element" mit.
Und vor allem ist da natürlich der "Incal", das populärste Werk aus dieser Dekade und neben der unsterblichen Western-Serie "Blueberry" vielleicht Girauds größter Erfolg. Von 1981 bis '88 erfüllte Mœbius das wahnwitzige SF-Szenario des chilenischen Autors, Regisseurs und "Psychomagiers" Alejandro Jodorowsky durch seine fantastischen Zeichnungen mit Leben. Später sollten weitere "Incal"-Bände Jodorowskys mit anderen Zeichnern folgen, die aber nie den Reiz der sechsteiligen Originalserie erreichten. Auf Deutsch hat es von dieser bereits mehrere Ausgaben gegeben. Die jüngste startete der Verlag Splitter im vergangenen Jahr und die ersten drei Bände sind bereits auf dem Markt. Teil 3, "In tiefsten Tiefen", ist gerade erst im März erschienen, im Juli geht es dann "In höchsten Höhen" weiter. Wer sich den "Incal" wirklich noch nie gegönnt hat: Unbedingt nachholen!
Erleben wir mit, wie sich das Leben von John Difool, einem schmuddeligen Privatdetektiv Klasse R und Bewohner einer Höhlenstadt auf dem Planeten Terra 21, schlagartig ändert, als ihm ein getarnter Außerirdischer in einem versifften Luftschacht den Incal des Lichts überreicht. Sieht wie eine hübsche kleine Kristallpyramide aus, ist aber natürlich viel, viel mehr. Mit diesem rätselhaften Objekt (oder genauer gesagt Subjekt) in der Tasche - gelegentlich auch im Körper - wird John, der Antiheld aller Antihelden, wider Willen immer weiter hinaus auf die Bühne der galaktischen Politik getragen. Er bekommt es mit Mutanten zu tun, mit der dekadenten, buchstäblich Heiligenschein tragenden Aristokratie und einer Techniker-Kaste, die die Finsternis anbetet und diese über das ganze Universum ausbreiten will. Neben seinem Dauersidekick, dem sympathischen Betonpapagei Dipo, sammelt John fünf weitere WeggefährtInnen um sich, die allesamt einen heroischeren Eindruck machen als er selbst ... und so ganz nebenbei wird er auch noch zum Stammvater einer ganzen Alien-Rasse. Und stets stehen die fantastischen, gigantomanischen, kunterbunten Science-Fiction-Panoramen aus Mœbius' Feder in komischem Kontrast zu den Reaktionen der total überforderten Hauptfigur.
Zu Beginn der "Incal"-Zeit war Jean Giraud fest in eine Sektengemeinschaft integriert und im Werk selbst wimmelt es nur so vor spirituellen Bezügen. Da wird John Difool einerseits vom Incal in seine Bestandteile Intellekt, Emotion und Instinkt aufgespalten, da verschmilzt er andererseits mit seinen MitstreiterInnen (eine Art Esoterik-Variante der "Sieben Samurai") zu einer psychischen Einheit. Und er begegnet überirdischen Wesen jeden Rangs, von drolligen Säulenheiligen, die über das Sein wachen, bis zum personifizierten Licht der Schöpfung selbst. Die bildliche Umsetzung erweckt den Eindruck, dass Mœbius seine Visionen weniger zeichnet als channelt - Jodorowsky kommentierte dies ironisch damit, dass Mœbius seine "schamanische Seite" ausgelebt habe. Und wenn sich am Schluss des sechsten Bands dann das Ende des ganzen irrwitzigen Trips an dessen Anfang schmiegt, dann ist die "Incal"-Reihe dem Künstlernamen ihres Schöpfers (Stichwort Möbiusband) so gerecht geworden, wie es nur geht. Genial, eines der besten Comics aller Zeiten!
Was irgendwie auch eine passende Überleitung für die Vorschau aufs nächste Mal ist. Denn wie sich im "Incal" jedes Etwas mit seinem exakten Gegenteil zu etwas Größerem verbindet, so werden wir nächsten Monat eine Welt betreten, die zur unseren ganz und gar komplementär erscheint. Also eine, in der 2001 christliche Fundamentalisten Flugzeuge in die Euphrat- und Tigris-Türme der Vereinigten Arabischen Staaten lenkten. Ein simples Spiegelbild? Nicht so ganz, aber mehr dazu im April. Bis denne! (Josefson)