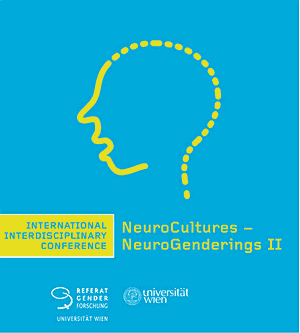"Der Geist hat kein Geschlecht": dieser Satz gilt als alte philosophische Weisheit. Dass auch das Gehirn kein Geschlecht haben könnte, scheint allerdings noch nicht zur Gänze die Runde gemacht zu haben. Die internationalen Stars der neurowissenschaftlichen Zunft, wie der Cambridge-Professor Simon Baron-Cohen oder Bestseller-Autorin Louann Brizendine glauben, dass Frauengehirne durch den stärkeren Einsatz beider Hirnhälften eher auf Einfühlungsvermögen und Kommunikation hin strukturiert seien, während Männergehirne durch ihre Konzentration auf nur eine Gehirnhälfte besser in der Lage wären, Systeme zu verstehen und sich räumlich zu orientieren.
Moderne Neurokultur
Diese neurologisch untermauerten Geschlechterdifferenzen und ihre populärwissenschaftliche Rezeption hinterfragen die WissenschaftlerInnen des Netzwerkes "NeuroGenderings". Sie treffen sich in den kommenden Tagen zum zweiten Mal in Wien, um auf der Konferenz NeuroCultures-NeuroGenderings ihre Forschungsarbeiten zu präsentieren. Darunter befinden sich neben Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen auch NaturwissenschaftlerInnen wie die Biologin Sigrid Schmitz. Die Professorin für Gender Studies an der Universität Wien sieht in den letzten Jahren eine immer stärkere Durchdringung der Welt mit neurowissenschaftlichen Diskursen, von der auch die Geschlechterverhältnisse nicht unverschont blieben.
Die Cerebralisierung der Welt
"Der selbst erhobene Anspruch der modernen Hirnforschung ist es, menschliches Verhalten und soziale Strukturen vollständig aus der Neurobiologie erklär- und sogar vorhersagbar zu machen", fasst Schmitz den Ansatz zusammen. Die Neurowissenschaften würden heute als Leitwissenschaft gelten, an der sich viele andere Disziplinen orientieren. Dadurch formiere sich eine moderne Neurokultur, in der neue Forschungsrichtungen wie die Neuro-Pädagogik, Neuro-Ökonomie oder das Neuro-Marketing alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aus der Gehirnstruktur heraus zu erklären versuchen. Neurowissenschaftler wie Gerald Hüther oder Manfred Spitzer werden als Universal-Experten in Bildungsfragen, Finanzkrise oder PartnerInnenschaft herangezogen.
Die neurowissenschaftlichen Hauptannahmen seien allerdings widersprüchlich, so Schmitz. Zwar habe sich die Grundannahme durchgesetzt, dass das Gehirn plastisch sei. Damit würde anerkannt, dass sich die Hirnstruktur mit den individuellen Erfahrungen eines Menschen auch permanent verändere. Beim Thema Geschlecht bleibe aber vom an sich progressiven Gedanken der Hirnplastizität nicht mehr viel übrig: "Das Hirn gilt zwar als veränderbar und soll in einer Leistungsgesellschaft sogar - z.B. mit Ritalin - getuned und optimiert werden. Das Geschlecht des Gehirns aber gilt weiterhin als angeboren und unveränderbar." Seien auch geschlechtsspezifische Hirnstrukturen feststellbar, so würden sie sich immer im Wechselspiel zwischen Biologie und den kulturellen Einflussfaktoren in einer nach wie vor geschlechtlich strukturierten Gesellschaft entwickeln, urteilt die Genderforscherin.
Live aus dem Gehirn?
Als die medial wirksamste neurotechnologische Methode könnte gegenwärtig das "Brain Imaging" bezeichnet werden. Auf computertomographischen Aufnahmen des Gehirns wird dabei die Hirnaktivität - z.B. beim Lösen einer Aufgabe - mittels Einfärbungen bildlich dargestellt. Besonders hilfreich ist diese magnetresonanzbasierte Technik u.a. bei der Entdeckung von Tumoren. Problematisch werde das Verfahren aber dort, so Schmitz, wo es mit einem objektiven und direkten Blick ins lebende Gehirn verwechselt würde. Einzelne Studien, die Leistungs- und Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen oder ethnisierten Gruppen herzuleiten versuchen, sollten auf keinen Fall unreflektiert generalisiert werden, warnt die Biologin. Kostenbedingt geringe Fallzahlen sowie gravierende methodische Unterschiede würden Vergleiche und Verallgemeinerungen von Befunden einschränken.
Eben dieses Problem arbeiten WissenschaftlerInnen wie Anelis Kaiser oder Rebecca Jordan-Young im Rahmen vergleichender Meta-Analysen von Brain Imaging-Studien heraus. Kaiser beispielsweise analysierte jene Untersuchungen, in denen unterschiedliche Sprachkompetenzen von Männern und Frauen entdeckt und auf die unterschiedliche Nutzung der beiden Gehirnhälften zurückgeführt wurden. Fazit: In jeder der analysierten Studien legten die NeurowissenschaftlerInnen eine andere statistische Auswertungsschwelle fest. Je niedriger diese Schwelle, desto mehr Hirnaktivität war ausgewertet worden und desto stärker wurde sichtbar, dass Männer ebenso wie Frauen beide Gehirnhälften zur Sprachverarbeitung nutzten. Der mittlerweile ins Alltagswissen eingesickerte Befund, dass Männer und Frauen unterschiedlich kommunikativ seien, ließe sich somit nicht halten. Als ähnlich dekonstruierbar scheinen sich auch Untersuchungen über die mangelnde weibliche Raumorientierung oder ein größeres weibliches Corpus callosum - also den Hirnbalken zwischen rechter und linker Gehirnhälfte - zu erweisen.
Schubladen-Denken
"Neurowissenschaftler, die nur ein einzelnes Exemplar vor sich haben, können nicht angeben, ob es sich um ein männliches oder um ein weibliches Gehirn handelt", beobachtet die Neuropsychologin und Keynote-Sprecherin der diesjährigen NeuroCultures-NeuroGendering-Konferenz, Cordelia Fine in ihrem Buch "Die Geschlechterlüge". Obwohl die Frage nach der Geschlechterdifferenz auch gar kein Hauptforschungsgebiet der Neurowissenschaften darstelle, sei es doch eines der am medial heftigsten rezipierten. Schmitz und andere WissenschaftlerInnen machen für die ungebrochene neurowissenschaftliche Reproduktion von Geschlechterdifferenzen unter anderem den hohen Publikationsdruck verantwortlich: "Auch wenn die Untersuchung eine ganz andere Fragestellung hat: wenn man da irgendeinen kleinen Geschlechtsunterschied findet - sei es nur in einer Gehirnregion von fünfzehn - wird das aufgenommen." Überschneidungen und Ähnlichkeiten zwischen Männern und Frauen würden hingegen auffällig oft in der Schublade verschwinden.
Jede noch so kleine wahrgenommene Differenz zwischen den Geschlechtern gilt also als publikationsträchtiges Ereignis, das sowohl in wissenschaftlichen Journals als auch populärwissenschaftlichen Ratgebern aufgegriffen wird. So entstehen "typische männliche" und "typisch weibliche" Gehirne. Bekannt sind die millionenfach verkauften Ratgeber des Kommunikationstrainer-Ehepaares Allan und Barbara Pease über Frauen, die "nicht einparken" und Männer, die "nicht zuhören können". Aber eben auch NeurowissenschaftlerInnen wie Louann Brizendine springen auf den lukrativen Zug der biologisch fundierten Geschlechterdifferenz auf. "Sex sells. Sex and Brain sells even better", kommentiert Philosophin und Biologin Nicole Karafyllis diese Medienpopularisierung des Gehirns.
Neuro-Sexismus
Aus Sicht der meisten NeurowissenschaftlerInnen seien Männer und Frauen zwar gleichwertig, aber je unterschiedlich und in ihren Fähigkeiten hoch spezialisiert, fasst Schmitz die Befundlage zusammen. Dennoch würden aus Neurobefunden Schlussfolgerungen über die geschlechtsspezifische Bildungs- oder Arbeitsmarktpositionierung gezogen - und dies, obwohl das Gehirn doch plastisch sei. Der Neurologe Baron-Cohen etwa zieht aus seinen Untersuchungen den altbekannten Schluss, dass Frauen aufgrund ihrer neuronalen Verfasstheit für Pflege- und Haushaltsarbeiten einfach besser geeignet seien als Männer. Cordelia Fine und andere WissenschaftlerInnen sehen darin einen erstarkenden populärwissenschaftlichen Neurosexismus: „Wer gerade noch zu den altmodischen Sexisten gehörte, steht plötzlich auf der Seite der modernen Naturwissenschaft." (Augusta Dachs, dieStandard.at, 12.9.2012)