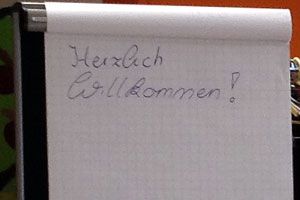Niemandem ist auch nur das Geringste anzumerken, obwohl kaum einer der acht Menschen, die sich im Nachbarschaftszentrum Rennbahngasse um einen Tisch versammelt haben, die Wahrnehmung hat, "in sich selbst" zu sein. Jung, gebildet, sensibel und mit einer guten Portion schrägen Humors ausgestattet, das ist der erste Eindruck, den ich von der Runde gewinne. Doch das Gros der Teilnehmer, die sich jeden zweiten Freitag im Monat um 16 Uhr zur Wiener Selbsthilfegruppe Depersonalisation und Derealisation (im Folgenden "DP/DR") treffen, fühlt sich wie in einem nicht enden wollenden Traum gefangen, wie ferngesteuert, wie hinter einer gläsernen Wand, wie unter Wasser, kurz: sich selbst und, darüber hinaus, meist auch der Umwelt entfremdet.
Ein Leben in hoher Konzentration
Der Schriftzug "Herzlich Willkommen" prangt von einem Flipchart. Die meisten der Teilnehmer sind unter 30 Jahre alt. Nicole*, die Initiatorin der Selbsthilfegruppe, hat Brötchen hergerichtet. Mit Sorgfalt und Achtsamkeit, so wie sie auch jedes ihrer Worte wählt, oder mir am Ende des Gruppenabends Chilis aus dem eigenen Garten, schwarzen Sesam für das Gedächtnis und Schoko-Yogi-Tee mit auf den Weg geben wird. Drei Lebensmittel, die sie mit Kopf und Bauch ausgewählt hat und die so sehr meine Vorlieben treffen, dass dieses Geschenk zuhause die Dimension eines kleinen Wunders einnehmen wird.
Sorgfalt und Achtsamkeit im Denken, Reden und Handeln sind wohltuende und zugleich rare menschliche Verhaltensweisen. Im Laufe des Abends gewinne ich den Eindruck, dass die permanente hohe Konzentration der Betroffenen auf sich selbst und ihre Umgebung die Ursache für diese Haltung ist. Denn wer sich, wie bei der Depersonalisation, außerhalb seiner selbst fühlt und/oder - im Falle von Derealisation - die Umwelt als entfremdet wahrnimmt, der muss sich mehr als andere Menschen auf seine Bewegungen, Worte, Taten, seine Mitmenschen und auf alle Dinge rundum konzentrieren. Um im Alltag und im Job überleben und funktionieren zu können. Eine Tugend also, die aus einer Not heraus entstanden sein mag.
"Dort haben sie nur geschaut, ob ich eingeraucht bin"
Doch zurück an den Start. Ich setze mich abseits der Gruppe in eine Ecke um den Gesprächsverlauf durch meine Anwesenheit nicht zu sehr zu beeinflussen. Um 16.15 Uhr heißt Nicole die Teilnehmer der Gruppe willkommen. Einige kennen sich bereits, andere sind zum ersten Mal hier. "Ich habe zwar noch keine Diagnose", stellt sich der knapp 25 Jahre alte Thomas vor, "aber ich denke, ich leide seit vier Jahren an Derealisation. Ich nehme mich selbst wahr, aber die Welt erscheint wie durch eine durchsichtige Mauer, und das wird ständig schlimmer. Der Zustand ist schleichend gekommen und von einem ständigen Angstgefühl begleitet. Ich wusste lange nicht, was das sein kann und bin erst durch Recherche auf DP gekommen." "Hast du Panikattacken?", fragt Martin, ein Angehöriger, der früher selbst von DP betroffen war, sich heute um Organisation, Webseite und Forum kümmert und gemeinsam mit Nicole die Moderation der Gruppe übernommen hat. "Nein, bis jetzt nicht", meint Thomas.
Julie ist mit knapp 18 die jüngste hier. Mitten in der Nacht hat sie eine Panikattacke aus dem Schlaf gerissen. "Danach habe ich alles wie durch einen Schleier erlebt", erzählt die Schülerin. "Einerseits ist alles wie in einem Film, andererseits so, als würde ich die ganze Zeit neben mir stehen." Ohnmacht und Angst waren so groß, dass Julie nur noch heulen konnte. Schließlich suchte sie Hilfe in einem Niederösterreichischen Krankenhaus in der Kinder- und Jugendabteilung. "Dort haben sie nur geschaut, ob ich eingeraucht bin, dann haben sie mich wieder weggeschickt", erzählt Julie. "Und, warst du?", fragen die Gruppenteilnehmerinnen. "Nein, ich habe keine Erfahrung mit Drogen", kontert Julie. Heute fühlt sie sich im Wiener AKH auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie gut betreut. Zur Stimmungsaufhellung nimmt sie Antidepressiva ein.
"Alles andere als jung und dynamisch"
Neu in der Gruppe ist auch die 37-jährige Dagmar. Seit gut zwanzig Jahren leidet sie permanent an DP und DR. Im Unterschied zu vielen Betroffenen, glaubt sie den Auslöser zu kennen: "Ich habe mit 15 Jahren Haschisch geraucht und beobachtet, wie alles um mich herum unwirklich wurde und wegdriftete." Dieser Zustand ist eine Zeitlang geblieben, kurzfristig wieder weggegangen und später dauerhaft wieder gekommen. "Es ist eine extreme Belastung. Manchmal fühle ich mich wie 80 und nicht wie 38", erzählt Dagmar, die mit zwei Kindern, Mann und Job mitten im Leben steht. In letzter Zeit sei es immer schlimmer geworden, weshalb sie in Krankenstand gehen musste.
Der etwa 30-jährige Paul leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung und setzt neuerdings auf eine Viertel Tablette Ritalin am Tag; ein Amphetamin, das gegen ADHS zum Einsatz kommt. "Das hilft mir extrem", sagt er. "Wogegen hilft es dir ganz konkret?", will Thomas wissen. "Dagegen, dass ich meistens das Gefühl habe, hinter Glas zu sitzen, dass ich Gesprächen nicht folgen kann, nicht in die Gänge komme, alles andere als jung und dynamisch bin - und gegen den ganzen damit verbunden Stress", sagt Paul. "Aber Amphetamine bringen dich doch noch weiter 'rauf‘?" merkt Martin an. "Der Schritt im Kopf, Amphetamine zu nehmen, um entspannen zu können, ist am Anfang ein sehr großer gewesen", erklärt Paul. In Angriff genommen hat er ihn gemeinsam mit seinem Psychiater. Da Ritalin innerhalb von zehn Minuten wirkt, versucht er es zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. "Ich muss immer darauf achten: Wann geht es bei mir in Richtung Manie, und wann bin ich total gelähmt?"
Bislang ohne Diagnose
Auch Dagmar experimentiert gemeinsam mit ihrem Arzt mit einem Medikament, konkret mit Oxytocin, einem Schwangerschaftshormon, das die emotionale Bindung von Müttern zu ihren Babys fördert und derzeit Untersuchungsgegenstand bei der Erforschung von Sozialphobien und verwandten Störungsbildern ist. "Bis jetzt war es so", erzählt Dagmar, "nur wenn ich sehr starke Beruhigungsmittel in einer höheren Dosierung eingenommen habe, bin ich manchmal richtig 'rausgekommen‘, und alles ist plastisch geworden, aber immer nur für kurze Zeit. Dann sind da wieder dieses Gefühl der Unwirklichkeit und diese Aufgeregtheit."
Was in der ersten halben Stunde angeklungen ist, wird sich im weiteren Verlauf bestätigen: Kaum ein Betroffener in der Selbsthilfegruppe hat bislang eine Diagnose auf DP/DR bekommen. Die meisten sind auf Angststörung oder Depression eingestuft, andere leben trotz ärztlicher Betreuung bis jetzt ohne Diagnose.
"Hörst du Stimmen?"
Als beinahe einzige in der Runde verfügt Anna über die Diagnose DP/DR. "Es ist schon ein gutes Gefühl, das endlich zu wissen", sagt die knapp 20-jährige Köchin, die seit zwei Jahren daran leidet. Als Auslöser für die Erkrankung sieht sie ihren ehemaligen Job in einem Dubliner Pub, der mit Stress, Drogenkonsum und sozialer Isolation einhergegangen ist. Doch ein Wermutstropfen trübt die korrekte Diagnose: "Mein Arzt meint, dass ich präpsychotisch bin und dass ich bereits Symptome einer schizophrenen Erkrankung habe", erzählt Anna. "Hast du tatsächlich Symptome in diese Richtung? Hörst du Stimmen?", fragen die anderen. "Nur einmal, als ich zu viele Drogen konsumiert habe..." "Und du weißt über die Erkrankung, an der du leidest, Bescheid und kannst sie artikulieren", stellen die Gruppenteilnehmer unisono fest. "Das ist bei Schizophrenen nicht der Fall."
Anna bekam von ihrem Arzt im Hinblick auf die Diagnose ein Neuroleptikum verschrieben, das sie sehr beeinträchtigte, weshalb sie es wieder abgesetzt hat. Derzeit lebt sie ohne medikamentöse Behandlung. "Seit ich wieder einen Job habe, geht es mir viel besser. Wenn ich abgelenkt bin, kann ich die Depersonalisation für mehrere Stunden vergessen. "Jetzt will meine Psychotherapeutin, dass ich wieder Medis einnehme, weil sie sich Sorgen um mich macht."
"Wer bin ich?"
"Ich habe schon so massive DP Zustände gehabt, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, nach Luft gerungen und mich gefragt habe: Wer bin ich?", schildert Dagmar. "Dann bin ich an einen tollen Neurologen gekommen, der eine Untersuchung meiner beiden Gehirnhälften angeordnet hat. Das Ergebnis war: Auf einer Seite ist irgendetwas nicht normal. Er hat mir auch ein Neuroleptikum verschrieben, aber ich habe mich nicht getraut es zu nehmen."
Die Betroffenen sind sich einig: Der erste Schritt mit der Erkrankung umgehen zu können, beginnt mit der richtigen Diagnose. Sich nicht nur untereinander austauschen, sondern auch informieren will man innerhalb der Gruppe. Gemeinsam nach kompetenten Ärzten und Therapeuten suchen und, "sollte es einmal notwendig sein, auch einmal zu zwanzigst in einer Arztpraxis auftauchen und das Krankheitsbild erklären."
Eineinhalb Stunden sind vergangen, zwei Rauchpausen wurden beim Hintereingang des Nachbarschaftszentrums abgehalten, auf den Tellern am langen Tisch liegen noch zwei einsame Brötchen. "Wie zufrieden seid ihr grundsätzlich mit euren Ärzten?", fragt Martin in die Runde und löst damit bei manchen Emotionen aus. "Als ich meinem Therapeuten neulich wieder einmal erklärte, dass ich gar nicht richtig 'da‘ bin, hat er zu mir gesagt: "'Aber Sie sind ja da!‘ Das ist so mühsam...", seufzt Anna. "Der wollte wahrscheinlich eine Art Anker setzen", meint Thomas. "Aber es klingt so, als ob man sich‘s aussuchen kann, ob man DP hat oder nicht", ist sich die Gruppe einig.
"Don‘t go on with your Doctor-Shopping!"
So ziemlich das Schlimmste, was sie sich jemals anhören müssen habe, meint Dagmar, sei angesichts ihres gut zwanzig Jahre währenden Leidensweges die Aussage eines Neurologen gewesen: "Don‘t go on with your Doctor-Shopping!"
Bei Martin lautete die Diagnose "Burn Out". "Der Arzt verordnete mir Urlaub und diese Tabletten mit den Blümchen drauf" - "Trittiko", rufen die anderen in der Gruppe. "Ich habe sie einmal genommen, und es ist mir schlecht gegangen. Ich wusste, ich muss mein Leben ändern, habe zum Trinken und zum Rauchen aufgehört und meinen Job gewechselt. Das hat mir total geholfen."
"Das ist bei mir leider nicht der Fall", erzählt Nicole, die im Frühjahr 2012 aus der Enttäuschung heraus, kaum mit DP/DR vertraute Ärzte zu finden und damit Hilfe zu bekommen, die Selbsthilfegruppe ins Leben rief. "Ich hatte in meiner Kindheit DP und DR, dann war das eine Zeitlang weg. Vor ein paar Jahren auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ist sie völlig unvermutet und sehr massiv über mich hereingebrochen. Ich habe noch nie Drogen genommen und leide trotzdem an DP", sagt Nicole in die Runde. "Jetzt gerade bin ich zum Beispiel 'komplett draußen‘, aber das ist für niemanden zu bemerken. Auch für die Ärzte nicht." 2.500 Psychiater, Neurologen, Allgemeinmediziner, Psychotherapeuten und Institutionen hat Nicole bis jetzt kontaktiert und mittels Broschüre informiert.
"Ich hatte Glück"
"Ich hatte Glück", meint dagegen Paul. "Nach einer langen Zeit ohne Diagnose - denn die posttraumatische Belastungsstörung kommt in den Köpfen der meisten Psychiater nicht vor - hat mir eine Freundin einer Bekannten eine Ärztin empfohlen. Das war für mich der Beginn eines neuen Lebens."
Auch Thomas ist sehr zufrieden mit seinem Psychiater, "obwohl er die Depersonalisationsstörung negiert. Ich nehme Antidepressiva, weil er meint, dann bin ich weniger verletzbar. Aber ich bin trotzdem sehr sensitiv." "Sind die Medikamente gut für dich?", fragen die anderen. Thomas ist sich nicht sicher. Anna wirft ein: "Mein Psychiater sagt, dass die Depersonalisation ein Schutz vor Gefühlen ist. Da hat er sicher recht."
Dagmar: "Apropos Gefühle - was mich richtig wütend macht: Ich habe schon öfters in der Zeitung so etwas gelesen wie 'Der Serienkiller war depersonalisiert.' Die haben keine Ahnung!" Paul: "Das ist so gemeint, dass der Täter keine Gefühle hatte." Dagmar: "Ich habe trotz meiner DP viele Gefühle, ich nehme halt alles etwas anders wahr." Und schon ist man mitten in einem Schlüsselthema angelangt: Es geht um Emotionen und Aggressionen.
Als Kind immer der Sonnenschein
"Ich war als Kind und in der Schule immer der Sonnenschein", erzählt Nicole. "Es war unglaublich anstrengend, das aufrecht zu erhalten." "Das stimmt, immer sollen alle nett zueinander sein", meint Paul. "Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie wütend auf meine Eltern gewesen", erzählt Anna. Dabei habe sie bereits als Kind die vernünftige und fürsorgliche Rolle übernehmen müssen.
Eine Diskussion über mögliche Auslöser in der Kindheit entspinnt sich; von der viel zu frühen Übernahme von Verantwortung bis hin zur überbehüteten Kindheit. Manche konnten die Aggressionen ihren Eltern gegenüber zeigen, manche fühlen sie bis heute nicht. "Das Beste ist doch, wenn du jemandem auf positive Art und Weise sagen kannst, dass er ein Arschloch ist", stellt Martin fest.
Da sich die Gespräche nun um die positiven Dingen des Lebens zu drehen beginnen, ist kurz vor dem Ende des Abends ein weiterer Themenwechsel angesagt. "Gibt es etwas abseits von Medikamenten, das euch hilft?" fragt Martin. "Mein Arzt sagt, Sport hilft", meint Thomas. "Macht ihr Sport? Bringt es euch etwas?" "Ja, ich kann mich besser spüren", sagt Paul, der Extremsport betreibt und "ein Adrenalin-Junkie" ist. Dagmar kann das bestätigen. In Einvernehmen mit ihrem Psychiater betreibt sie nun auch wieder mehr Sport. Für Nicole ist Sport dagegen nur in Begleitung ihres Freundes möglich, "weil ich alleine nicht richtig fühlen kann, wenn ich mich bewege, ob das jetzt meine Hand ist, oder nicht. Obwohl ich weiß, dass es meine Hand ist, fühlt sie sich fremd an."
Anna hat seit kurzem ein Fahrrad und unternimmt nun manchmal Radtouren mit ihrem Vater, "aber das ist nicht gut", meint sie. "Es ist optisch so anstrengend. Das sind zu viele Eindrücke, ich muss mich extrem auf das Verkehrsgeschehen die Geschwindigkeit und das Gleichgewicht konzentrieren. Dazu kommt Gangunsicherheit nach dem Radfahren. Autofahren geht gar nicht, da kommt noch das Gefühl dazu, eingesperrt zu sein."
"Anstrengende Optik"
Auch für Dagmar ist die anstrengende "Optik" im Rahmen ihrer Depersonalisations- und Derealisationsstörung ein Thema: "Ich fahre trotzdem gerne Auto, und ich habe nicht das Gefühl, eine Gefahr für andere zu sein. Nur Autobahn oder in der Nacht fahren geht nicht. Das ist alles viel zu schnell."
Paul kontert: "Ich kann gar nicht schnell genug fahren. Das hat bei mir mit der Überwindung der Todesangst zu tun. Dagmar: "Ist das nicht vielleicht ein Hang zur Selbstverletzung? Paul: "Ich hatte ein Nahtoderlebnis und das ist so gelaufen: Ich habe gekämpft, solange es ging, und dann ist das Licht einfach ausgegangen. Keine Rede vom Licht am Ende des Tunnels. Jetzt lebe ich wieder und kann in Extremsituationen das Hoch voll auskosten. Am besten, wenn die anderen schon völlig fertig sind." Und er setzt nach: "Ich kann mich nicht entspannen und bin hochgradig beziehungsunfähig."
Wege zur Entspannung
Entspannung ist für die meisten Teilnehmer der Selbsthilfegruppe ein Thema. Oft führt es über Praktiken wie Qui Gong, Tai Chi oder Meditation, wo die bewusste Wahrnehmung des eigenen Ichs und der Umwelt im Zentrum steht. "Einmal habe ich sogar an einer Reiki-Gruppe teilgenommen und von meiner Depersonalisation erzählt", so Dagmar. "Die haben gemeint: 'Du Glückliche, wir würden auch so gerne diesen Zustand erlangen‘". Was für andere vielleicht Erleuchtung sein mag, ist für Dagmar höchstens "Zwangserleuchtung". Aber weil es ihr gelingt, "trotz allem das Positive zu sehen", kann sie neben ihrem Ärger über die gut gemeinte aber unreflektierte Bemerkung lachen.
Vier Stunden und eine herbstlich-kalte Heimfahrt später lasse ich die Eindrücke bei wärmendem Schoko-Yogi-Tee auf mich wirken. Am nächsten Tag "dope" ich mein Gedächtnis mit schwarzem Sesam und schärfe vor dem Schreiben meinen Verstand mit Chili. Drei Geschenke, die mich zu mir selbst bringen. (Eva Tinsobin, derStandard.at, 27.9.2012)
* Sämtliche Namen wurden von der Redaktion geändert
Zum Thema:
"Das Symptom ist nicht in Beton gegossen"
Ein Leben wie im (Alb-)Traum