
Verflucht indeed: Keinen anderen Titel konnte es für diese Rundschau-Ausgabe geben, nachdem sie sich durch eine Reihe unterschiedlicher Faktoren - allen voran die nicht enden wollende Grippe-Epidemie - wieder und wieder verzögert hat. Aber sei's drum. Blicken wir nach vorne, wie es sich für eine Ausgabe zu "Jahresbeginn" gehört, und kiebitzen mal, worauf wir uns 2013 so freuen dürfen.
George R. R. Martin mal anders
Zum Beginn ein willkommenes Comeback: Mit "Dschiheads" veröffentlicht Altmeister Wolfgang Jeschke seinen ersten neuen Roman seit sieben Jahren. Die auf einem abgelegenen Planeten angesiedelte Geschichte verbindet religiöse und ökologische Motive und wird im Juni bei Heyne herauskommen. Kurz danach liefert der Verlag mit Paolo Bacigalupis "Versunkene Städte" ("The Drowned Cities") die Fortsetzung von "Schiffsdiebe". Der Titel aus dem Heyne-Programm, auf den ich mich am meisten freue, ist allerdings "Planetenwanderer", die längst überfällige Übersetzung von George R. R. Martins humorvollem Klassiker "Tuf Voyaging" über einen interplanetaren Handlungsreisenden in Sachen Biotechnologie.
Apropos Martin: Seine Reihe "Das Lied von Eis und Feuer" hat Blanvalet den seltenen Fall eines Kassenmagneten mit hoher Qualität beschert, steht aber nun fürs Erste still, bis Martin den nächsten Band fertiggeschrieben hat (und für so etwas braucht er bekanntlich lange). Als neuen Fantasy-Hoffnungsträger sieht der Verlag 2013 Royce Buckingham mit seinem Epos "Die Karte der Welt" ("Mapper"), das im Juli erscheint - ungewöhnlicherweise auf Deutsch zuerst.
Auf der dunklen Seite
Bastei Lübbe hat die Steampunk-Reihe "Burton & Swinburne" von Mark Hodder übernommen. Der erste Band ("Der kuriose Fall des Spring Heeled Jack", hier der Rückblick auf die Rezension der Originalversion) ist bereits erschienen, im August folgt mit "Der wundersame Fall des Uhrwerkmanns" ("The Curious Case of the Clockwork Man") der zweite. Und auch bei seinen SF-Autoren beweist der Verlag Treue. Von Peter F. Hamilton kommen heuer gleich mehrere Titel auf den Markt: Neben Wiederveröffentlichungen vor allem die Storysammlung "Die Dämonenfalle" ("Manhattan in Reverse") und im Sommer die Space Opera "Der unsichtbare Killer" ("Great North Road", erst im letzten Jahr veröffentlicht). Dazu kommt mit "Die Vergessenen" ("The Technician") ein neuer Titel aus Neal Ashers erfolgreicher "Polis"-Reihe heraus.
In Sachen Horror fällt unter anderem "The Fall of Hades" von Jeffrey Thomas auf, das im Spätsommer als "Der Untergang der Hölle" bei Festa erscheinen wird: Der jüngste Roman aus der "Hades"-Reihe des "Punktown"-Autors, die mit einer Cyperpunk-Version der Hölle aufwartet. Und wenn wir schon beim Thema Horror sind: Im Sommer werden wir dann auch endlich wissen, wie sich Brad Pitt als Produzent eines Zombiefilms macht. "World War Z" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Max Brooks, und rechtzeitig zum Kinostart bringt Goldmann noch einmal eine Neuauflage heraus ("Operation Zombie"; diesmal hoffentlich ohne den dämlichen Titelzusatz "Wer länger lebt, ist später tot").
Ich Edgar, du Leser
Einen Kassenknüller erhoffen sich auch die Macher des viermilliardsten Tarzan-Films, der ebenfalls im Sommer anlaufen wird. In 3D und mit Kellan Lutz in der Titelrolle, naja. Hier ist das Crossover-Marketing ungleich interessanter: Heyne wirft im Juni "Das Buch zum Film" auf den Markt, soll heißen drei Originalromane von Edgar Rice Burroughs zu einem 700-Seiten-Wälzer zusammengestellt. Wer nach einem knappen Jahrhundert Tarzan in unzähligen Versionen nicht mehr weiß, was für ein Bild vom Lord des Lendenschurzes das richtige sein soll, kann hier nachlesen, wie diese Ikone der Popkultur ursprünglich konzipiert war.
Fast so alt wie Tarzan sind die Romane "Last and First Men" und "Starmaker" von Olaf Stapledon, die Heyne nach einigen Verschiebungen im Juni als "Die Geschichte der Zukunft" herausbringen will. Und eine Future History ist es fürwahr: Kein Autor vor ihm und kaum einer danach wagte sich so weit in die Zukunft vor wie Stapledon.
Neuere Visionen
Wie eine Giraffe aus einer Elefantenherde ragte 2011 der atemberaubend technoide SF-Roman "Quantum" von Hannu Rajaniemi aus dem Programm des Piper-Verlags, der doch in seiner Phantastik-Schiene primär auf Fantasy setzt. Aber er hat sich offenbar gut genug verkauft, denn der Nachfolgeband "Fraktal" ("The Fractal Prince") kommt im März heraus.
Mit seinen biotechnologischen Visionen im Band "Prothesengötter" begeisterte 2008 der deutsche Autor Frank Hebben. Umso bedauerlicher, dass seine nächste Storysammlung "Das Lied der Grammophonbäume" zunächst nur als eBook erschien. Doch heuer folgt die große Print-Welle: Der Begedia-Verlag bringt sowohl die "Grammophonbäume" als auch die Cyber-Anthologie "Fieberglasträume", für die Hebben als Co-Herausgeber fungierte, in Druck - während das Haus Shayol gerade erst Hebbens Storysammlung "Maschinenkinder" auf den Markt gebracht hat.
Wurdack startet ein Shared Universe unter dem Titel "Die Neunte Expansion" mit dem Far-Future-Szenario einer Menschheit, die zum Dienervolk eines Alien-Imperiums geworden ist; pro Jahr sind vier Romane von verschiedenen AutorInnen geplant. Septime hat für Frühling den nächsten Band seiner James Tiptree Jr.-Reihe angekündigt ("Houston, Houston!"). Und der Atlantis-Verlag wird 2013 die SF gegenüber Fantasy und Horror herausstreichen. Hier steht unter anderem die Wiederveröffentlichung der legendären "Earl Dumarest"-Saga von E. C. Tubb an, die es von den späten 60ern bis Mitte der 80er Jahre auf über 30 Bände gebracht hatte.
Preiswürdig
Golkonda setzt indes nicht nur seine (Meta-)Fantasyreihe "Nimmèrÿa" von Samuel R. Delany fort, sondern wartet im Frühling auch mit einem besonderen Schmankerl auf: "In einer anderen Welt" ist die Übersetzung von Jo Waltons "Among Others", einem Roman über die Macht der Fantasie, der im vergangenen Jahr sowohl den Hugo als auch den Nebula ... und zum Drüberstreuen ein paar andere Preise gewonnen hat (hier die Nachlese).
Heuer wird unter anderem "2312" von Kim Stanley Robinson ins Rennen um den Nebula Award gehen, ein Roman, in dem die Menschheit mittels kühn konstruierter Habitate so gut wie das gesamte Sonnensystem besiedelt hat. Hurra: "2312" steht bei Heyne unmittelbar vor der Veröffentlichung - womit wir wieder in der Gegenwart angekommen wären und die Rundschau wieder ihren Normalmodus aufnimmt.
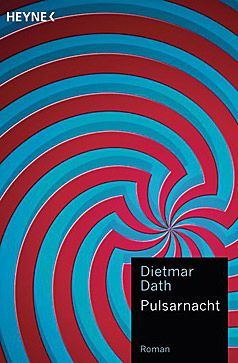
Dietmar Dath: "Pulsarnacht"
Kartoniert, 432 Seiten, € 14,40, Heyne 2012
Im Jahresrückblick 2012 hatte ich noch beklagt, dass mir ein neuer großer deutschsprachiger SF-Roman fehlt. Und zack! Kurz darauf war er da, prompt geliefert wie eine Calzone. Und tausendmal üppiger. "Pulsarnacht" teilt eine Eigenschaft mit herausragenden Genrewerken wie Ian McDonalds "Cyberabad" oder Hannu Rajaniemis "Quantum" - nämlich den Eindruck zu erwecken, dass auf jeder Seite mindestens doppelt so viel steht wie in einem durchschnittlichen Buch. Und das ist keine Frage des Layouts. Eine fordernde Lektüre, aber sowas von lohnend!
Souveräner Grenzgänger
Dietmar Daths Vita allein würde Seiten füllen, im weiten Land zwischen Popkultur und Gesellschaftspolitik scheint der Autor und Journalist ja so gut wie an jeder Ecke zuhause zu sein oder zumindest ein paar Gedanken beisteuern zu können. Nachdem im deutschsprachigen Raum die Berührungsängste zwischen Genreliteratur und ... allem anderen wesentlich größer sind als in der englischsprachigen Welt, ist solch souveränes Grenzgängertum besonders erfreulich. Dath gehört zu den wenigen AutorInnen, die es mit Genre-Plots auch in die Mainstreamliteraturkritik geschafft haben.
Dass "Pulsarnacht" im Följetong ein geringeres Echo ausgelöst hat als vor ein paar Jahren "Die Abschaffung der Arten", dürfte nicht zuletzt dran liegen, dass Dath hier sein bislang eindeutigstes Genre-Werk vorlegt. Das beginnt mit dem für MainstreamleserInnen eher abschreckenden Mechanismus, dass wir vorwarnungslos in eine überaus exotische Welt hineingeworfen werden, und reicht bis zu einem Wording, das vor originellen Neologismen nur so strotzt: Marcha, twiSicht, Tlalok usw... - am Romanende gibt's dafür dankenswerterweise ein Glossar. "Pulsarnacht" ist SF pur.
Das Setting
Mit den Vereinten Linien (VL) führt uns Dath in eine an Iain Banks' "Kultur" erinnernde pangalaktische Zivilisation, die ebenfalls keine Erwerbswirtschaft mehr kennt, für die atemberaubende Hochtechnologie bis hin zu Dysonsphären der Alltag ist und die ihren BürgerInnen nahezu vollständige Verfügungsgewalt über ihre Körperlichkeit ermöglicht: Wiedergeburten, Wechsel des Geschlechts und Polysexualität sind die Norm. Nur der Vermehrung wurden Grenzen gesetzt. Die Linien - also Familien bzw. Häuser - sind eine Art Fortsetzung des Evolutionsprinzips auf gesellschaftlicher Ebene. Einige Themen, die Dath schon in "Die Abschaffung der Arten" verwendet hatte, kehren hier also noch einmal wieder.
Noch ein paar Vergleiche: Mit China Miéville teilt Dath den sprachlichen Furor und den barocken Detailreichtum, mit Hannu Rajaniemi die Einbindung wissenschaftlicher Konzepte, die zu quasi-magischen praktischen Anwendungen geführt werden. "Pulsarnacht" steht auf einem wissenschaftlichen Fundament oder versteht es zumindest, geschickt diesen Eindruck zu erwecken. Die einem Sachbuchtext würdigen Satzgefügekonstruktionen tragen ihren Teil dazu bei ...
Es treten auf: Planetengroße Weltraum-Lebewesen, deren Gedanken sich in Form kleiner Ideentierchen manifestieren. Ein Volk, dessen Angehörige allseits als "biologische Geräte" betrachtet werden, das sich aber für die wahre Menschheit hält. Oder Raumschiffe voller "eingefalteter virtueller Kilometer", wie es überhaupt vor ineinandergeschachtelten Räumen und Dimensionen nur so wimmelt. Atemberaubend auf die Spitze getrieben in der Beschreibung der total-urbanisierten diamantenen Welt Yasaka, neben der sich die "Star Wars"-Hauptstadt Coruscant wie eine provinzielle Plattenbausiedlung ausnimmt. Als Leser stolpert man wie betäubt zwischen all den unzähligen Aaah- und Oooh-Effekten herum; Dath sollte bezahlte Führungen in seine Welt anbieten.
Der Kataklysmus
Ein wichtiger Unterschied zu Banks' "Kultur", die ihren utopischen Endzustand erreicht hat, ist der Umstand, dass es in Daths VL sehr wohl noch gesellschaftspolitische Konfliktlinien gibt - ein Thema, das für den Autor stets zentral war. Das kommt in "Pulsarnacht" immer wieder an die Oberfläche, sei es in tendenziell essayistischen (aber keineswegs aufdringlichen oder langweiligen) Passagen, in denen gesellschaftliche Mechanismen reflektiert werden. Oder sei es im zentralen Konflikt zwischen den beiden Hauptfiguren, der auf Wiederholung und Konstanz setzenden VL-Präsidentin Shavali Castanon und dem für Veränderung stehenden Revolutionär César Dekarin.
Rund um die beiden und ein kleines Grüppchen anderer ProtagonistInnen setzt sich eine große Veränderung in Gang. Dabei stehen gesellschaftliche und persönliche Aspekte im Vordergrund, der im Klappentext verheißene kosmische Kataklysmus findet eher zwischen den Zeilen bzw. am Rande der Wahrnehmung statt. Zeitweise macht es den Eindruck, als würde Dath mit der prophezeiten Pulsarnacht - einem Ereignis, von dem alle wissen, dass es physikalisch unmöglich sein müsste - den größten MacGuffin der Geschichte abliefern (immerhin so groß wie das ganze Universum ...). Aber sie wird schon noch rechtfertigen, dass sie zu Titel-Ehren gekommen ist.
Volle Punktezahl, außer fürs Catering
Scharfsinnig gedacht und üppigst ausgestattet - was kann man von einem Roman mehr erwarten? Am Ende gibt's noch einen Twist, dessen eine Hälfte sich erahnen ließ, während die zweite als ziemliche Überraschung daherkommt. Und wer nach all dem Gesagten Angst hat, dass "Pulsarnacht" vielleicht gar zu theorielastig sein könnte: Keine Angst, der Roman hat auch Raumgefechte und jede Menge sonstiges Schießen, Hauen und Stechen zu bieten.
Unwichtige kleine Anmerkung am Rande und gewissermaßen noch einmal auf die eingangs erwähnte Calzone zurückkommend: "Pulsarnacht" schwelgt so sehr in seiner Opulenz wie die diamantene Welt ... auf allen Ebenen bis auf eine. Das Essen. Immer wenn's um Kulinarisches geht, wird's vergleichsweise geradezu banal. Verblüffend, ein im ersten Romandrittel beschriebenes galaktisches Festmahl hat nicht viel mehr zu bieten als ein besseres Hotelbuffet von heute. Inmitten der alle Sinne überlastenden Vielfalt exotischer Einfälle in sämtlichen anderen Themenbereichen fällt das richtiggehend auf. Irgendwie beruhigend aber, dass auch Dietmar Daths Fantasie Grenzen zu haben scheint - zum Glück in einem Bereich ohne Bedeutung. "Pulsarnacht" jedenfalls ist meine persönliche Nominierung für den Kurd-Laßwitz-Preis.
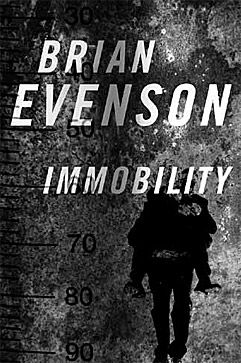
Brian Evenson: "Immobility"
Gebundene Ausgabe, 253 Seiten, Tor Books 2012
Es gibt so Bücher, bei denen man zur Handlung am besten gar nichts verraten sollte, um den vom Autor gewünschten Effekt nicht zunichte zu machen. Soll heißen: Mit absolut null Vorwissen werden wir in eine Welt geworfen, die sich uns in der Folge Enthüllung um Enthüllung langsam erschließt. Brian Evensons jüngster Roman "Immobility" setzt von Seite 1 an voll und ganz auf diesen Effekt. Ein Rezensent, der das würdigen will, steht damit natürlich vor einem Problem. Also machen wir's so: Wer Details erfahren möchte, möge die weiteren Absätze lesen - wer hingegen bereit ist, ein Buch auf gut Glück zu kaufen, soll nach einem einzigen Teaser weiterklicken. Nämlich diesem: "Immobility" ist der richtige Roman für alle diejenigen, die Cormac McCarthys "Die Straße" mochten.
Spoiler-Grenze, so früh wie nie
Und jetzt die Details für die Neugierdsnasen. Eines Tages erwacht Hauptfigur Josef Horkai orientierungs- und erinnerungslos aus dem Kälteschlaf. Er weiß, dass es einen weltweiten Kollaps gegeben hat, aber nicht, was er davor gewesen ist. Seine neue Umgebung jedenfalls ist ein verfallender Uni-Campus, bewohnt von einer kleinen Gemeinschaft Überlebender, die als "Hive" organisiert sind. Anführer Rasmus hat Josef aufgetaut, weil er auf eine Expedition geschickt werden soll - und zwar geht es darum, einen Behälter mit Samen zurückzuholen, der der Gemeinschaft gestohlen wurde.
Es scheint grotesk, ausgerechnet Josef für diese Mission auszuwählen, immerhin ist er querschnittgelähmt (wiederum ohne zu wissen, wie es dazu kam). Aber er scheint auch über erstaunliche körperliche Kraft zu verfügen - so große, dass er den anderen Angst macht. Vor allem aber verträgt er als einziger die Bedingungen der Außenwelt, ohne einen Schutzanzug tragen zu müssen; offenbar handelt es sich dabei um radioaktive Strahlung, auch wenn das Wort im ganzen Roman nie fallen wird. Die Lösung: Josef muss abwechselnd von den beiden Brüdern Qanik und Qatik, die sich als "Mulis" bezeichnen, getragen werden. Zwischen den beiden stoisch ihre Aufgabe erfüllenden Trägern und ihrer stets alles in Zweifel ziehenden "Last" Josef wird sich eine ganz eigene Dynamik entwickeln.
Auf der Straße
Und so begibt sich das Trio auf einen surrealen Trip. Um sie herum der trostloseste Anblick, den man sich ausmalen kann: Keine Tiere, keine Pflanzen, nur Staub und Ruinen. Outside was a ravaged landscape, ruin and rubble stretching in every direction, the ground choked in dust or ash. Remnants of buildings, mostly collapsed. The sky was bleak with haze, and a wind blew, hot and indifferent. All of it was pervaded by a strange, unearthly silence.
Nicht nur die vollkommene Leblosigkeit dieser Welt erinnert an McCarthys "Straße". Auch der lakonisch-minimalistische Stil, in dem "Immobility" erzählt wird, ist ähnlich. Wie McCarthy ist auch US-Autor Brian Evenson an der Grenze von Mainstream- und Genreliteratur zuhause. Typisch für solche Grenzgänger ist, dass sie den nach Erklärung lechzenden Genre-LeserInnen nicht mit Infodumps entgegenkommen, "wie es denn überhaupt zu all dem kommen konnte". Erinnert man sich in "Die Straße" an die Apokalypse nur als rosigen Lichtschein, so ist hier von einem nicht minder vage bleibenden blast die Rede.
Im Nirgendwo
Beide Romane setzen auf ein gewisses Level an Abstraktion - wie um zu unterstreichen, dass ihre philosophischen Anklänge Allgemeingültigkeit beanspruchen. Ganz banal gefragt: Wo sind wir eigentlich? Schwer zu sagen. Im Verlauf von "Immobility" mehren sich die Indizien, dass es der übliche US-amerikanische Hintergrund ist. Die Namen der Romanfiguren - Josef Horkai, Rasmus, Oleg, Olaf, Qanik, Qatik usw., später kommen noch Personen mit Pseudonymen aus verschiedenen Sprachen hinzu - scheinen dem jedoch zu widersprechen.
Und die Orientierungslosigkeit geht noch eine Ebene tiefer. Mehrfach fällt Josef unterwegs in einen Zustand der Bewusstlosigkeit. A sensation of coming back to life, only not quite that: half life maybe. Still utter darkness, though perhaps a faint hint of light on the horizon. A swirl of memory and imagination, a swath depicting a past, real or imaginary, smeared across the inner walls of his skull. Wenn er wieder erwacht, hat er den Faden verloren. Glaubt sich auf eine längst absolvierte Station seiner Reise zurückversetzt, fragt sich, wie er hierher gekommen ist - und hält es sogar für möglich, dass er immer noch träumend im Kälteschlaf liegt.
Empfehlung!
"Immobility" lebt vor allem von seiner Atmosphäre. Die ist in ihrer Eindringlichkeit am ehesten mit Filmsequenzen zu vergleichen, in denen der Regisseur alle Hintergrundgeräusche abgestellt hat und uns nur den Atem des Protagonisten hören lässt. Kein Film, nach dem man beschwingt nach Hause geht. Und was man nach dem Gesagten kaum noch glauben würde: Am Ende von "Immobility" werden alle offenen Fragen beantwortet werden, zumindest die, auf die es ankommt. Großartiger Schluss!
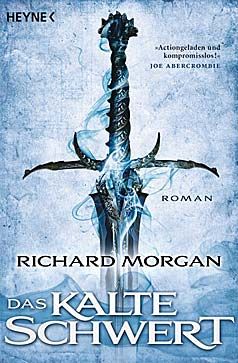
Richard Morgan: "Das kalte Schwert"
Broschiert, 701 Seiten, € 15,50, Heyne 2013 (Original: "The Cold Commands", 2011)
Der alte Haudegen Ringil Eskiath ist zurück - aber er lässt sich gut 70 Seiten Zeit, bis er in "Das kalte Schwert" endlich in Erscheinung tritt. Auch Autor Richard Morgan hatte es nicht übermäßig eilig, den zweiten Teil seiner Fantasy-Reihe fertigzustellen. Immerhin drei Jahre sind zwischen dem Eröffnungsband "Glühender Stahl" ("The Steel Remains") und der gleichermaßen lesenswerten Fortsetzung vergangen. Zwingend notwendig ist es nicht, Teil 1 gelesen zu haben, aber es hilft. Auch beide zusammengenommen lassen allerdings noch genügend Fragen offen - insbesondere zur Welt, in der sich die Handlung abspielt.
Die Welt
Es gibt einige Indizien dafür, dass wir uns auf der Erde in einer immens fernen Zukunft befinden. In der quasi-mittelalterlichen Welt der Romangegenwart ist davon wenig zu merken, doch Reste alten Wissens schimmern noch durch - etwa wenn eine Gottheit explizit auf Schrödingers Katze anspielt. Statt eines Mondes erleuchtet nur noch ein "Band" den Nachthimmel ... und Magie funktioniert (wieder). Ein solcher Hintergrund erinnert unwillkürlich an Jack Vances "Dying Earth"-Romane, aber auch an Ken Scholes' "Psalms of Isaak"-Reihe. Soviel auch zu Morgans gerne mal geäußerten Behauptungen, er habe sich nie um Fantasy gekümmert und stehe in keinem entsprechenden Kontext.
Dabei lässt sich sogar ein Touch Lovecraft ausmachen. Ähnlich wie HPL - und genauso skizzenhaft - entwirft auch Morgan eine weit zurückreichende Historie, die von verschiedenen Wellen außerweltlicher Einflussnahmen gekennzeichnet ist. Und all diese rivalisierenden Mächte - unter anderem ein dunkler Götterhof, die dämonischen Dwenda und schließlich die technisch überlegenen Kiriath - mischen in der einen oder anderen Form immer noch in der Welt der Menschen mit. Die Kiriath sind wieder abgezogen, aber sie haben einige Relikte wie die Steuermänner zurückgelassen; eine Art Künstliche Intelligenzen. Die seltsame Verquickung von Magie, Metaphysik und Technik - letztere wirkt wie Steampunk auf quantentechnologischem Level - siedelt Morgans Erzählung im Niemandsland zwischen den Genres an. Im Kern bleibt es aber Sword & Sorcery.
Die ProtagonistInnen ...
Morgan führt "Das kalte Schwert" in drei weitgehend voneinander getrennten Handlungssträngen, die die Erlebnisse Ringils und seiner einstigen KriegsgefährtInnen Egar und Archeth schildern; erst sehr spät werden die Fäden miteinander verknüpft. Der einstige Steppenkrieger Egar frönt in der imperialen Hauptstadt als eine Art inoffizieller Leibwächter mehr oder weniger dem Nichtstun, bis er von seltsamen Vorgängen im Tempel der neuen Staatsreligion hört. Die Halb-Kiriath Archeth indes bekommt auf andere Weise zu spüren, dass sich im Reich etwas Unheimliches zusammenbraut. Sie arbeitet als Beraterin des machiavellistischen Imperators Jhiral - eine schillernde neue Nebenfigur übrigens, die die Romanreihe mit jedem einzelnen Auftritt bereichert. Archeth wird von einem Steuermann losgeschickt, um einen geheimnisvollen "Botschafter" in der Wildnis abzuholen. Der wird sich als frisch aus dem All gestürzte KI erweisen.
Ringil schließlich, die zentrale Figur, lebt seinen Status als doppelt geächteter Außenseiter seit Band 1 in vollen Zügen aus. Dass Ringil schwul ist und in keinster Weise vorhat im Schrank zu bleiben, hat man ihm schon übel genug genommen. Seit er sich aber zum selbsterklärten Sklavenbefreier aufgeschwungen hat, ist der Ofen endgültig aus - jetzt ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Nicht dass Ringils Mission eine sonderlich zielgerichtete Kampagne wäre; eher schon eine lose Folge persönlich motivierter Racheaktionen.
Überhaupt ist Ringils Weg voller Kurven und unvorhersehbarer Abzweigungen. Immer wieder verschlägt es ihn in die grauen Orte, jene jenseits von Raum und Zeit gelegene Sphäre der Wahrscheinlichkeiten, in der sich auch die zuvor genannten außerweltlichen Mächte bewegen. Und auch wenn man bei einem besonders langen Trip Ringils durch diese Orte zeitweise die Orientierung verliert, wird doch eines klar: Ringils wiederholte Kontakte mit der metaphysischen Welt verändern ihn. Ob zum Guten oder Schlechten, wird sich zeigen.
... als Spiegel ihrer Gesellschaft
Ringil und mehr noch Archeth greifen gerne mal zu Drogen - dass Morgan in den Danksagungen die New-Weird-Autorin Steph Swainston nennt, kommt nicht von ungefähr: Ihr "Komet" Jant Shira ist das Paradebeispiel eines Junkies als Fantasyheld. Keine der drei Hauptfiguren Morgans ist mit sich selbst wirklich im Reinen. Alle drei sind in die Jahre gekommen und weitgehend desillusioniert - passend zur zynischen Welt, in der sich die Handlung abspielt. Das Imperium von Yhelteth hatte nur die Mittel, aber nicht die Moral, sich von der Barbarei zur Hochzivilisation zu erheben - der Schritt zurück wäre nur ein sehr, sehr kleiner. Ganz wie in Richard Morgans früheren SF-Werken (die erfolgreichen "Takeshi Kovacs"-Romane oder "Profit") bestimmen auch hier beinharte ökonomische und machtpolitische Erwägungen bis hinab zur untersten Ebene, was geschieht.
... womit wir auch beim unvermeidlichen Thema Gewalt wären. Man möge mir den Vergleich verzeihen, aber am ehesten erinnert mich Morgans Vorgangsweise an die von Michael Haneke. Gewalt wird in erbarmungsloser Ausführlichkeit geschildert - die von Ringil angeordnete Vergewaltigung einer Söldnerin zieht sich sogar über eine Kapitelgrenze hinweg und ist kaum zu ertragen. Kein heroischer Score von John Williams untermalt die Bluttaten, sie werden als das geschildert, was sie sind: ekelhaft. Bittere Ironie, aber folgerichtig: Der einzig positive Teil von Ringils öffentlichem Image - er ist immerhin ein waschechter Kriegsheld - ist zugleich der, der ihm persönlich am wenigsten bedeutet. Seine Heldentaten hat er nur als Gemetzel in Erinnerung.
Nicht einzigartig, aber originell
Schlussendlich darf man noch anmerken, dass auch Morgans originelle Spielart von Fantasy nicht ganz frei von Klischees ist. Als Motor der Handlung fungiert letztlich doch wieder die altbekannte Requisite "dunkle Bedrohung aus der Vergangenheit kehrt zurück", und auch sprachlich schmuggelt sich das eine oder andere Stereotyp dazwischen: So bilden die Worte "höhnisch" und "grinsen" ein derart treues Paar, dass sie spätestens im dritten Band Goldene Hochzeit feiern können. Der wird "The Dark Defiles" heißen und frühestens Ende des Jahres erscheinen, man darf gespannt sein.
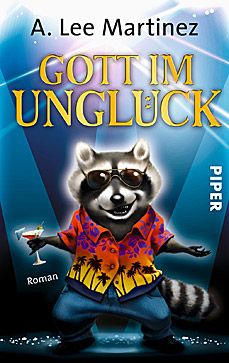
A. Lee Martinez: "Gott im Unglück"
Broschiert, 394 Seiten, € 10,30, Piper 2012 (Original: "Divine Misfortune", 2010)
"Hallo. Mein Name ist Anubis. Ich mag lange Strandspaziergänge, überführe gern die Seelen Verstorbener in die Unterwelt und schätze die Kinokunst von Mr Woody Allen." Kein schlechter Romaneinstieg, das. Teri und Phil schwelgen im suburbanen Jungfamilienglück. Nur mit der Karriere könnte es ein bisschen besser laufen, aber dazu fehlt es an Vitamin B. Und "Beziehungen" bedeutet in dieser Urban-Fantasy-Version unserer Welt: göttliche. Also browsen Teri und Phil online durchs Gottheiten-Vermittlungsportal, um einen geeigneten Schutzpatron zu finden.
Der neue Mitbewohner
Anubis wird's übrigens nicht, die Wahl fällt vielmehr auf Luka respektive Lucky, einen sprechenden Waschbären im Hawaiihemd, dessen übernatürliche Macht sich auf unspektakuläre, aber praktische kleine Glücksfälle beschränkt. Geldscheine auf der Straße finden und so. Allerdings hätte unser Pärchen gedacht, dass es mit der Einrichtung eines kleinen Hausaltars getan wäre. Stattdessen zieht Lucky ein. Speziell Teris Begeisterung hält sich darob in Grenzen, immerhin präsentieren sich die Götter im Roman allesamt als kindische, biersaufende und TV-süchtige Egozentriker. Aber an ihrer Macht gibt's nichts zu rütteln, und umtauschen gilt nicht. Man muss sich also mit der neuen WG-Situation irgendwie arrangieren.
Teris theophiler Freundin Janet fällt das vergleichsweise leicht, Furries liegen schließlich im Trend. Weiters hätten wir da noch die arme Bonnie, die sich eine Göttin der Tragik eintritt, und den widerlichen Chaos- und Todesgott Gorgoz. Die Kapitel mit den Nebenfiguren scheinen zunächst noch von der Haupthandlung abgetrennt, aber es zeichnet sich recht bald ab, wie das alles zusammenhängen wird. A. Lee Martinez will schließlich keine Rätsel weben, sondern unterhalten.
Symbiose mit Kollateralschäden
Martinez ist fraglos der neue Star der Funny Fantasy, und viel trägt dazu seine Vielseitigkeit bei. SF-Elemente ("Der automatische Detektiv") verulkt er ebenso gerne wie Haunted-House-Plots ("Zu viele Flüche") oder Urban-Fantasy-Guerillakämpfe ("Monsterkontrolle"). Sein nach kleinerer Pause jüngster auf Deutsch veröffentlichter Roman baut nun auf einer Prämisse auf, die wir unter anderem von Terry Pratchetts "Small Gods" und Neil Gaimans "American Gods" kennen: Götter und Menschen stehen in einer symbiotischen Beziehung. Die Gottheiten greifen durchaus ins Leben der Sterblichen ein, brauchen aber auch eine ausreichend große Anhängerschar, um ihre übernatürliche Macht wirken zu können.
Wie der Autor das umsetzt, können wir uns von seinen früheren Werken her ausmalen: Situationskomik rules! Sei es ein Überfall durch Amateur-Attentäter, der in erbarmungswürdiger Selbstverstümmelung endet (leg dich nicht mit einem Gott an, der das kleine Glück und Pech steuert). Sei es eine dämonische Erscheinung, die nach der Weltherrschaft greift und an der Bedienung eines Telefons verzweifelt. Sei es die Höllenfahrt eines Fernsehgeräts. Je banaler das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Göttlichem und Alltäglichem ist, desto lustiger ist es auch.
Die göttliche Situationskomödie
"Gott im Unglück" kann seine Verwandtschaft zu Sitcoms nicht ableugnen. Und dazu muss man nicht einmal solche betrachten, in denen ein unirdisches Wesen für Verwicklungen sorgt, etwa "ALF", "Bezaubernde Jeannie" usw. Im Kern könnten "The Fresh Prince of Bel-Air" oder "Dharma & Greg" dafür genauso Pate gestanden haben, denn einen Großteil des Humors bezieht Martinez daraus, dass zwei Lebensentwürfe aufeinanderprallen: Hedonistisch-chaotisch der eine (verkörpert vom pelzigen Lebemann Lucky), eher spießig der andere.
Die übernatürlichen Umtriebe sind da fast nur eine willkommene Draufgabe, um die Absurdität auf die Spitze zu treiben. Und den Boden für herrliche Dialoge wie diesen zu bereiten: "Ist das Ihr Gott? Oder ist es nur einer, den Sie kennen?" - "Meiner." - "Und er hängt mit Ihnen ab? Das ist ziemlich cool. Mein Familiengott schickt uns nur viermal im Jahr einen Newsletter." Oder diesen: "Aber du sagtest, du würdest die Weltmeere mit Blut füllen und die Kontinente mit Knochen übersäen. Du hast versprochen, du würdest Universen für mich zerstören!" - "Das war nur Bettgeflüster, Baby."
Mehr von A. Lee Martinez kommt schon im Mai: Dann erscheint "Der Mond ist nicht genug" ("Chasing the Moon"), wie gehabt bei Piper.

Peter Dehmel (Hrsg.): "Die Erde und die Außerirdischen. Polnische Science Fiction"
Broschiert, 144 Seiten, € 10,30, Wurdack 2012
Wie ein Gruß aus einem anderen Zeitalter wirkt es, was mir da auf den Tisch geflattert ist. Vor gut 30 Jahren, als der SF-Boom auf dem Buchmarkt noch endlos anzuhalten schien, trauten sich die Verlage auch über Nischenprodukte drüber - zum Beispiel Länder-Anthologien. Goldmann etwa gab unter anderem Bände mit SF-Kurzgeschichten aus Japan oder Australien oder Rumänien heraus. Ein Band zu Polen war auch angekündigt; ob der es jemals in Druck geschafft hat, weiß ich allerdings nicht. Das hier hätte er aber werden können: "Die Erde und die Außerirdischen" umfasst acht polnische Erzählungen aus den Jahren 1967 bis '81, ein kleines Schmuckstückchen für alle, die an der Geschichte des SF-Genres interessiert sind.
Jetzt alle mal daheim im Regal nachschauen, was da so an polnischer Phantastik herumsteht: Mit Sicherheit was von Übervater Stanisław Lem, vielleicht auch der eine oder andere Roman von Adam Wiśniewski-Snerg und aus neuerer Zeit am wahrscheinlichsten was von Andrzej Sapkowski; da sind wir dann allerdings schon in der Fantasy. - Die sechs in dieser Wurdack-Anthologie versammelten Autoren waren Zeitgenossen von Lem und Wiśniewski-Snerg, wenn auch hierzulande weniger bekannt. Alle männlich, die meisten akademisch ausgebildet und mit Ausnahme eines Wirtschaftswissenschafters alle in einem naturwissenschaftlichen oder technischen Beruf arbeitend. Ganz klassisch also.
Zu ebener Erd und im ersten Stock
First-Contact-Szenarien sind der rote Faden der Anthologie, und die Begegnung mit Außerirdischen kann auf Mutter Erde stattfinden wie in Janusz A. Zajdels "Welcome on the Earth", wo ein Reporter ein UFO sichtet, oder auch draußen im Weltraum wie in Zbigniew Prostaks "Die Hand". Hier schildert der alte Funker Bert einem skeptischen Publikum die Geschichte seines Lebens, nämlich wie ihn Außerirdische vor einer Havarie im Mars-Orbit retteten - längst daran gewöhnt, dass ihm ohnehin niemand glaubt. Andrzej Czechowski dreht im anekdotischen "Die Wahrheit über den Elekter" den Spieß sogar um und lässt einen Erdenmann gewissermaßen als Alien auf einem Kolonialplaneten landen, auf dem inzwischen Roboter das Sagen haben. Hat einen sehr altmodischen Touch und entzückt mit Wörtern wie Autoinfor, Videotronie und - mein persönlicher Favorit - Superdenkotron.
Zajdel ist mit drei Erzählungen vertreten, die beste davon ist "Wildschweine im Kartoffelfeld", in dem ein Expeditionsteam auf einem fremden Planeten feststellt, dass sie nicht die einzigen sind, die hier Forschungen betreiben. In "Die Götter kehren in den Himmel zurück" wiederum lässt Zajdel einen Jungen im alten Ägypten auf Außerirdische treffen. Und da wirkt sich das Risiko aus, wenn man bei einer Kurzgeschichte auf die Strategie "Pointe" setzt. RTL-Quizfrage: Wird sich der Pharao durch die Schilderung von den himmlischen Besuchern zum Bau a) einer Pyramide oder b) eines Riesenrads inspirieren lassen ...?
Wie man mit der Kürze umgeht
Eine Pointe ist aber zumindest eine Möglichkeit, eine Geschichte trotz Zeilenbeschränkung zu einem Abschluss zu bringen. Sowohl Zajdels "Welcome on the Earth" als auch Konrad Fiałkowskis "Der Gigantomat" (zwei Kosmonauten begeben sich zu einer Raumbasis, die nicht mehr auf Rufe reagiert) wirken unvollständig, eher wie Auszüge aus einem größeren Werk als wie abgeschlossene Geschichten. Die Kürze lässt den Erzählungen gerade genug Platz, um eine Grundidee rüberzubringen. Die weitere Ausstattung bleibt - was gar nicht schlecht sein muss - der Phantasie der LeserInnen überlassen. Prostak etwa nennt kursorisch die märchenhaft bunten, wenngleich für unsere Augen unheimlich fremden Ansichten ihrer Städte. Man vergleiche das mit den ausschweifenden Schilderungen Dietmar Daths in "Pulsarnacht", die letztlich dasselbe aussagen.
Die beste Geschichte stammt vom Ökonomen Dariusz Filar, der bis vor kurzem noch Berater der polnischen Regierung war, in den 70ern aber eine Reihe von SF-Erzählungen veröffentlichte. Wie "Die Keule": Es ist der ewig junge BDO-Plot um ein kilometergroßes Objekt, das auf der Erde gelandet ist und nun mysteriös in der Gegend herumliegt und sich jedem Versuch, ihm sein Geheimnis zu entreißen, widersetzt. Das hat zeitlose Qualität.
Bleibt noch Jacek Sawaszkiewicz mit "Die Schaufensterpuppe", in dem selbige vor einem atomaren Anschlag warnt. Die Geschichte ist auch interessant, weil sie sich in ihrer Konstruktion bei älterer Phantastik bedient. Der Erzähler gibt den Bericht eines Dritten wieder, gegen Ende folgen einige erklärende Zusatzinfos plus eine aufrüttelnde Direktverbindung in die unmittelbare Gegenwart: So hat man vor allem in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gerne erzählt.
Kinder ihrer Zeit
Wie gesagt: "Die Erde und die Außerirdischen" ist primär von historischem Interesse. Da fügt es sich ausgezeichnet, dass sämtliche Erzählungen klar erkennbare Kinder ihrer Zeit und ihres Orts sind. Der "Ort": Der damals noch sozialistische Teil Europas, und für die Science Fiction aus diesen Ländern war es typisch, dass Begegnungen mit Aliens in der Regel friedlich verliefen. Abwehrschlachten gegen außerirdische Invasoren und feindliche Imperien waren eher ein West-Ding, warum auch immer. (Natürlich gibt es dazu genügend theoretischen Überbau, von wegen "Jede hinreichend fortgeschrittene Zivilisation muss per se sozialistisch sein, also kann es zu keinen Konflikten mit der ebenfalls sozialistischen Menschheit der Zukunft kommen und bla", aber das führt jetzt zu weit.)
Und die Zeit: Eindeutig die Ära, als besagter hinreichender Fortschritt offenbar noch allein mit dem dritten Bein vollziehbar schien. Weibliche Hauptfiguren sucht man vergeblich. Vielleicht habe ich was übersehen, aber die erste Frau, die mir hier bewusst aufgefallen ist, hat ihren Auftritt in der letzten Geschichte. Sie serviert ein Sandwich. Ja, so war's eben, damals in der Zukunft!
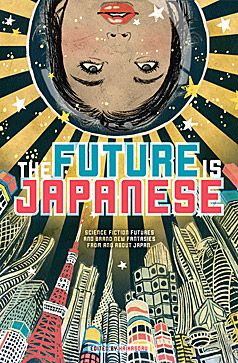
Haikasoru (Hrsg.): "The Future is Japanese"
Broschiert, 366 Seiten, Haikasoru/VIZ Media 2012
Nach der polnischen jetzt eine ... einigermaßen japanische Anthologie. Streng genommen sind nur 5 der 13 hier versammelten Kurzgeschichten Übersetzungen japanischer Originalwerke. Die Mehrheit stammt von - durch die Bank wohlbekannten - englischsprachigen AutorInnen, die Japan als Schauplatz gewählt haben; etwa Bruce Sterling, Pat Cadigan oder Ekaterina Sedia. Der Schwerpunkt liegt auf Science Fiction, und fast alle Stories sind neu. Als entpersonalisierter offizieller Herausgeber fungierte Haikasoru, ein Verlagsimprint des auf Mangas und Animes spezialisierten Unternehmens VIZ Media - dahinter steckt aber de facto US-Autor Nick Mamatas.
Haikasoru hat sich in den vergangenen Jahren einige Meriten als Herausgeber aktueller japanischer Genre-Literatur erworben. Insofern ist der Titel dieser Anthologie auch primär als Imagewerbung zu verstehen - denn eigentlich klingt er schwer nostalgisch. Japan als Land der Zukunft? Das war eher so eine 80er-Jahre-Cyberpunk-Idee. Inzwischen hat China Japan in der Science Fiction längst den Rang abgelaufen. Sogar im Film hat man's schon gerafft. Wie hieß es doch sinngemäß in Rian Johnsons Zeitreise-Geschichte "Looper"? "Geh nach China, dort ist die Zukunft!" Und wir alle wissen, wie weit der SF-Film der SF-Literatur hinterherhumpelt.
Japanisches Menü ...
Die Anthologie findet einen sehr schönen Auftakt in "Mono no Aware" von Kurzgeschichten-Zampano Ken Liu. Im Mittelpunkt der melancholischen Erzählung, die sich auf einem Generationenschiff abspielt, steht der letzte überlebende Mensch mit japanischen Wurzeln. Die Kultur seiner Eltern, an die er sich kaum erinnert, wird für ihn eine wachsende Rolle spielen und den Begriff "Held" neu definieren. Auch "Golden Bread" von Issui Ogawa dreht sich um die Frage kultureller Identität. Allerdings reitet der Autor ein wenig gar zu sehr auf der Ausgangsidee einer Umkehrung herum: Europäischstämmige Menschen, die (in einem Asteroiden-Habitat) eine "japanische" Lebensweise pflegen, und Ostasiaten, die sich als "westliche", milchtrinkende und brotessende, Kolonialmacht gebärden.
Vielschreiber Hideyuki Kikuchi und sein pulpiges "Mountain People, Ocean People" mal außer Acht gelassen, stammen die Geschichten, die mich am meisten beeindruckt haben, von der japanischen Seite. Allen voran Project Itoh, der in der Rundschau schon mit dem Roman "Harmony" vertreten war, und seine auf entsetzliche Weise großartige Erzählung "The Indifference Engine". Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Kindersoldat aus einem afrikanischen Bürgerkrieg. Ihm wird ein Gehirnimplantat eingesetzt, das ihn die Unterschiede zwischen den verfeindeten Volksgruppen nicht mehr erkennen lässt. Doch Hass verschwindet nicht einfach, nur weil er sein Ziel verliert: "The war isn't over. Because I myself am the war."
Vollkommen ohne Actionelemente kommt "Endoastronomy" von Toh Enjoe aus: An einer scheinbar endlosen Eisenbahnstrecke philosophieren die Protagonisten über den sich verändernden Himmel. Unbekannte Wesen scheinen den Menschen aus seiner "kognitiven Evolutionsnische" verdrängt zu haben - und weil es von neuen intelligenten Augen betrachtet wird, verändert sich das Universum selbst. Ebenfalls zur Herausforderung ans Denken wird "Autogenic Dreaming: Interview with the Columns of Clouds" von TOBI Hirotaka, das sich in seiner Komplexität fortwährend steigert. Ausgangspunkt ist eine Art Übertragung des Hannibal-Lecter-Plots auf den Cyberpunk. Ein Software-Agent erzeugt eine virtuelle Rekonstruktion eines gefährlich charismatischen Serienmörders. Dessen Rat wird dringend gebraucht, denn eine virusartige Entität droht das im Virtuellen Raum angesammelte Wissen der Menschheit zu mutieren.
... mit westlicher Sättigungsbeilage
Cyberpunk-Elemente oder zumindest das Spiel mit virtuellen Welten sind auch bei den westlichen AutorInnen der Anthologie stark vertreten, etwa bei Felicity Savage ("The Sound of Breaking Up") oder Pat Cadigan ("In Plain Sight"). Ausgerechnet Cyberpunk-Altstar Bruce Sterling hingegen hat der Virtualität buchstäblich den Saft abgedreht. Schauplatz von "Goddess of Mercy" ist eine japanische Insel in der Ära nach der Auslöschung Tokios durch eine nordkoreanische Atombombe. Auf dieser Insel, einem anarchistischen Piratennest, reist die Friedensaktivistin Miss Sato mitsamt ihren moralischen Prinzipien an, um eine Geisel freizukaufen. Die schwarzhumorige Erzählung glänzt mit operettenhafter Absurdität ebenso wie mit bissigen politischen Kommentaren - etwa zur nuklearen Verwüstung Nordkoreas durch den US-Gegenschlag: [...] pirates were merely people, evil people, and evil was a weakness. Miss Sato feared no evil, but she did fear the righteous wrath of the just. Pirates merely robbed and then fled. The vengeance of the just lasted seven generations.
Ein paar AutorInnen haben sich auch "typisch japanischer" Topoi angenommen und umschiffen dabei Klischees mal mehr, mal weniger gekonnt. Rachel Swirsky etwa siedelt ihre Geistergeschichte "The Sea of Trees" im berühmt-berüchtigten Selbstmörder-Wald Aokigahara am Fuße des Fuji an. Ekaterina Sedia verknüpft in ihrer Story "Whale Meat" einen Kriminalfall mit dem Thema Walfang und setzt dabei nur sehr subtil SF-Elemente ein. David Moles greift in "Chitai Heiki Koronbin" ein Motiv auf, wie wir es von Animes à la "Neon Genesis Evangelion" kennen: Jugendliche steuern Kampfroboter gegen außerirdische "Monster" - allerdings zeichnet seine Erzählung aus, dass der Mecha-Plot in eine sehr melancholische Atmosphäre getaucht ist. Ach ja, und dann wäre da noch Fantasy-Innovatorin Catherynne M. Valente. Ihr "One Breath, One Stroke" um einen Kalligraphen habe ich allerdings schlicht und einfach nicht kapiert.
Die Bilanz
Wie man schon an dieser Aufzählung bemerkt: Die Anthologie zerfällt eigentlich in zwei Teile. Die westlichen Autorinnen lassen ihre Geschichten in Japan handeln - und die japanischen überall sonst, nur nicht dort. Das bringt auf den Punkt, was an "The Future is Japanese" in einigen Rezensionen kritisiert wurde: Es fehlt eine erkennbare Linie. Was ist eigentlich die Intention hinter der Anthologie? Der Titel lässt erwarten, dass einem hier die aktuelle japanische SF-Literatur nähergebracht werden soll, doch macht diese nur ein Drittel des Umfangs aus. Seltsam.
Allerdings mussten auch die kritisch Gestimmten einräumen, dass die Anthologie einige Geschichten enthält, die den Kauf des Bands absolut lohnen. Parallel zu "The Future is Japanese" habe ich übrigens die 1982 im Goldmann-Verlag erschienene Anthologie "SF aus Japan" gelesen. Damals wurden im Glossar noch so fremdartige Begriffe wie "Tofu" erklärt ... also die Welt hat sich seitdem doch weitergedreht.
P.S.: Jemand, der in "The Future is Japanese" leider nicht vertreten ist, wird jetzt noch nachgereicht:
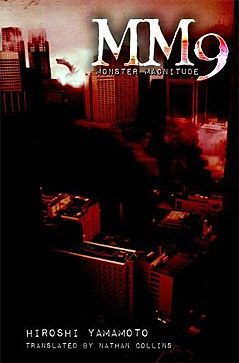
Hiroshi Yamamoto: "MM9"
Broschiert, 251 Seiten, Haikasoru/VIZ Media 2012
Hiroshi Yamamoto könnte Rundschau-LeserInnen als Autor des fantastischen Episodenromans "The Stories of Ibis" in Erinnerung geblieben sein, den ich bei dieser Gelegenheit gleich noch einmal empfehlen möchte. Ging es darin um das Verhältnis von Menschen und Künstlichen Intelligenzen, so dreht sich Yamamotos jüngster ins Englische übersetzter Roman (im Original ist das Buch bereits 2007 erschienen) um das wohl "japanischste" aller Genre-Themen: Kaijū, also Riesenmonster.
In Yamamotos Romanwelt - angesiedelt in unserer Gegenwart - sind Kaijū in allen Formen und Größen Realität, und das schon seit Anbeginn der Geschichte. So manches, das wir aus unserer Welt kennen, findet sich hier daher in etwas anderer Form wieder: Statt eines Raketenprogramms haben die USA von den Nazis einst eine Kaijū-Zucht übernommen, der Giftgasanschlag der Aum-Sekte auf die Tokioter U-Bahn 1995 war ebenfalls ein biologischer usw. Und was bei uns nur über die Leinwand stapfte, gehört in der Parallelwelt von "MM9" ebenfalls zur Historie: Filmfans dürfen sich angespornt fühlen, Yamamotos zahlreiche kleine Anspielungen zu erkennen. So erinnert man sich hier an die Riesenspinne aus dem 50er-Jahre-Schinken "Tarantula" als "Arnold", ein nettes Detail.
Das wissenschaftliche Auge
Das "MM" im Titel steht für "Monster Magnitude", denn hier wird den zerstörerischen Riesenviechern mit wissenschaftlicher Präzision zu Leibe gerückt. The amount of strength per unit of cross-sectional area of muscle and bone was proportional to the cubic root of their volume squared, and their land speed proportional to their volume to the one-sixth power. Their destructive capacity towards buildings was proportional to the cubic root of their volume to the fourth power. Alles klar? Die Einheiten auf der MM-Skala ergeben sich übrigens aus dem Maß der Wasserverdrängung.
Die hier noch vergleichsweise leise Ironie wird noch deutlicher, wenn eine Monsterattacke ganz im Wortlaut einer meteorologischen Warnung angekündigt wird: Kaijū Three has been confirmed in the sea off the Ogasa Island Group, 26 degrees latitude and 139 degrees longitude, moving northward at a speed of forty kilometers per hour. Anders als mit Ironie geht's ja auch nicht, an der physikalischen Unmöglichkeit von Riesenmonstern ist schließlich nicht zu rütteln. Teil der offiziellen MM-Definition ist sogar der Umstand, dass ihre Bestandszahlen (nämlich jeweils eines von jeder Sorte) zu gering ist, um die "Art" überleben zu lassen ... sie es aber irgendwie dennoch tut.
Von der Wissenschaft zur Science Fiction
Interessanterweise belässt es Yamamoto aber nicht dabei, seine LeserInnen augenzwinkernd auf die Paradoxa von Kaijū hinzuweisen, sondern konstruiert einen "erklärenden" pseudowissenschaftlichen Hintergrund. Dabei bezieht er sich auf den Psychologen Julian Jaynes, der in den 70er Jahren eine Theorie veröffentlichte, derzufolge das menschliche Bewusstsein noch bis vor 3.000 Jahren anders konstituiert gewesen sei als heute: So habe eine stärkere Trennung von linker und rechter Gehirnhälfte die Menschen "Stimmen" hören lassen, die sie für Eingebungen der Götter hielten.
... soweit der reale Hintergrund. Yamamoto spinnt dies allerdings zu einem "Paradigmenwechsel" weiter, der zeitgleich mit und abhängig von der Veränderung des menschlichen Bewusstseins stattgefunden habe. Die Kaijū sind demnach die letzten Überbleibsel des mythischen Universums, in dem wir früher zu leben glaubten. Das ist völlig anders aufgebaut als das unsere und kommt nur oberflächlich betrachtet zu vertrauten Ergebnissen ... z.B. etwas, das wie eine Echse aussieht, in Wirklichkeit aber nicht einmal aus Atomen besteht. Wacker vom Autor, ein solches Gedankengebäude hinzustellen - ob's der Roman unbedingt braucht, sei mal dahingestellt.
Blasse Soap-Darsteller
Ohnehin bleiben die fünf - eines pro Episode - im Roman auftretenden Monster vergleichsweise im Hintergrund. Die eigentlichen Stars sind die MitarbeiterInnen der für MMs zuständigen Behörde mitsamt ihren alltäglichen Nöten. Seien es Budgetsorgen, Imageprobleme oder das klassische Dilemma, entweder mit einer Fehlwarnung eine Panik auszulösen oder aber zu riskieren, dass man zu spät an die Öffentlichkeit geht.
Das kennt man alles aus TV-Katastrophenfilmen, und "MM9" wirkt in seinem Aufbau mehr oder weniger wie fünf Folgen einer Fernsehserie. Eine solche gibt es in Japan übrigens tatsächlich, allerdings ist sie, aufbauend auf Yamamotos Buch, erst danach gedreht worden. Hier wie dort stehen die Menschen im Vordergrund; schade daher, dass sie so blass und stereotyp bleiben, dass ich hier auf die Nennung von Namen verzichte.
Das Fazit
Die Stärke von "MM9" liegt eindeutig im Humor, und der kann mitunter ziemlich perfide ausfallen. Eines der Kaijū etwa hat die Gestalt eines kleinen Mädchens, das auf Wolkenkratzergröße angeschwollen ist - abzüglich seiner Kleidung allerdings. Also müssen alle Nachrichtensender ihre Sensationsbilder verpixeln, damit man ihnen keine Klage wegen Kinderpornografie anhängt. Mit Godzilla hatte man solche Probleme noch nicht ...
Vom Aufbau her ist "MM9" ganz nach dem Muster von "The Stories of Ibis" gestrickt: Aufgeteilt in mehrere Episoden, deren letzte alles zusammenführt und mit einem Twist versieht. Die geradezu poetische Qualität von "Ibis" erreicht "MM9" jedoch nicht - dafür ist eine Mischung aus Ironie, theoretischem Überbau und Behörden-Soap dann wohl doch nicht stimmig genug. Unterhaltsam ist das Ganze aber allemal.
Thomas Ziegler: "Sardor. Der Flieger des Kaisers"
Klappenbroschur, 184 Seiten, € 15,40, Golkonda 2013 (erstmals erschienen 1984)
Vor neun Jahren starb der deutsche Autor Rainer Zubeil alias Thomas Ziegler mit gerade einmal 47. Anfang der 80er, als seine Karriere in der Phantastik durchstartete, galt er nicht nur als große Innovationshoffnung für die "Perry Rhodan"-Serie. Er arbeitete auch als Übersetzer und schaffte es, die unvergleichliche SF-Poesie von Cordwainer Smith zu weiten Teilen ins Deutsche herüberzuretten - wahrlich keine leichte Aufgabe.
Irgendwo zwischen diesen Polen lag die 1984 begonnene Fantasy-Trilogie "Sardor", mit der der Verlag Golkonda nun seine Reihe von Ziegler-Reissues gestartet hat. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem etwa gleich alten "Sador, Herrscher im Weltraum": Einem Film im Fahrwasser von "Star Wars", der vor allem deshalb denkwürdig ist, weil das Luke-Skywalker-Pendant darin ausgerechnet von Richard Thomas (also John-Boy Walton!) verkörpert wurde.
Der tollkühne Mann in seiner fliegenden Kiste
Zieglers "Sardor" steht ganz in einer Tradition, die mit Edgar Rice Burroughs begann und später unter anderem von Alan Burt Akers und - in vielfacher Weise - Philip José Farmer erfolgreich fortgesetzt wurde. Grundszenario: Nehmen wir einen durchsetzungsfähigen jungen Mann, befördern ihn mittels rätselhaftem Effekt aus seiner vertrauten Umgebung durch die Weiten von Raum und/oder Zeit und werfen ihn in ein extrem exotisches Ambiente, in dem er sich dann bewähren muss. Und wird.
Bei Ziegler heißt der Held in spe Leutnant Dietrich von Warnstein, ein Kampfflieger aus dem Geschwader des Roten Barons. Der knattert mit seinem Doppeldecker im Jahr 1917 in einen Gewittersturm und findet sich anschließend im Kirschlicht (das Wort werden wir im Roman noch gut kennenlernen) einer Roten Riesensonne wieder. Diese Herkunft gilt es zu beachten, denn Ziegler schreibt seinem Protagonisten die adäquate Sprache auf den Leib. Und das ist eben die eines - in Warnsteins eigenen Worten - anständigen deutschen Christenmenschen, der für Gott, Kaiser und Vaterland treu seine Pflicht erfüllt hatte. Anders ausgedrückt: Die eines chauvinistischen, zur Borniertheit erzogenen Gecken, der vorerst nur zaghafte Ansätze von Selbstreflexion zeigt.
Faktor Sprache
Ziegler legte auf Stil seinerzeit mindestens ebenso viel Wert, wie es heute ein Tobias O. Meißner tut; dazu gehört auch ein gewisser Mut zum Risiko. Die Sprache ist pathosgeladen bis zum Tolldreisten und auf altertümelnde Weise ausdrucksstark. Passend also zum Zeitgeist der Welt, die Dietrich hervorgebracht hat. Ein eingestreutes Zitat von Hermann Hesse fügt sich da stilistisch nahtlos ein. Und damit das Ganze auch modernen LeserInnen kein Bauchweh bereitet, darf sich Dietrich des Öfteren bis in die Selbstkarikatur hineinschwadronieren: Was kann ein tumber Heide schon dem gewitzten Geist des weißen Mannes entgegensetzen, von zwei Jahrtausenden abendländischer Kultur geschärft?
... Letzteres umso witziger, weil unser Held hier auf Mächte trifft, die eher in Jahrmillionen denken und die abendländische Kultur bestenfalls als Eintagsfliege betrachtet hätten. Die Welt, in der Dietrich landet, weist übrigens einige verblüffende Parallelen zu der von Richard Morgan in "Das kalte Schwert" auf. Wieder könnte es die Erde in einer fernen, barbarischen Zukunft sein, wieder umgibt ein Ring die Welt, wieder bekriegen sich auf dem Rücken der Menschheit kosmische Mächte. Hier heißen sie Eisenmänner, Gehörnte und Nachtmahre und erinnern in all ihrer Pulpigkeit noch viel mehr an H. P. Lovecraft, als es die Geschöpfe Morgans getan haben.
Grelle Optik in Schwarz und Rot
Dietrichs neue Welt, die ihn als wiederauferstandenen Erlöser Sardor empfängt, wirkt, als hätte man Conans Hyboria mit "Tron" gekreuzt: Gläsernes neonoranges Gras, Wälder aus Riesenpilzen und Tiere aus glühendem Metall gibt es hier - und Ziegler feuert auf alle Sinnesorgane. So liest sich die Beschreibung eines geringeren Ablegers der Eisenmänner: Formlos und fließend war das Antlitz des Riesen, der sich mit dröhnenden Schritten und knirschenden Metallgelenken aus der Öffnung schob. Der Mund ein wabernder Spalt im halbgeschmolzenen Eisen, die Nase ein Erker von der Größe eines menschlichen Rumpfes, kühler und dunkler als die dampfende Haut, die Augen zwei Gruben, in denen Metall kochte.
Wenn alles schließlich in einer gewaltigen Schlacht kulminiert, an der unter anderem Dietrich in seinem Doppeldecker, dämonisch animierte Ritterrüstungen, ein Amazonenheer und ein Reiter auf einem sechsbeinigen Nashorn teilnehmen - spätestens dann wird klar: "Sardor" ist extrem videospielkompatibel. Vielleicht wird es nach der Wiederveröffentlichung ja noch als Vorlage aufgegriffen.
Die weiteren Bände der "Sardor"-Reihe sollen im Juni bzw. September erscheinen. Zu tun gibt es für Dietrich schließlich noch genug: Hol's der Teufel, dachte er, es gibt kein Land im ganzen Universum, das ein deutscher Offizier nicht bezwingen kann! Und wenn die ganze Welt voll Teufel wär' ... Na wenn schon, dann auf sie mit Gebrüll!

S. J. Kincaid: "Insignia: Die Weltenspieler"
Broschiert, 512 Seiten, € 10,30, Goldmann 2012 (Original: "Insignia", 2012)
Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Mädchen sind frei: Da wäre Heather, ebenso atemberaubend wie leider auch berechnend. Oder Wyatt, unscheinbar und etwas ruppig im Umgangston, Typ treue Freundin. Klingt, als würde Teenager Tom vor dem klassischen Dilemma stehen, käme da nicht noch Tür 3 ins Spiel, hinter der sich die geheimnisvolle Medusa verbirgt. Die zieht Tom am meisten an - dumm nur, dass Medusa zwar denselben Job wie Tom hat, nämlich Kampfdrohnen per Gehirn-Link zu steuern. Aber leider tut's Medusa auf der anderen Seite der Front.
Fangen wir von vorne an: In ihrem Debüt-Roman führt uns US-Autorin S. J. Kincaid in eine nahe Zukunft, in der gerade der Dritte Weltkrieg stattfindet. Der Form nach zwischen dem indo-amerikanischen und dem russisch-chinesischen Block; in Wirklichkeit aber steckt eine Handvoll Konzerne dahinter, die im All um Ressourcen kämpfen. Es ist ein ausgelagerter Krieg, ausgetragen mit Drohnen, die von der Erde aus gesteuert werden. Und zwar ausschließlich von Teenagern, denn nur die verkraften es psychisch, wenn man ihnen den erforderlichen Neuronalprozessor implantiert. Zugleich dient der opferlose Krieg zur Unterhaltung der Massen. Die verantwortlichen Konzerne sponsern die Kombattanten und bauen sie zu Werbeikonen aus - skurril-makabre Begleiterscheinungen wie die Verleihung des Taco Bell Teen Hero Award verleihen dem Szenario satirische Spitzen.
Ein sympathischer kleiner Sturschädel
Tom Haines ist 14, als er von der US-Regierung rekrutiert wird. Zuvor tingelte er mit seinem Vater, einem Glücksspieler und Trinker, durch die Gegend. Eigentlich war es aber Toms Videospiel-Talent, das ein bisschen Geld in die Familienkasse spülte - und genau dieses Talent will nun auch das Pentagon nutzen. Viel wird sich in der Folge um Toms neuen Alltag, eine eigenwillige Mischung aus militärischer Ausbildung und Nerd-Leben, drehen. Er findet Freunde wie Feinde, flachst sich mit jugendlichen Streichen durchs Internatleben und wird bald auch mit todernsten Dingen konfrontiert. Kurz: "Insignia" ist eine klassische Young-Adult-Geschichte um Bewährung, Freundschaft und Verrat.
Der Grund für Toms raschen Aufstieg ist, dass er den Killerinstinkt hat - er will unbedingt etwas aus seinem Leben machen. Toms Charakter lässt sich am besten anhand einer kleinen Episode verdeutlichen: Hauptteil der Ausbildung sind die Angewandten Simulationen, in denen die Jugendlichen ihr virtuelles Kampftraining absolvieren - sei es als trojanische Krieger, sei es als Wolfsrudel oder Piranha-Schwarm. Als die Simulation Artus-Sage ansteht, muss Tom zur Strafe wegen wiederholter Eigenmächtigkeiten in die passive Rolle der Königin Guinevere schlüpfen. Passiv laut Legende, aber da hat man die Rechnung ohne Tom gemacht. Die Simulation endet damit, dass die holde Königin im bluttriefenden Kleid auf dem Thron sitzt, den Kopf des feindlichen Anführers neben sich aufgespießt.
Ein paar Schwächen
Typisch YA setzt "Insignia" neben jugendlichen Hauptfiguren auf Spannung, Humor und eine gewisse Harmlosigkeit. Wobei Letzteres auch zu dem einen oder anderen Problem mit der Logik führt. So haben die Jugendlichen dafür, dass sie eigentlich die exponiertesten Jobs der Welt ausüben, einen erstaunlichen Freiraum. Mir zumindest vermittelt sich nicht der Eindruck, dass es in diesem Krieg wirklich um existenzielle Fragen geht; eher wirkt er wie ein einziges großes Spiel. Bezeichnendes Detail am Rande: Für Landesverrat (in Kriegszeiten!) gibt es nur zehn Jahre Gefängnis?
Auch die Sichtweise der im Roman verwendeten Technik und der menschlichen Psyche ist ein bisschen naiv. Wenn Toms Neuronalprozessor in einer Unterrichtsstunde vom Lehrer manipuliert wird, liest sich das wie die Vorführung eines Hypnotiseurs: Jetzt bist du ein Hund. Jetzt hast du Angst vor dem Tisch. Nach jeder Manipulation reicht es aber, das Programm zur Deinstallation von Bugs durchlaufen zu lassen - und schwupps! ist eine Persönlichkeitsveränderung rückgängig gemacht. Die Neuronalprozessoren haben es überhaupt in sich. So wird die Wahrnehmung des misstrauisch beäugten russischen Austauschschülers Yuri rund um die Uhr manipuliert, damit er keine militärischen Geheimnisse erfährt. Ein Roman für Erwachsene hätte diesen Gedanken sicher weitergesponnen: Im Grunde dürfte sich keine der Romanfiguren sicher sein, dass das, was sie als Realität erlebt, tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. Aber so weit geht Kincaid nicht.
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende
"Insignia" ist eben YA, angesiedelt irgendwo zwischen Orson Scott Cards "Ender's Game" und "Harry Potter" - nur dass hier statt der vier Hogwarts-Häuser fünf Pentagon-Divisionen während der Ausbildung ihrer Schützlinge miteinander konkurrieren. Und natürlich Technik die Magie ersetzt. Wer sich zur davon angesprochenen Zielgruppe zählt, wird an "Insignia" seine Freude haben. Und zum Abschluss heißt es nicht eins, zwei oder, sondern und drei: Der Roman ist der Beginn einer Trilogie. Band 2 kommt diesen Sommer heraus, zunächst mal auf Englisch.
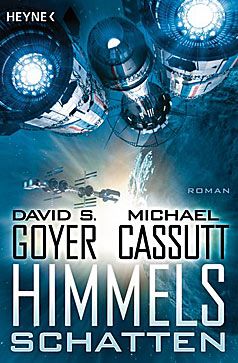
David S. Goyer & Michael Cassutt: "Himmelsschatten"
Broschiert, 640 Seiten, € 10,30, Heyne 2012 (Original: "Heaven's Shadow", 2011)
"Déjà-vu with Rama" wäre auch ein ganz guter Titel gewesen. Die Prämisse jedenfalls klingt bekannt: Ein riesiger außerirdischer Brocken fliegt ins Sonnensystem ein, und als die irdischen Erkunder vor Ort eintreffen, stellen sie fest, dass sich unter dem Eispanzer der 100-Kilometer-Kugel nicht etwa ein Asteroid, sondern ein Raumfahrzeug verbirgt. Auch wie es anschließend weitergeht, zeigt so einige Parallelen zu Arthur C. Clarkes "Rama"-Reihe.
Genau genommen sind es zwar gleich zwei Expeditionen, die hier zum "Keanu" getauften NEO (und zugleich BDO) aufbrechen: Eine US-amerikanische um Kommandant Zack Stewart und eine der russisch-indisch-brasilianischen Koalition unter dem Vyomanauten (das Wort gibt's wirklich!) Taj Radhakrishnan. Die an den einstigen Wettlauf zum Mond erinnernde Konkurrenz der DESTINY- und BRAHMA-Expeditionen ist es aber nicht, die die Handlung weiterträgt: Kein Kalter Krieg 2.0 ... was durchaus plausibel ist. Immerhin sind die RaumfahrerInnen der Erde ein kleines Häuflein; man kennt sich von diversen ISS-Missionen und arbeitet daher rasch zusammen, um Keanus Geheimnisse zu ergründen.
Wer hinter dem Script steckt
Literarische Neulinge sind die beiden Autoren nicht. Michael Cassutt etwa hat über die Jahre eine Reihe von Kurzgeschichten veröffentlicht. Hauptberuflich aber hat er als Drehbuchautor gearbeitet, von der "Twilight Zone" bis zu "Stargate" und "Farscape". David S. Goyer wiederum, ebenfalls aus den USA, kommt aus dem Filmbusiness. Er war Regisseur von "Blade: Trinity" und Produzent von unter anderem "Mission to Mars" und "Ghost Riders". Klingt nach der B-Klasse der Blockbusterschiene - was Drehbücher anbelangt, hat er aber auch Beeindruckenderes vorzuweisen, etwa "Dark City" oder die "Batman"-Neuverfilmungen unter Christopher Nolan.
Dass es sich um Drehbuchautoren handelt, merkt man "Himmelsschatten" an. Der Roman wechselt im Wesentlichen zwischen Handlungsabläufen und Dialogen, und nirgendwo funkt ein auffälliger Stil dazwischen. Professionelle Schreibe halt. Und natürlich darf auch auf die "Musts" eines filmreifen Plots nicht vergessen werden: Spannungselemente etwa. So dreht ein Crewmitglied durch (ohne dass so ganz nachvollziehbar wäre, warum in dieser Vehemenz), und eine Atombombe ist auch noch mit im Spiel. Vor allem aber das Human Drama, heruntergebrochen auf eine Kernfamilie: Zack strandet auf dem fremden Objekt, während seine verwaiste Teenager-Tochter Rachel daheim auf der Erde zuschauen muss - ohnehin verbittert über die familiären Auswirkungen von Papis Astronautenjob. Dabei - grausame Ironie - hat Zack alle Gefahren bislang überstanden, während Mutter Megan bei einem banalen Autounfall ums Leben kam.
... bis sie Zack auf Keanu plötzlich wieder entgegentritt, rekonstruiert durch quasi-magische Alien-Technologie (Goyer und Cassutt kennen also auch "Solaris", zumindest in der Film-Version). Da Zack mit dem DESTINY-Crewmitglied Tea Nowinski seine neue Freundin gleich mitgebracht hat, wäre das Human Drama nun auf die Spitze getrieben. Aber irgendwie nimmt es einen nicht wirklich mit. So wie die Handlungsfiguren nichts von der Clarke'schen Ehrfurcht vor der fremdartigen Supertechnologie spüren lassen, liest man sich da auch beim Buchkonsum irgendwie so durch. Nicht gelangweilt, aber auch nicht beeindruckt.
Details am Rande
Eine Weltraumgeschichte ist nicht automatisch Science Fiction, immerhin haben wir in Sachen Raumfahrt schon einiges geleistet. Tatsächlich ist "Himmelsschatten" weitgehend ein NASA-Thriller - und das sind auch die überzeugenderen Teile. Die eigentlichen SF-Elemente sind eher auf 50er-Jahre-Level, nur die Wörter, die in kurzen Handwaving-Erklärungen angeführt werden, haben sich geändert. Früher hätte ein Autor vielleicht "Strahlen" bemüht, um esoterische Effekte zu erklären. Heute werden's die Quanten schon richten.
So ganz genau nehmen's Goyer und Cassutt mit den Fakten ohnehin nicht. Ihre Geschichte haben sie nämlich ohne große Not in eine allzunahe Zukunft verlegt: Keanu taucht 2019 auf, bereits 2017 wurden die bemannten Mondmissionen wiederaufgenommen - rechnet man davon die im Roman genannte Projektvorlaufzeit zurück, müsste die Sache schon seit einigen Jahren laufen. Genau genommen befinden wir uns also in einer Parallelwelt; da lässt sich dann auch ein Hurrikan unterbringen, der um 2009 herum das NASA-Hauptquartier bedroht haben soll.
Fortsetzung folgt
Das Resümee: Der Kern-Plot ist x-fach bekannt und die beiden Autoren fügen dem auch nichts wirklich Neues hinzu. Außer Volumen. Denn "Himmelsschatten" ist zwar wie gesagt nicht langweilig, aber doch ein ausgezeichnetes Beispiel für den schleichenden Prioritätenwandel, der im Genre stattgefunden hat. Es geht nicht mehr darum, eine Geschichte solange zu erzählen, wie sie aus eigener Kraft laufen kann, sondern darum, die KonsumentInnen möglichst lange an sich zu binden. Nennen wir es das "Hobbit"-System. Darum wird jetzt auch niemand vor Überraschung vom Stuhl fallen, wenn ich verkünde: "Himmelsschatten" ist der erste Band einer Trilogie ...
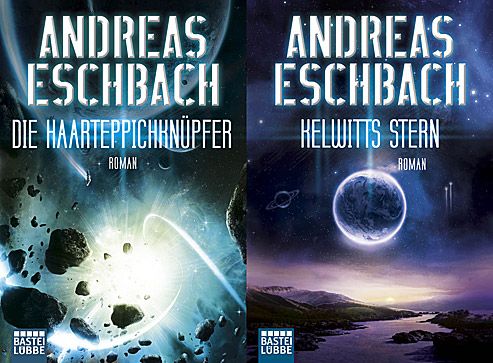
Andreas Eschbach: "Die Haarteppichknüpfer" und "Kelwitts Stern"
Broschiert, 319 bzw. 413 Seiten, jeweils € 9,30, Bastei Lübbe 2012 (erstmals erschienen 1995 bzw. 1999)
Noch ein letztes Mal zurück zu Richard Morgan: Der ließ "Das kalte Schwert" mit dem Ausbruch eines jungen Sklaven beginnen. Eine neue Hauptfigur schien etabliert zu werden ... nur um ein paar Kapitel später schnöde abgekragelt zu werden. Denselben Effekt setzte Andreas Eschbach in seinem mittlerweile mit Kultstatus versehenen Debütroman "Die Haarteppichknüpfer" ein, und das gleich mehrfach hintereinander. Der stets nach einer Identifikationsfigur lechzende Leser sieht sich in seinen Erwartungen wiederholt getäuscht: Immer wenn ein entsprechender Sympathieträger aufgebaut worden ist, verschwindet er noch am Ende desselben Kapitels wieder aus der Handlung. Und meistens auch aus dem Leben.
Bei Morgan diente dies als eine Art Lehrstunde in Sachen Fantasy-Klischees. Ein Dämon kommentiert das unerwartete Ableben des Sklaven gegenüber Ringil so: "Wende dein gut ausgebildetes Bewusstsein auf all jene blödsinnigen Helden-mit-einer-hohen-Bestimmung-Legenden an, die dein Volk sich so gern erzählt. Du meinst wirklich, dass in einem dreckigen Schlachthaus von Welt wie dieser [...] die Götter nichts Besseres mit ihrer Zeit anzustellen haben, als aus irgendeinem zufälligen Stück Müll in langen Jahren einen Handlanger zu formen?" Eschbach ist nicht so offensichtlich didaktisch unterwegs. Er setzt auf den Schockeffekt, um die Rigidität des von ihm beschriebenen Gesellschaftssystems zu unterstreichen. Es triumphiert der Heuchler über den Idealisten, der Feigling über den Helden, der Arschkriecher über den Sozialrevolutionär.
Ungewöhnlicher Aufbau
Oberflächlich betrachtet ließe sich der Roman der Science Fantasy zuordnen - aber nur wegen des Settings, metaphysische Elemente gibt es keine. Den Hintergrund bildet ein hochtechnologisches Imperium, das mehrere Galaxien umfasst. Der Großteil der Romanepisoden ist aber auf einem Planeten angesiedelt, der sich auf quasi-mittelalterlichem Niveau befindet. Hier lebt die Gilde der Haarteppichknüpfer, die aus den Haaren ihrer Ehefrauen und Töchter einzigartige Kunstwerke anfertigen - angeblich, um damit den Palast des Kaisers zu schmücken. Jeder Teppich ist ein Lebenswerk, und der Herstellung hat sich alles andere unterzuordnen.
Der Roman hat keine Hauptfiguren. Er ist als weitgehend chronologische Aneinanderreihung von Episoden aufgebaut, durch die wir die gesamte Produktions-, Handels- und Verwertungskette der Haarteppiche kennenlernen. Vor allem aber das menschenverachtende System, das dahintersteckt. Damit beeindruckt "Die Haarteppichknüpfer" - übrigens der seltene Fall eines deutschen SF-Romans, der ins Englische übersetzt wurde - heute noch so sehr wie vor 18 Jahren.
Kelwitts Stern
Die originelle Konstruktionsweise der "Haarteppichknüpfer" stieß allerdings auch auf Kritik, und Eschbach hat sie nicht überhört. Spätere Romane waren konventioneller aufgebaut - insbesondere der Forderung nach klaren Hauptfiguren, denen wir im Verlauf der Handlung treu an der Seite bleiben, wurde nachgegeben. Zum Beispiel im vier Jahre nach den "Haarteppichknüpfern" erschienenen "Kelwitts Stern", das ebenfalls vergangenen Herbst noch einmal neu aufgelegt wurde.
Auf dem Planeten Jombuur ist es Tradition, Neugeborenen einen Stern zu "schenken" (Verfügungsgewalt ergibt sich daraus keine). Wenn's geht, besichtigt man "seinen" Stern später mal aus der Nähe, wie es auch der junge Kelwitt tut. Es zeigt sich, dass der Stern von einem Planeten umkreist wird, auf dem es halbwegs intelligentes Leben gibt - nämlich uns. Kontakt ist streng verboten, aber weil sich der neugierige Kelwitt allzunahe an die Erde heranwagt, legt er eine Crashlandung hin. Und kommt nach diversen Irrungen schließlich als Hausgast bei Familie Mattek im Schwäbischen unter.
Vertrauter Plot, gelungener Witz
"Kelwitts Stern" lebt vor allem von seiner Situationskomik, besonders gelungen in den Kleinigkeiten. Etwa wenn Mutter Mattek Kelwitt kurzerhand einen Duschvorhang unterlegt ... wozu gibt es tausende First-Contact-Geschichten, wenn einen keine davon auf ein amphibisches Lebewesen vorbereitet, das ständig auf den Teppich tropft? Dass es gelinde gesagt Umstände macht, wenn man zuhause ein Alien versteckt, wussten ja schon die Tanners in "ALF". Kelwitt ist zwar deutlich weniger egozentrisch als der Melmacianer, aber immer noch eine Herausforderung auf allen Linien. Nicht zuletzt für die nymphomanische Mattek-Tochter Sabrina, die zwischenzeitlich ein Auge auf den geschlechtlich uneindeutigen Kelwitt wirft. Der kriegt von ihren Verführungsversuchen allerdings nicht mehr mit, als es Sheldon Cooper tun würde ... die betreffenden Passagen sind eines der Highlights des Romans.
Als Spannungselement treibt sich auch ein verbiesterter BND-Agent auf Kelwitts Spur herum; der heißt Hermann Hase, und das ist noch seine beeindruckendste Eigenschaft. Dass von dem Unglücksraben keine allzugroße Gefahr ausgehen wird, ist von Anfang an klar. "Kelwitts Stern" ist von vorne bis hinten gutmütig im Ton, durchgehend witzig und mit einem etwas kitschigen Schluss versehen. Angesiedelt irgendwo zwischen "ALF" und der SF-Komödie "Paul – Ein Alien auf der Flucht", gut geeignet auch für jüngere LeserInnen. No aliens were harmed during the making of this novel.
Es geht weiter
Mittlerweile haben sich bei mir eine ganze Reihe englischsprachiger Titel mit Tier-Bezug angesammelt, das schreit nach einer Rundschau unter entsprechendem Motto. Ob die faunenverfälschte Ausgabe beim nächsten oder übernächsten Mal kommt, hängt davon ab, wie diese Bücher zu den noch zu bestellenden deutschsprachigen passen. Sicher ist nur eines: Bis zur nächsten Rundschau wird bedeutend weniger Zeit vergehen als seit der letzten. Ui, jetzt hab ich's verschrien ... (Josefson, derStandard.at, 2. 3. 2013)