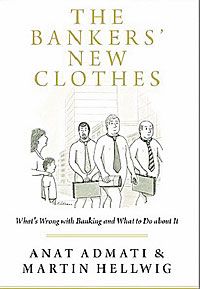Ökonom Martin Hellwig kritisiert "lächerliche" Bankenregeln und fordert deutlich höhere Eigenkapitalquoten. Warum Europa ohne Reform zu einem zweiten Japan werden kann, sagte er Lukas Sustala.
STANDARD: Fünf Jahre sind seit dem Ausbruch der Finanzkrise vergangen. Ist das Bankensystem sicherer geworden?
Hellwig: Ich sehe keine substanzielle Verbesserung. Ich habe drei große Sorgen: Erstens gibt es noch Leichen in den Kellern. Zweitens haben wir ein Overbanking. Es gibt Überschusskapazitäten in der Bankenbranche und die wurden noch nicht abgebaut. Das ist besonders in Europa ein Problem. Das ist schon die Garantie für die nächste Zockerei. Denn was macht man, wenn man im Bankgeschäft kein Geld verdienen kann? Man zockt. Drittens ist die Verschuldung der Banken nach wie vor sehr hoch und die Vernetzung zwischen ihnen komplex und unübersichtlich.
STANDARD: Doch mit der Regulierung von Basel III werden die Banken angehalten, sich stärker über Eigenkapital zu finanzieren. Sind sie damit nicht sicherer? Oder: Macht sie das nicht sicherer?
Hellwig: Basel III ist nur ein Basel 2,01. Es schreibt den Banken nach wie vor zu wenig Eigenkapital vor. Das System der Risikogewichte ist beliebig manipulierbar. Die vorgesehene Untergrenze der Eigenmittel, die diese Manipulation begrenzen soll, liegt bei drei Prozent der Bilanz, das wäre lächerlich, wenn es nicht so gefährlich wäre. Die Banken sollten deutlich mehr eigene Mittel einsetzen, 20 bis 30 Prozent der Bilanz.
STANDARD: Die Banken schätzen das Risiko ihrer Positionen selbst und müssen bei weniger Risiko mit weniger Eigenmittel ausgestattet sein. Doch was ist die Alternative?
Hellwig: Eine einfache Schuldengrenze! Mehrere Untersuchungen zeigen, dass in der Krise die Banken am anfälligsten waren, die am meisten verschuldet waren, bei denen der Anteil der eigenen Mittel an der Bilanz am kleinsten war. Für die Anfälligkeit bzw. Robustheit der Banken in der Krise spielten die Risikogewichte der Anlagen so gut wie keine Rolle. Einige Banken wären ohne Staatshilfe insolvent geworden aufgrund von Verlusten auf Papiere, die ein Risikogewicht von Null hatten, so etwa Dexia mit griechischen Staatsanleihen oder UBS mit AAA-gerateten Hypothekenverbriefungen, deren Kreditrisiken man abgesichert glaubte.
STANDARD: Von Basel I zu Basel III hat die Komplexität der Bankenregeln massiv zugenommen. Werden Risiken nun besser gemanagt oder besser verschleiert?
Hellwig: Je größer die Komplexität ist, desto mehr Möglichkeiten zur Manipulation gibt es. Das ist wie beim Steuersystem. Der Übergang von Basel I zu Basel II wurde damit begründet, dass die Banken ohne Risikokalibrierung uneingeschränkt zocken können, d.h. bei gleichem Einsatz eigener Mittel in die Papiere investieren können, die die größten Risiken haben. Mit Risikokalibrierung können sie noch mehr zocken, in die Papiere investieren, bei denen die tatsächlichen Risiken relativ zu den Risikogewichten sehr hoch sind. Einige der wirklich ganz großen Risiken werden nämlich gar nicht erfasst, Risiken bei Staatsanleihen, Risiken aufgrund von Korrelationen der Unternehmens- oder Immobilienkredite, Risiken aufgrund von Änderungen der Finanzierungsbedingungen.
STANDARD: Die Banken wehren sich gegen höhere Eigenkapitalvorschriften und warnen davor, dass damit die Kreditvergabe und die Konjunktur leiden.
Hellwig: Den größten Einbruch bei der Kreditvergabe und der Konjunktur hatten wir Ende 2008, weil die Banken zu wenig Eigenkapital hatten, um die Verluste in der Krise aufzufangen. Lehman Brothers hatte drei Prozent der Bilanz an eigenen Mitteln, die waren schnell aufgezehrt durch die Verluste auf die toxischen Papiere. Mit mehr Eigenkapital hätte Lehman die Insolvenz vermieden, und uns wäre viel erspart geblieben. Lehman hätte ohne weiteres mehr Eigenkapital aufnehmen können. Nur wollte man das nicht, weil man fürchtete, die neuen Aktionäre würden allzu genau hinsehen, was sie da kauften. Da ist es bequemer, sich zu verschulden, immer wieder neu, von einem Tag auf den anderen, für hunderte von Milliarden.
STANDARD: Sollte man mit Erhöhungen der Eigenkapitalanforderungen nicht warten, bis die Krise vorbei ist und die Konjunktur besser läuft?
Hellwig: Wenn man Korrekturen hinauszögert, wird die Korrektur schmerzhafter. In Schweden 1992 wurden die Probleme der Banken unmittelbar angegangen. Das war zunächst sehr schmerzhaft und verschärfte den Konjunktureinbruch. Doch war es die richtige Methode: zwei Jahre später waren die Banken saniert, und die Wirtschaft ging wieder bergauf. Japan hat damals versucht, die Probleme vor sich her zu schieben, und es ist bis heute noch nicht richtig aus der Krise gekommen. Die Erfahrungen der Entwicklungsländer zeigen dasselbe: Wer Bankenprobleme prompt löst, kommt schnell wieder heraus, wer versucht, sie auf die lange Bank zu schieben, bekommt immer größere Probleme.
STANDARD: Dabei will Europa ja Vorreiter sein. Der Liikanen-Report, im Auftrag der Europäischen Kommission, sieht etwa eine Trennung von Einlagen- und Investmentgeschäft vor, um Europas Banken sicherer zu machen. Wird das gelingen?
Hellwig: Ich bin skeptisch. Es geht nicht nur um den Schutz der Einlagen. Lehman Brothers hatte gar keine Einlagen und war dennoch ein systemisches Risiko. Der Liikanen-Vorschlag hilft also nicht, das Lehman-Problem loszuwerden. Gleichwohl kann eine Trennung sinnvoll sein, etwa um beim Handelsgeschäft höhere Eigenkapitalanforderungen durchzusetzen und für mehr Haftung der Eigentümer zu sorgen. Denn in diesem Bereich ist es viel einfacher, die Positionen und die Risiken hochzufahren. Im Kreditgeschäft braucht es für jeden zusätzlichen Kredit eine Prüfung. Im Handelsgeschäft kann der Händler einfach eine oder zwei Nullen mehr auf die Position schreiben.
STANDARD: Droht uns das japanische Szenario auch in Europa?
Hellwig: Das Wort "droht" könnte schon zu optimistisch sein. Möglicherweise sind wir schon auf diesem Weg. Wir haben seit 2008 die Banken gestützt, ohne die Probleme zu bereinigen. Bei etlichen europäischen Banken dürfte es noch Leichen im Keller geben, und muss man wohl die Bewertungsansätze in den Bilanzen kritisch sehen, so etwa bei Immobilienkrediten in Spanien oder bei Schiffskrediten in Deutschland. Der Oliver-Wyman-Bericht zu Spanien arbeitet mit einem bemerkenswert niedrigen Verhältnis der ausstehenden Kredite zu den Werten der Immobilien (Loan-to-Value-Ratio, Anm.). Das wäre ein gutes Zeichen, wenn nicht zu befürchten wäre, dass die Werte der Immobilien unrealistisch hoch angesetzt sein könnten. Insgesamt ist festzustellen, dass die Schulden von Staaten, privaten Haushalten und Banken weltweit, nicht nur im Euroraum, sondern auch in den USA, Großbritannien und Japan, sehr hoch sind.
STANDARD: Wie kann man aus dieser Situation herauskommen?
Hellwig: Wenn jemand überschuldet ist, müssen Schulden gestrichen werden. Bei einer Privatperson geschieht das in einem Insolvenzverfahren. Bei Staatsschulden in ausländischer Währungen gibt es Verhandlungen mit den Gläubigern, bei Staatsschulden in heimischer Währung den Griff zur Notenpresse und zur Entwertung der Schulden durch Inflation. Entsprechenden Druck auf die Zentralbanken beobachten wir derzeit in vielen Ländern. Die kritische Frage ist, wie sich die Inflationserwartungen entwickeln, wenn die Zentralbanken zusätzliches Geld schaffen. Die langfristigen Zinsen könnten dann wieder steigen, denn sie hängen von den Inflationserwartungen ab.
STANDARD: Und was dann?
Hellwig:Wenn die langfristigen Zinsen ansteigen, haben die Banken ein Problem. Alle langfristigen Titel, die sie halten, werden dann an Wert verlieren, das wird sich auf die Bilanzen durchschlagen. Wenn allerdings die langfristigen Zinsen so niedrig bleiben, wie sie jetzt sind, so haben die Versicherer ein Problem. Versicherer und Pensionsfonds brauchen höhere Zinsen, um ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden zu erfüllen. So oder so, wenn die langfristigen Zinsen steigen und wenn sie nicht steigen, birgt die Entwicklung der Zinssätze erhebliche Risiken. (Lukas Sustala, DER STANDARD, 12.3.2013)