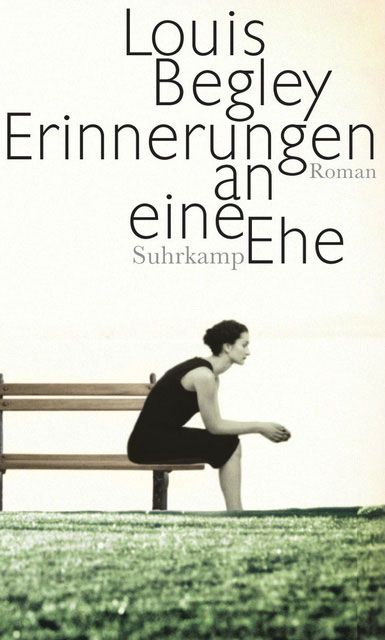
Louis Begley: Erinnerungen an eine Ehe. Suhrkamp, Frankfurt/Main 2013, 222 Seiten.
Wien - Der Ich-Erzähler, ein Schriftsteller um die siebzig, meint einmal, er habe nie darüber Auskunft geben können, was ein Roman "eigentlich sagen will", deshalb pflegte er Journalisten zu erklären, "dass ein Buch das sagen will, was darin steht". Das Geschäft des Rezensierens besteht darin, solche Stopptafeln zu ignorieren und nach genau diesen verpönten Formeln zu suchen. Schon der Titel ist eine solche - irreführende - Formel. Man glaubt, es gehe um die Ehe des Erzählers, denn er stellt sich als Witwer vor. Vor geraumer Zeit hatten er und seine französische Frau Bella ihre Tochter bei einem Unfall verloren und sich danach in ihre Arbeit vergraben, vor einigen Jahren war Bella an Leukämie gestorben.
Nun hat Philip seine Zelte in Paris abgebrochen und ist nach New York zurückgekehrt, als ihn in der Pause eines matten Ballettabends eine gutaussehende Frau seines Alters anspricht. Es ist seine Jugendfreundin Lucy De Bourgh, steinreiche Erbin aus allererster Familie, einst brillant, schön, witzig und umschwärmt.
Lucy weckt die Neugier des Schriftstellers, als sie ihren inzwischen verstorbenen Exmann Thomas Snow, Philips Freund, ein "Monster" nennt. Das Rätsel dieser Ehe zwischen dem Sohn eines Automechanikers und dem dünkelhaften Teufelsweib wird für Philip zur Obsession. Er lässt sich von Lucy in etlichen Sitzungen die Geschichte erzählen, doch er traut ihren Erinnerungen nicht, befragt Freunde, den Sohn, Thomas' zweite Frau. Wie wurde aus der strahlenden Lucy eine verbitterte alte Hexe? Verzieh sie ihrem Gatten, der zu einem wichtigen Finanzmann aufstieg, nicht, dass er ein "Townie" war, ein Parvenu? Dass er "sexbesessen" war, "aber ohne Talent für Sex"? Oder konnte sie ihn einfach "nicht leiden"? Aber warum hat sie ihn dann geheiratet? Sie, die in ihrer Gier zu leben viel riskiert hat, auch ihren guten Ruf, erzählt von ihren Abstürzen und Klinikaufenthalten. Philip ahnt bald, dass er an ihrem Angelhaken hängt.
Louis Begley beschreibt ein ihm bestens vertrautes Milieu, in dem man Champagner trinkt; und nicht einfach eine Zitronentorte isst, sondern eine "von Payard". In dem es nicht genügt, auf der richtigen Höhe des Central Park zu wohnen, wenn es nicht auch die richtige Seite ist: Osten.
Einmal mehr erweist Begley sich als souveräner Vivisekteur der amerikanischen High Society, wie er sie in all ihrer snobistischen Abgründigkeit in seinem großen Universitätsroman Ehrensachen porträtiert hat. An dessen Dichte und Komplexität kommen Erinnerungen an eine Ehe nicht heran. Der Komposition haftet eine gewisse Sorglosigkeit an, es gibt Wiederholungen, manche Gesprächssituation wirkt unglaubwürdig, und Lucys unverblümte Schilderungen ihrer Sexualpraktiken mit dem in jeder Hinsicht gipfelsturmerprobten Geliebten befremden angesichts ihrer erstklassigen Erziehung denn doch: "Er konnte lieben wie ein Gott - so hat mich noch nie einer gefickt." Ist's wirklich Lucys exaltiertes Wesen oder gute alte Männerfantasie?
Diesen Makeln zum Trotz (wozu noch ungelenk Übersetztes kommt) beeindruckt der Roman als Ganzes: als offene Frage nach dem, was Menschen im Leben an- und umtreibt - Liebe, Verlangen, Ehrgeiz, Gier und Betrug. Begleys Alter Ego ist einer der wenigen Liebenden in diesem Buch. Nach dem Verlust seiner Frau bleibt er untröstlich, wohl für den öden Rest seines Lebens. Von allen "Verheerungen des Alters" schmerzt ihn das Schwinden des Begehrens am meisten. Neidvoll beobachtet er ein Pärchen im Park und zitiert ein Gedicht von Andrew Marvell, der To His Coy Mistress (An seine spröde Geliebte) um 1650 sinngemäß schrieb, sie möge sich nicht weiter zieren, denn dereinst im Grab sei es zu spät zum Lieben. Wenigstens diesbezüglich wird Lucy sich nichts vorzuwerfen haben. (Daniela Strigl, DER STANDARD, 19.10.2013)