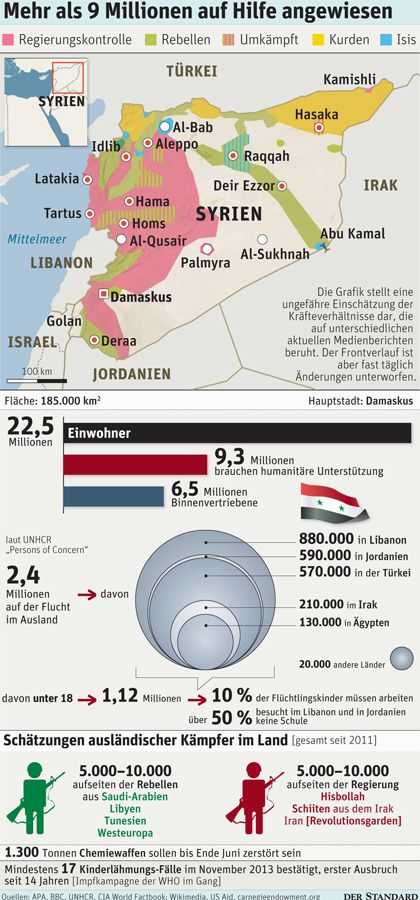
Die USA üben sich in Bezug auf Syrien in neuer Bescheidenheit - Sorge vor ungewollter Hilfe für Al-Kaida
Als das US-Kabinett im vergangenen Frühjahr über Waffen für die syrischen Aufständischen diskutierte, war Barack Obama, so schilderten es Insider, "the last man standing". Der Letzte, der darauf beharrte, keine Waffen an die Rebellen zu liefern. Während Pentagon, Außenministerium und CIA grünes Licht gegeben hatten, bestand der Präsident auf einem Embargo. Erst im Juni ließ sich Obama vom Gegenteil überzeugen. Nach einem Fazit der New York Times ist die Hilfe bis heute "sehr begrenzt" geblieben.
Natürlich liegt es an der Befürchtung, dass Waffen in die Hände radikalislamischer Milizen fallen könnten. Natürlich steckt alten Hasen die Erfahrung Afghanistans in den Knochen. Indem Washington die Mujahedin hochpäppelte, um die Sowjetunion zum Abzug zu zwingen, begünstigte es eine Entwicklung, in deren Ergebnis Al-Kaida-Fanatiker eine Heimstätte fanden. Aleppo, lautet die Schlussfolgerung, darf kein zweites Kandahar werden. Unausgesprochen heißt das: dann lieber Bashar al-Assad. Doch entscheidend ist die Weltsicht Obamas, nach der Amerika, selbst wenn es wollte, grandios überfordert wäre mit der Rolle des Weltpolizisten.
Kein politischer Wille zur Intervention
Dass Assad die Macht aufgeben müsse, haben Obama und Außenminister John Kerry oft genug verlangt. Es ändert nichts daran, dass die USA kaum etwas tun werden, um die Kräftebalance militärisch zu kippen. Wer das Blatt wirklich wenden wolle, gibt Obama in einem Gespräch mit dem New Yorker zu verstehen, müsste schon bereit sein zu einer Intervention wie 2003 im Irak. Ein solches Szenario aber findet keine Mehrheiten, weder im Kongress noch in Meinungsumfragen. "Womit wir es zu tun haben", analysiert Obama, "ist eine autoritäre, brutale Regierung, die alles tut, um an der Macht zu bleiben, und eine Opposition, die desorganisiert, schlecht ausgerüstet und ausgebildet und in sich gespalten ist." Angesichts der Fakten sei es seine beste Chance, mit jenen zu arbeiten, die den größten Einfluss hätten - mit Iranern und Russen -, und mit den arabischen Golfstaaten, die die Rebellion finanzieren.(Frank Herrmann aus Washington, DER STANDARD, 22.1.2014)
Russland kritisiert Irans Ausladung als Fehler - Lawrow: Syrer müssen Konflikt selbst lösen
Russland sieht die Ausladung des Iran von der Syrien-Friedenskonferenz in Genf gelassen: Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete den Schritt als "Fehler, aber keine Katastrophe", schließlich handle es sich bei der Auftaktveranstaltung, einem Außenministertreffen, um ein eher zeremonielles Prozedere. Bedauerlich sei, dass die Vereinten Nationen damit ihre eigene Autorität untergrüben, betonte der russische Chefdiplomat am Dienstag in seiner Jahrespressekonferenz in Moskau.
Lawrow widersprach dem Vorwurf, dass Teheran sich nicht an das Abschluss-Kommuniqué der Genf-I-Konferenz halte. Dort sei ein Regimewechsel nicht festgeschrieben, betonte er. Russland interpretiert die Klausel zur Bildung einer Übergangsregierung anders als der Westen nicht als die Forderung nach einem Rücktritt von Syriens Präsident Bashar al-Assad. Moskau gilt - ebenso wie Teheran - als Verbündeter des syrischen Staatschefs und lehnt Vorbedingungen für Verhandlungen ab.
Moskau gegen äußere Einmischung
Lawrow räumte ein, dass Assads Truppen während des dreijährigen Bürgerkriegs Kriegsverbrechen begangen hätten. "Aber sie wurden auf beiden Seiten begangen, die grausamsten Verbrechen werden von Jihadisten begangen", fügte er hinzu. Große Teile der Opposition gehören nach Russlands Ansicht Al-Kaida und anderen internationalen Terrororganisationen an. Der Sturz Assads werde die Sicherheit im Nahen Osten daher nur weiter destabilisieren, argumentiert der Kreml, der seit 1971 in der syrischen Hafenstadt Tartus eine Basis unterhält, die einzige russische außerhalb der Ex-Sowjetunion.
Russland hat sich seit Beginn des Konflikts gegen eine militärische Einmischung von außen und für die territoriale Unverletzlichkeit Syriens ausgesprochen. Nur das syrische Volk selbst habe das Recht, über sein Schicksal zu entscheiden, betonte Lawrow in Moskau. Den Vorwurf, selbst Waffen in die Krisenregion zu liefern, konterte der Minister kühl: "Wir liefern nichts Verbotenes und nichts, was die Lage destabilisieren könnte." (André Ballin aus Moskau, DER STANDARD, 22.1.2014)
Teheran hat sich selbst an Assad gekettet - Syrien: Widerstandsasset oder Klotz am Bein
Einen "Imperativ für die iranische Außen- und Sicherheitspolitik" nennt der Iranist Walter Posch (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) Teherans Unterstützung des Assad-Regimes: Die Argumentation, dass der Iran in Damaskus verteidigt wird, gründet auf der Überzeugung, dass der Aufstand in Syrien ein Komplott von außen ist, um die "Widerstandsachse" - die sunnitischen Araber sagen "schiitischer Halbmond" dazu - zu brechen und den Iran in der Levante entscheidend zu schwächen (die spiegelgleiche Auffassung zu der, die Saudi-Arabien von den Unruhen in Bahrain hat.)
Beschädigte Widerstandsachse
Die iranische "Widerstandsachse" ist jedoch ohnehin schon beschädigt. Denn sie war nur mit der (wenngleich nicht schiitischen) palästinensischen Hamas komplett, die sich - als Muslimbrüder-Spross - im Syrien-Konflikt auf der Gegenseite, gegen Assad, wiederfand. Mit der Wahl Hassan Rohanis zum iranischen Präsidenten und seiner Normalisierungspolitik - ohne die die Ad-hoc-Einladung des Uno-Generalsekretärs Ban Ki-moon an den Iran gar nicht denkbar gewesen wäre - stellt sich die Frage, ob Syrien sich für den Iran à la longue als Verhandlungsasset erweist oder doch vor allem als Klotz am Bein. Auch deshalb wird in Teheran vor allem der "Willen des syrischen Volkes" betont: Die Botschaft ist, dass man nicht an der Person Bashar al-Assad hängt.
Da es schwer sein wird, die engen Beziehungen zu einem Post-Assad-Regime hinüberzuretten - außer zwischen dem Iran und Saudi-Arabien bricht der himmlische Friede aus -, ist der Iran aber gewissermaßen an Assad gekettet. Der Libanon gehört auch in die Gleichung. Die schiitische Hisbollah griff, wie man heute weiß, auf direkte iranische Anordnung kämpfend in Syrien ein, mit entsprechend hohem politischem Kollateralschaden für die libanesische Konkordanzdemokratie (die politische Abmachung zwischen den konfessionellen Gruppen) und hohem Risiko für die Hisbollah selbst, falls die Sache für Assad und den Iran schlecht ausgeht. (Gudrun Harrer, DER STANDARD, 22.1.2014)
Die Araber als Randfiguren - Standpunkte zu Syrien zu unterschiedlich
Als Vertreter der Liga der arabischen Staaten sitzt Generalsekretär Nabil al-Arabi in Montreux am Konferenztisch. Er sei da, um zu koordinieren und den arabischen Standpunkt herauszukristallisieren, erklärte er. Das bedeute, die Krise müsse über die Umsetzung von Genf I - einen verhandelten Übergang - gelöst werden.
Arabi stellt in den Vordergrund, dass die Konferenz trotz all der Schwierigkeiten überhaupt beginnt. Am schärfsten hatte Saudi-Arabien am Montag auf die UN-Einladung an den Iran reagiert. Teheran habe mit seinen Spielchen das Ziel verfolgt, Genf II platzen zu lassen, lautete der Tenor in saudisch finanzierten Medien.
Liga verlor an Einfluss
Die Arabische Liga hat in den letzten Monaten mit der zunehmenden Internationalisierung des Syrien-Krieges an Einfluss auf den Gang der Syrien-Diplomatie verloren. Zu unterschiedlich sind die Interessen und Standpunkte der einzelnen arabischen Staaten, vor allem der betroffenen Nachbarstaaten, die wie der Libanon und der Irak immer stärker in den Kriegsstrudel hineingezogen werden. Andere wichtige Mitglieder, wie etwa Ägypten, sind durch die Geschehnisse im eigenen Land vollkommen absorbiert.
Ägyptens Außenminister Nabil Fahmi reiste zwar ebenfalls nach Montreux. Diese historische Chance dürfe nicht verpasst werden, meinte er. Aber seit Kairo wortgleich wie der syrische Präsident den "Kampf gegen den Terror" ausgerufen hat, ist der Handlungsspielraum der ägyptischen Regierung eingeschränkt. Ein Kolumnist schrieb wörtlich, dieselbe Verschwörung wie gegen Ägypten sei in Syrien im Gange, nur dass die Ägypter sie am 30. Juni abgewürgt hätten.
Kommentatoren in den Golfländern, die die Rebellen unterstützen, befürchten, dass Genf II ein Desaster für die ohnehin zerstrittene syrische Opposition und zu einer Rehabilitierung Assads werden könnte. Die Befürchtungen schienen sich bereits am Montagabend zu bestätigen: Der Syrian National Council, lange Zeit als wichtigster Repräsentant der Exilopposition angesehen, verließ den Dachverband Syrian National Coalition, weil dieser nach Montreux geht. Die Chancen auf einen Durchbruch werden allgemein als minimal angesehen. (Astrid Frefel aus Kairo, DER STANDARD, 22.1.2014)
Ankaras Kalkül mit den Islamisten - Die türkische Syrienpolitik gilt als gescheitert
Im Tross der internationalen Syrien-Diplomaten ist die Türkei der wohl eigenwilligste und für die Partner im Westen der anstrengendste Teilnehmer. Ihr Beitrag zu den Bemühungen um eine Beilegung des Kriegs in Syrien schwankte in den vergangenen Jahren zwischen Regionalmacht-Ideen und innenpolitischem Kalkül gegenüber den Kurden. Eine Nachfolgekonferenz zu Genf wollte die Türkei erst gar nicht; sie hatte nach den Chemiewaffenangriffen gegen die syrische Zivilbevölkerung im Sommer vergangenen Jahres auf eine Militärintervention des Westens gehofft.
Seit jüngstem sieht sich die konservativ-religiöse Regierung wegen ihrer Syrienpolitik in einer Opferrolle: "Es gibt einen psychologischen Krieg gegen die Türkei", erklärte Außenminister Ahmet Davutoglu. "Die Türkei wird als ein Land hingestellt, das bewaffnete Gruppen beliefert und den Terror unterstützt." Tatsächlich verfolgen vor allem die USA den Kurs der türkischen Regierung mit Besorgnis. Die hatte zunächst die Formierung einer viele Kräfte umfassenden syrischen Exilregierung torpediert, indem sie immer wieder die Muslimbruderschaft in den Vordergrund schob. Eine sunnitisch dominierte Regierung im Nachkriegssyrien, so die Überlegung, würde die Minderheiten im Land im Griff halten - vor allem die Kurden in Syrien.
Waffentransporte mit Geheimdienstlern
Aus diesem Grund auch hilft die Türkei westlichen Geheimdiensten zufolge islamistischen Milizen in Syrien gegen kurdische Fraktionen; Ankara bestreitet dies. Die türkische Polizei fing allerdings erst dieser Tage wieder sieben Lastwagen mit Waffen ab - der Transport war auf dem Weg nach Syrien von türkischen Geheimdienstoffizieren begleitet worden. In Montreux will die Türkei nun den Start eines politischen Übergangs in Syrien einleiten. Die sunnitisch-islamistische Ausrichtung der Syrienpolitik der Regierung Erdogan gilt gleichwohl als gescheitert. Staatschef Abdullah Gül brach nun sein Schweigen und verlangte eine "Neugewichtung". (Markus Bernath, DER STANDARD, 22.1.2014)