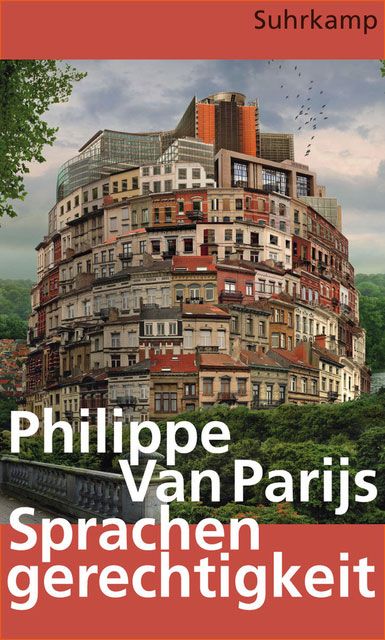
"Life is never fair, and perhaps it is a good thing for most of us that it is not." Wenn Sie diesen Aphorismus von Oscar Wilde lesen und verstehen können, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass Sie Englisch in der Schule gelernt haben. Damit liegen Sie gut im Trend, denn laut Philippe Van Parijs, einem belgischen Professor für Ökonomie und Sozialethik, ist "Englisch – mehr als Latein, Französisch oder irgendeine andere Sprache es je waren – Europas Lingua franca geworden und wird es täglich mehr".
Sollten Sie wider Erwarten (oder, wie es auf Englisch so schön heißt, "against all odds") von dieser globalen Tendenz unberührt geblieben sein, hier Oscar Wildes Worte auf Deutsch: "Das Leben ist nicht gerecht, und für die meisten von uns ist das gut so."
Englisch als Lingua franca? Yes, please!
Für Philippe Van Parijs ist die globale Dominanz des Englischen jedoch kein Grund für wehmütiges Klagen. Damit unterscheidet er sich wohltuend von vielerorts erklingenden kulturpessimistischen Unkenrufen, denen zufolge die gehäufte Verwendung von Anglizismen ein Anzeichen für den baldigen Niedergang der europäischen Kultur ist.
Sprachenvielfalt kein Wert an sich
Van Parijs hat ein Buch geschrieben, dessen Titel zugleich ein Kampfruf ist: Mit "Sprachengerechtigkeit" fordert der Autor ebendiese, auf europäischer wie auf globaler Ebene. Für Van Parijs ist Sprachenvielfalt kein Wert an sich – die Gerechtigkeit dagegen schon.
Was ist schon fair?
Das vage Gefühl, in einer "gerechten" Welt leben zu wollen, teilen vermutlich fast alle Menschen, ebenso wie das Unbehagen zu wissen, dass die Welt, beziehungsweise das sich darin abspielende Leben weit davon entfernt ist, gerecht zu sein. Die Geister scheiden sich jedoch an der Frage des Wie: Welche Mechanismen können dabei helfen, die Ungerechtigkeiten in der Welt auszugleichen? Während sich die EU die Mehrsprachigkeit und die Bewahrung der Sprachenvielfalt an die Fahnen geheftet hat, schlägt Van Parijs einen anderen Weg ein und plädiert für den Ausbau einer Lingua Franca, um so vielen Menschen wie nur möglich einen Zugang zu demokratischen Prozessen zu ermöglichen.
Esperanto ist keine Lösung
Esperanto kommt als Lingua franca für ihn nicht in Frage, weil ein flächendeckender Gebrauch von Esperanto nach kürzester Zeit dieselben Probleme aufwerfen würde wie der Gebrauch des Englischen: Schon die nächste Generation würde muttersprachliche Esperantisten hervorbringen, die gegenüber Nichtmuttersprachlern Vorteile hätten.
Von Trittbrettfahrern und Pendlern
Den Vorteil, die jeweils vorherrschende Lingua franca von Kindesbeinen an zu beherrschen, bezeichnet der Autor als "Trittbrettfahrertum": "Dieses besteht darin, dass manche Menschen sich eines öffentlichen Guts erfreuen, ohne sich an den Kosten seiner Herstellung zu beteiligen. Im Fall einer Lingua franca, bei der es sich um eine natürliche Sprache handelt, scheint das Trittbrettfahren im großen Stil ziemlich unvermeidlich."
Der Autor vergleicht das Erlernen der jeweiligen Lingua franca mit dem Pendeln vom Land in die Stadt: Wenn Menschen sich aus welchen Gründen auch immer weigern, in die Nähe ihres Arbeitsplatzes zu ziehen, entstehen Pendelkosten. Die Frage ist, wer in der Gesellschaft zuständig ist, diese Kosten zu tragen: Die Stadtbevölkerung? Oder die Landbevölkerung? Oder alle zusammen?
Komplexe Modelle
Den Fragen nach Kostenwahrheit und Gerechtigkeit in einer vielsprachigen und stark vernetzten Welt widmet sich der Autor mit beeindruckender Akribie. Er entwickelt im Hinblick auf das Sprachenlernen komplexe Modelle, Formeln und Kosten-Nutzen-Rechnungen, die den Grad an Ungerechtigkeit minimieren sollen, wobei Sprache wie eine volkswirtschaftliche Ressource gehandhabt wird. Der Ansatz des Autors ist durchaus originell und lesenswert. Leider ist davon auszugehen, dass viele interessierte Leser sich unterwegs in den unzähligen, ausufernden Fußnoten und mathematischen Herleitungen verheddern werden und zum Kern des heraufbeschworenen Gerechtigkeitsideals gar nicht vordringen können.
Einsprachigkeit kein Erfolgsgarant
Die Utopie, die der Autor entwirft – eine Welt, in der sich alle gleichberechtigt auf Englisch unterhalten können – mag als erstrebenswertes Ideal nachvollziehbar sein, aber sie ist aus mehreren Gründen fragwürdig. Zunächst einmal geht der Autor in seinen Berechnungen davon aus, dass es sich bei Sprachkompetenz, Spracherwerb und Kommunikation um quantifizierbare Größen handelt. Das ist nicht der Fall. Sprache als Phänomen entzieht sich ebenso einer eindeutigen Quantifizierung wie etwa Schönheit, Talent oder Glück.
Zum anderen beruhen viele Überlegungen des Autors auf der illusorischen Annahme, alle Menschen hätten etwas Konstruktives zur politischen Debatte beizutragen und würden demokratisch partizipieren, wenn sie bloß über genügend Sprachkenntnisse in der richtigen Sprache verfügten. Hier muss man dem Autor leider eine krasse Überschätzung des demokratisch-partizipatorischen Potenzials konstatieren. Und drittens scheint der Autor zu glauben, einsprachige Kommunikation wäre per se effizient, frei von Missverständnissen und lästigen Hierarchien. Dass die Einigung auf eine gemeinsame Sprache aber nur eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzung für gelungene Kommunikation ist, scheint der Autor auszublenden.
Monokultur statt Wildwuchs
Ganz verkürzt gesagt, der Autor plädiert für eine effiziente Monokultur statt des wild wuchernden Gartens. "Der Fluch von Babel wäre dann endlich von uns genommen", heißt es an einer Stelle. Ist die Mehrsprachigkeit aber tatsächlich ein Fluch der Menschheit, den es abzuschütteln gilt? Ist Sprache etwas, das um jeden Preis einem Nützlichkeitsdiktat unterworfen werden muss? Und schließlich – ist es überhaupt so wichtig, in welcher Sprache mächtige Staaten und Großkonzerne die Welt regieren?
Philippe Van Parijs wirft mit seinen Thesen jedenfalls zahlreiche Fragen auf und regt zum Nachdenken und Hinterfragen an. Wer sich jedoch schlüssige Antworten erwartet, wird möglicherweise enttäuscht sein.
Oscar Wilde möge eine Abwandlung seines Zitats verzeihen: Mehrsprachigkeit ist nicht immer effizient, aber vielleicht ist das ganz gut so. (Mascha Dabić, daStandard.at, 6.2.2014)