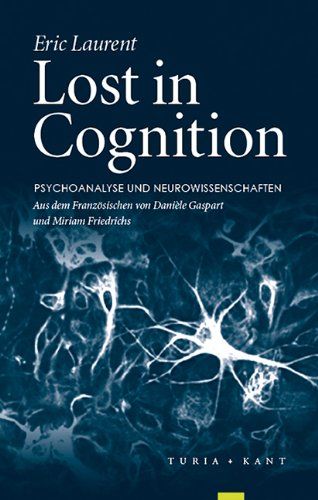
Eric Laurent: "Lost in Cognition. Psychoanalyse und Neurowissenschaften" . Aus dem Französischen von Danièle Gaspart und Miriam Friedrichs. € 24,- / 226 Seiten. turia + kant-Verlag, Wien 2014
Der wissenschaftliche Standort der Psychoanalyse und letztendlich des gesamten psychologischen Diskurses ist nie eindeutig gewesen. So finden sich in Sigmund Freuds Schriften zahlreiche Verweise auf zeitgenössische naturwissenschaftlich-medizinische Befunde, zugleich erweist sich der Verfasser des Unbehagens in der Kultur als ein Autor, dessen Vertrautheit mit Humanwissenschaften, Philosophie und Literatur programmatisch ist.
Das Problem scheint nun gerade darin zu liegen, dass die beiden Perspektiven schlecht miteinander zu vereinbaren sind, die reflektierte Selbsterfahrung und der naturwissenschaftliche Blick auf das Objekt und die Maschine Mensch. Der Wissenschaftsbetrieb hat dieser Inkompatibilität längst Rechnung getragen. Während Freud aus dem (medizin-) wissenschaftlichen Diskurs längst verschwunden ist bzw. dort allenfalls als Vertreter einer vorwissenschaftlichen Psychologie rangiert, gilt er in der Philosophie oder in den Kulturwissenschaften unserer Tage als ein Diskursbegründer, der in einem Atemzug mit Nietzsche oder Wittgenstein genannt wird.
Lost in Cognition ist unverkennbar eine Streitschrift, die auf dieses Spannungsverhältnis Bezug nimmt. Ihr Autor ist der angesehene Lacan-Schüler Éric Laurent, der sich leidenschaftlich gegen die aus seiner Sicht tödliche Umarmung der Psychoanalyse durch die modernen kognitiven Neurowissenschaften wendet. Der englische Titel spielt mit Doppeldeutigkeit: Die Psychoanalyse, die sich auf die Mesalliance mit dem kognitiven Behaviorismus einlässt, ist verloren. Dabei geht das verloren, was für sie zentral ist, das Unbewusste.
Szientistisches Vokabular
Was Laurent entschieden abwehrt, ist nicht zuletzt die Übersetzung psychoanalytischer Kategorien in das szientistische Vokabular der heutigen Neurowissenschaften. In dieser Übersetzung geht, so die österreichischen Herausgeber Avi Rybnicki und Gerhard Zenaty, die "Originalität des Freud'schen Unbewussten, welches auf keinerlei Lernprinzip beruht", verloren. Das psychoanalytische "Symptom" sei eben keine "Störung", kein "kognitiver Irrtum", "sondern Ausdruck einer Wahrheit des Subjekts".
Bereits dem Sprachgestus ist anzumerken, dass man sich mit diesem Widerstreit in verschiedenen Wissenschaftswelten befindet. Laurents Buch richtet sich vehement gegen die Versuche der - amerikanischen - Psychoanalytiker, ihre eigene frühere "Ich-Psychologie" in kognitive Termini zu übersetzen, wie das etwa bei Eric Kandel oder Antonio Damasio der Fall ist. Dem stellt Laurent eine Auffassung gegenüber, die psychische Symptome wie Halluzinationen nicht einfach als "Fehler der Wahrnehmung" begreift.
Um das Unbewusste in diesem Sinne zu fassen, bedarf es einer Innenperspektive, die die "objektive" naturwissenschaftliche Kognitionspsychologie ausschließt. Was Laurent seinen Kontrahenten vorwirft, ist nicht zuletzt ein programmatischer Reduktionismus, in dem die Messungen alles und etwa die Träume der Menschen nichts sind.
In manchen Punkten ähnelt der Streit jenem, den Horkheimer und Adorno vor Jahrzehnten gegen die instrumentelle Vernunft ausgetragen haben. Die Pointe lief darauf hinaus, dass in der vermeintlichen Objektivierung durch den Szientismus schon eine strukturelle Funktionalisierung alles Menschlichen impliziert ist. Der grassierende Lerndiskurs, das dass das Sprechen über das Unbewusste neutralisiert, entpuppt sich am Ende als Teil eines neodarwinistischen Paradigmas, das den Organismus als etwas begreift, das immer schon auf die Optimierung des Überlebens ausgerichtet ist. Deshalb spielt in den frühen Forschungsprojekten Kandels, seinen Untersuchungen an Meeresschnecken, die Relation zwischen Konditionslernen und der funktionalen Veränderung bestimmter Synapsen eine maßgebliche Rolle. "Plastizität" wird zum Ausweis dieses Überlebensdranges alles Organischen.
Die Psychoanalyse Lacans setzt demgegenüber auf die menschliche Sprache, die einen Riss in die Welt, damit aber auch das Unbewusste zur Sprache bringt. Von daher rühren auch all die paradoxen und verwegenen Sprachspiele, die dieser eigen sind, wie Laurent im Rückblick auf das Seminar XXIII zeigt, in dem sich die Schüler des Meisters in das Werk von James Joyce verlieren. Lacan plädiert für eine Auseinandersetzung mit der Erfahrung des Subjekts, die sich einer experimentellen und endlos metaphorisierenden Sprache bedient, um das scheinbar Unaussprechliche am Ende doch sagbar zu machen. Damit bildet sie den radikalen Gegenpol zum naiven Szientismus.
Dass es in dieser Kontroverse um mehr geht als um eine rein intellektuelle Auseinandersetzung, zeigen Laurents Kommentare über Messbarkeit und Evaluierung. Was die "wissenschaftliche" Kognitionspsychologie der Gesundheitspolitik an die Hand gibt, sind scheinbar objektive Klassifizierungsprogramme mit so schönen Kürzeln wie DSM (Diagnostic and Statistic Manual), in der man zum Beispiel die kognitiven Lernfortschritte der Verhaltenstherapie mit einer klassischen Analyse abgleicht. Das Ergebnis ist vorprogrammiert. Unter dem Blickwinkel ist die Verhaltenstherapie viel effizienter und preiswerter als die Psychoanalyse. Wenn man nicht konservativ den scheinbar unaufhaltsamen Ökonomismus in allen Lebensbereichen beklagen will, dann bleibt mit Laurent nur zu hoffen, dass sich die gigantische Evaluierungsmaschinerie am Ende überall zu Tode läuft und der scheinbare Luxus intelligenter Selbsterfahrung (wieder) Teil unseres kollektiven Selbstbildes wird. (Wolfgang Müller-Funk, DER STANDARD, 22.3.2014)