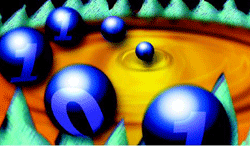Buchberger: Es geht um den intellektuellen Prozess, von einem Problem zur Lösung zu kommen. Diesen versuchen wir zu automatisieren. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen: Man gibt in einer genormten Sprache eine Problembeschreibung ein - zum Beispiel: "Ich will sortieren" - und in vielen Fällen kommt der passende Algorithmus heraus, gleich mit dem mathematischen Beweis dafür, dass der Algorithmus richtig ist. Wir versuchen nun, diesen intellektuellen Prozess zu verfeinern und immer mehr schwierige Handlungsvorschriften zur Lösung der gegebenen Problem automatisch zu erstellen. Anwendungen sind natürlich in der Softwareproduktion möglich, die dadurch strukturierter und kontrollierter wird. Die Software wird dadurch verlässlicher in ihrer Anwendung. Fehler werden seltener auftreten.
DER STANDARD: Als Mathematiker betreten Sie dabei eine Metaebene und müssen sich eigentlich bei der Lösung von Problemen selbst beobachten, um diesen Prozess automatisieren zu können?
Buchberger: Genau das ist besonders wichtig. Sie als Journalist denken ja sicher auch darüber nach, was Journalismus soll. Die besten Künstler fragten sich immer wieder, was Kunst ist. Denken Sie zum Beispiel an die Wiener Sezessionisten. Die Logik, also das Nachdenken darüber, wie Mathematiker denken, hat außerdem hier zu Lande eine lange Tradition. Kurt Gödel etwa, im heutigen Bratislava, damals Österreich-Ungarn, geboren, war einer der bedeutendsten Vertreter. Seinen Überlegungen und der Arbeit anderer Logiker ist eigentlich die Basis des Computers zu verdanken, wie wir ihn heute kennen. Ein Nachbildung von intellektuellen Prozessen.
DER STANDARD: Denken Sie auf dieser Metaebene auch einen Schritt weiter: Zum Beispiel das Leben in Algorithmen fassen?
Buchberger: Eine Lösung für ein mathematisches Problem zu finden, ist für mich ein großes Glücksgefühl. Das Alltagsleben würde ich da aber ausklammern wollen. Es ist ja deswegen so spannend, weil es durch keine Algorithmen bestimmt wird. Wir bewegen uns bei unserer Arbeit nur auf einer logischen Ebene. Das wäre doch auch zu einfach, wenn man ein menschliches Problem formulieren könnte und eine Maschine würde mir die Lösung dazu servieren.
DER STANDARD: Wenn die Algorithmensynthese hält, was Sie versprechen, wird wohl das Interesse der Softwareindustrie daran recht groß sein?
Buchberger: Das Interesse wird sicher einmal groß sein. Derzeit arbeiten wir an den Grundlagen, und das ist mir ehrlich gesagt auch jetzt wichtiger als die Interessen der Wirtschaft. Ich sehe mich ja auch als Grundlagenforscher. Unsere Arbeit ist das, was in 20 Jahren die Wirtschaft ausmachen wird. Und wenn wir da in Österreich nicht vorne mitmischen, sind wir einmal weg vom Fenster.
DER STANDARD: Sind wir denn vorne?
Buchberger: Die Chancen, vorne mitzumischen sind da, nicht zuletzt in der Informationstechnologie. Wir haben hier die Weltspitze der Quantenphysik versammelt und auch die österreichischen Mathematiker sind, bei aller Bescheidenheit, in manchen Bereichen sehr weit vorne. Deswegen werden wir uns auch zusammensetzen und beide Bereiche zusammenführen, um die Entwicklung des Quantencomputers voranzutreiben.
DER STANDARD: Also wieder reine Grundlagenforschung. Wie machen Sie Investoren begreifbar, dass Grundlagenforschung wichtig ist? Die sehen doch meist nur die aktuelle Problemstellung und hoffen auf eine Lösung und eine rasch vermarktbare Innovation.
Buchberger: Gerade durch die Grundlagenforschung einerseits und die Arbeit an neuartigen Anwendungen andererseits entsteht ein Spannungsfeld. Nehmen Sie den Softwarepark Hagenberg: Einerseits machen wir dort sehr abstrakte Dinge, da lassen wir uns die Themen nicht von der Industrie vorgeben. Andererseits wird auch der Sattlermeister aus Bad Leonfelden, der eine neue Datenbank braucht, bedient. Diese Spannung ist für uns Forscher wie eine Massage des Gehirns. Der Softwarepark verbindet Grundlagen und Anwendungen und ist gewissermaßen die Erdung der Forschung.
DER STANDARD: Mit dem Beispiel des Sattlermeisters beschreiben sie auch eine Mehrzahl österreichischer Firmen. Es sind Klein-und Mittelbetriebe. Wie stehen die Ihrer Meinung nach zu Forschung und Technologieentwicklung?