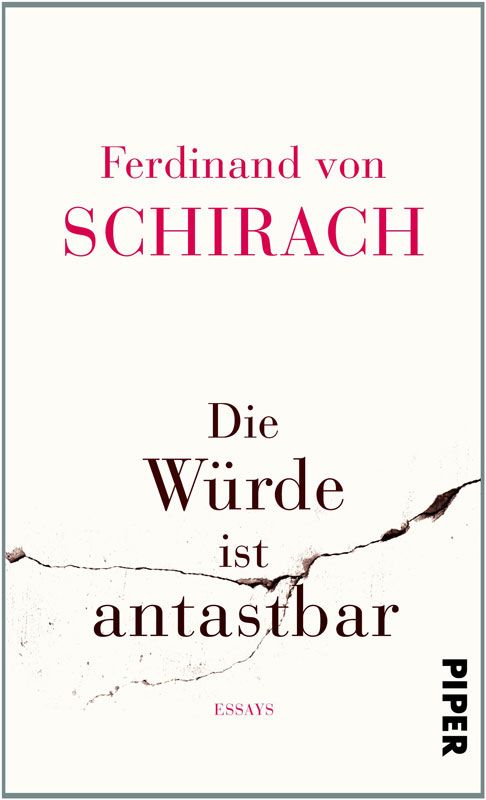STANDARD: Herr von Schirach, es sind gerade einmal fünf Jahre, seit Sie Ihr erstes Buch "Verbrechen" veröffentlicht haben. Das müssen fünf extreme Jahre gewesen sein.
Ferdinand von Schirach: Eigentlich nicht. Mit 20 hätte mich der Erfolg vielleicht verändert. Aber ich war schon 45, als Verbrechen erschien. Da ist man nicht mehr ganz so durcheinander. Ich würde es auch nicht gut ertragen, wenn sich mein Leben zu sehr verändern würde.
STANDARD: Immerhin mussten Sie Ihren Beruf aufgeben. Weil Sie einmal einfach umkippten, wie man in einem Beitrag in dem neuen Buch "Die Würde ist antastbar" lesen kann.
Von Schirach: Ich musste ihn nicht ganz aufgeben, ich bleibe wohl immer Anwalt. Aber Sie haben schon Recht, man kann nur eine Zeit lang zwei Sachen gleichzeitig machen. Irgendwann wird es zu viel, und dann macht man beides nicht mehr gut. Zurzeit berate ich noch in einigen Mandanten, aber ich trete nicht vor Gericht auf. Ich schreibe jetzt lieber. Im Gegensatz zu unseren Eltern haben wir heute doch die Möglichkeit, mehrere Berufe zu haben. Wir machen mal das eine, mal das andere. Das kann ein Geschenk sein.
STANDARD: Sind Sie Schriftsteller geworden, weil Sie bemerkt haben, dass schon in Ihrem Beruf als An-walt literarische Arbeit steckt?
Von Schirach: Vielleicht ist es so, dass sich vieles ähnelt. Im Gericht geht es um Sprache. Anwälte hießen früher "Fürsprecher", sie sprechen für ihren Mandanten, weil diese selbst es oft nicht können. Der Anwalt - wie der Schriftsteller - erzählt also eine Geschichte. Diese Geschichten sind wichtig, denn je mehr wir über einen Menschen wissen, umso schwerer fällt es uns, ihn zu verdammen. Jeder Polizist weiß das: Wenn ein Mädchen entführt wird, ist es entscheidend, dass der Täter schnell ihren Namen erfährt. Schon wenn er weiß, dass sie Luisa oder Sabine heißt, kann ihn das hemmen, ihr Gewalt anzutun. Im Gericht ist es nicht anders. Ein Richter wird einen Menschen, von dem er nichts außer seinem Verbrechen kennt, leichter zu hohen Strafen verurteilen. Es ist also die Aufgabe des Anwalts, den Richtern den Menschen näher zu bringen. Wer ist er? Wie hat er gelebt? Was waren seine Hoffnungen, seine Träume, wie strebte er nach Glück? Oft habe ich diese Geschichten aufgeschrieben. Irgendwann wusste ich, was funktioniert und was nicht, was die Richter berührt und was nicht. Und der Leser ist der Richter des Schriftstellers.
STANDARD: Vor Gericht werden konkurrierende Geschichten abgeglichen. Spricht der Verteidiger dabei immer auch als Verteidiger der Conditio humana als solcher?
Von Schirach: Ja, natürlich. Ich verteidige ja nicht das Verbrechen selbst, ich verteidige den Menschen. Wenn ein Mann seine Frau erschlägt, ist das immer furchtbar. Die Verteidigung besteht darin, dass ich darstelle, wie der Mann zu dieser Tat gekommen ist. Und diese Geschichte muss stimmen, sie darf nicht einseitig sein, sonst wird sie niemand glauben. Wenn Sie als Schöffe - oder eben als Leser - am Schluss den Angeklagten verstehen, dann nicht, weil ich ihn verteidigt habe, sondern weil ich von ihm erzählt habe. Ein Anwalt kann eine schreckliche Tat nicht rechtfertigen. Aber manchmal kann er zeigen, dass der Ange-klagte auch nur ein Mensch ist.
STANDARD: Die Ausnahme, also dass jemand das Gesetz verletzt, ist für Sie der Alltag.
Von Schirach: Das ist mein Beruf, ja. Wenn wir Verbrechen nur aus der Zeitung kennen, glauben wir, die Täter sind nicht wie wir. Wir glauben, sie sind eine andere Spezies, Aliens vielleicht, die nichts mit uns zu tun haben. Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit unterscheiden sie sich kaum von uns. Wenn wir Glück haben, kommen wir nicht in eine solche Situation. Wenn wir Glück haben.
STANDARD: Sind die Morde der NSU auch Verbrechen aus Leidenschaft?
Von Schirach: Nein. Politische Verbrechen sind etwas ganz anderes. Menschen wegen einer Ideologie zu töten ist schlimmer. Solche Verbrechen sind kalt, menschenverachtend, abstoßend.
STANDARD: Ihr neues Buch "Die Würde ist antastbar" enthält auch einen Kommentar zu dem Verfahren gegen die RAF-Terroristin Verena Becker.
Von Schirach: Da geht es um das Verhältnis der Justiz zur Zeitgeschichte. Wir sind heute doch sehr viel weiter, als wir es in den Terroristenverfahren waren, das wollte ich zeigen. Der Staat war damals unsicher. Das war auch ein Grund für Mystifizierung der RAF.
STANDARD: Was Sie gerade sagen, enthält einen scheinbaren Widerspruch. Gesetze sind doch objektiv, der Staat aber kann unsicher sein?
Von Schirach: Gesetze sind erst mal nur das Papier und die Druckerschwärze. Sie müssen mit Leben erfüllt werden. Ein Unrechtsstaat kann dieselbe Verfassung wie Österreich haben. Sie wird dann eben nur anders ausgelegt. Die Bundesrepublik war damals ein sehr junger Staat. Sie wankte unter den Terroristen, sie machte Fehler, reagierte oft dumm und mit falscher Härte, sie veränderte sogar die alte, sehr vernünftige und ausgeglichene Strafprozessordnung. Zudem waren die Richterbänke in Teilen noch immer von ehemaligen Nazis besetzt.
STANDARD: "Die Würde ist antastbar" spielt nun auch auf die Bedrohung des Terrorismus an, allerdings unter anderen politischen Vorzeichen.
Von Schirach: Das ist die Bedrohung unserer Zeit. Wir glauben, wir seien heute in Sicherheit. Aber das ist falsch. Nach diesem abgeschossenen Flugzeug geht ein Murren durch die Welt, Vergleiche mit 1913/14 beschäftigen uns schon das ganze Jahr. Es gibt ein dunkles Gefühl, dass wir an einer Schwelle stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gesetze dann halten werden. Wir sollten vorsichtig sein, wirklich jeder Schritt muss sehr gut überlegt sein, es gibt keine schnellen Lösungen. Gesetze sind Prinzipien. Dann passiert etwas, und alle wollen sofort, dass wir nur nach diesem Einzelfall entscheiden - wenn es sein muss, auch gegen die Gesetze. Aber wenn wir anfangen, unsere Entscheidungen nach Einzelfällen zu richten, sind wir verloren. Und das geht sehr schnell.
STANDARD: Ist das wirklich vorstellbar?
Von Schirach: Ich fürchte ja. Nehmen Sie nur an, es gibt eine neue Bankenkrise, eine ernstere. Die Arbeitslosenquote steigt innerhalb von zwölf Monaten auf 50 Prozent. Strom wird teuer, weil Russland kein Gas mehr liefert. Sie glauben gar nicht, wie schnell sich die Gesellschaft und damit die Gesetze verändern würden.
STANDARD: Sie sind Anwalt und Schriftsteller, mit dem neuen Buch äußern Sie sich auch als Intellektueller.
Von Schirach: Ich mag den Begriff nicht. Ich habe einfach ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir durch den Kopf gehen. Tatsächlich ist es nur mein Unbehagen - die Welt scheint zu kompliziert für mich geworden zu sein, vieles verstehe ich einfach nicht. Was wissen wir denn wirklich über den Konflikt im Gazastreifen? Oder von den Finanzströmen? Oder von der NSA? Oder vom Islam? Ich bezweifle auch, dass die Abgeordneten, die für uns entscheiden, die Vorlagen auch nur lesen. Vielleicht ist Fußball deshalb so populär. Das Spiel ist einfach zu verstehen, der Ball geht von links nach rechts und rechts nach links.
STANDARD: Sie lieben Fußball auch?
Von Schirach: Ich finde es ein bisschen langweilig. Wir haben jeden dieser Spielzüge schon oft gesehen, die Spiele ähneln sich. Worauf warten wir also vor dem Fernseher? Eigentlich doch nur darauf, dass einer der Spieler zum Helden wird. Und ich kann mit Helden nicht so viel anfangen.
STANDARD: Aber haben Sie sich gefreut, dass Deutschland Weltmeister wurde?
Von Schirach: Natürlich. Während der WM in Berlin hatte ich meine Kanzlei noch am Brandenburger Tor und es war großartig, dort zu sehen, wie die Fans aller Nationen miteinander gefeiert haben. Aber es gibt auch die dunkleren Seiten, die Parolen, die geschrien werden, das Beleidigen der anderen. Und ich mag einfach keine Massen. Außerdem bin ganz unsportlich.
STANDARD: In der Autorenfußballmannschaft, die es ja auch gibt, müssen wir Sie also wohl nicht erwarten.
Von Schirach: Das würde schiefgehen, stimmt.
STANDARD: Wie halten Sie es denn sonst mit dem Literaturbetrieb?
Von Schirach: Ich gehöre nicht dazu. Ich schreibe Bücher, aber ich habe sonst nichts damit zu tun. Ich hatte aber auch nie etwas mit dem Anwaltsbetrieb zu tun, selbst auf die Kammerversammlungen bin ich nicht gegangen. Ich finde jede Art von Betrieb und Verein lächerlich. Schriftsteller, da ähneln sie übrigens den Juristen, glauben gerne, sie wüssten alles, sie könnten alles erklären. Das ist mir fremd.
STANDARD: Man muss es sich leisten können. Sie waren finanziell schon vor den Bucherfolgen abgesichert?
Von Schirach: Ich komme zurecht. Ich spiele kein Golf, gehe nicht auf Partys und werde niemals eine Yacht kaufen. Zeit zum Schreiben zu haben, ist ein großer Luxus, das weiß ich natürlich. Aber das ist schon alles. Wenn ich Ihnen eine Million gebe, würden Sie etwas Grundlegendes an Ihrem Leben ändern? Würden Sie auf die Malediven ziehen?
STANDARD: Ich würde vielleicht auf die Malediven fahren, aber wiederkommen.
Von Schirach: Ich reise nicht mehr gerne, jeder Flug erinnert doch an Massentierhaltung, vor den Schaltern sind inzwischen Gatter aufgestellt. Außerdem langweilt mich der Strand, zu viel Sand überall und meistens zu heiß.
STANDARD: Das fällt dann also auch aus als Extravaganz. Kann man von Ihrer asketischen Lebensweise auf Ihren literarischen Stil schließen? Der zeichnet sich ja auch durch Reduktion aus.
Von Schirach: Ich lebe nicht asketisch, das wäre ja auch wieder eine Übertreibung. Und der Stil? Er war einfach da. Vielleicht schreibt man ein bisschen so, wie man ist. Ich könnte jetzt nicht, obwohl ich es gern würde, so schreiben wie Thomas Mann oder Leo Tolstoi. Meine Sätze sind kurz, meistens Hauptsätze, kaum Adjektive, ich schreibe in Bildern und möglichst einfach. Das ist ja das Schwierigste, einfach zu bleiben. Wenn Sie mit Laienrichtern sprechen, und Sie machen es kompliziert, werden Sie nicht verstanden, und Ihr Mandant bekommt eine hohe Strafe.
STANDARD: Man schreibt so, wie man ist. Ich sehe einen Mann mit Gentleman-Habitus. Höflich, ruhig. Sie sprechen sachte.
Von Schirach: Ich bin ein bürgerlicher Mensch, kein genialistischer Künstler, niemand, der sich auf ei-ner Lesung mit einer Rasierklinge die Stirn aufschneidet und das Hemd runterreißt. Und etwas distanziert, das stimmt schon.
STANDARD: Kommt das aus der Familie?
Von Schirach: Eltern gehen heute mit ihren Kindern viel weniger distanziert um, als ich aufgewachsen bin. Sie scheinen dafür andere Schwierigkeiten zu haben. Ein Vater spielt heute mit seinem Kind so, als wäre er selbst ein Kind. Zwei Minuten später soll er ihm als Erwachsener etwas verbieten. Das ist für das Kind schwierig. Bei uns waren die Welt der Eltern und die der Kinder komplett getrennt. Ich habe zum ersten Mal mit den Eltern gegessen, als ich zehn war. Davor war es undenkbar, mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. Das war vermutlich auch falsch.
STANDARD: Ihr Großvater saß gemeinsam mit Albert Speer in Spandau wegen Zugehörigkeit zur Elite des NS-Regimes in Haft. Sie haben einen Text im neuen Buch, in dem Sie erklären, warum Sie zu Baldur von Schirach nichts mehr sagen wollen. Wie empfanden Sie es, als Albert Speer vor Jahren mit dem Film "Der Untergang" noch einmal fast so etwas wie eine Rehabilitation erfuhr?
Von Schirach: Speer hatte sein Renommee von Joachim Fest, auf dessen Arbeiten auch das Drehbuch zu Der Untergang beruht. Fest irrte sich. Wenn man alles Zweitrangige wegstreicht, bleibt bei Speer übrig, dass er in Posen 1943 Himmlers geheime Rede über die vollständige Judenvernichtung gehört hat. Spätestens dann gibt es für ihn keine Entschuldigung mehr. Das wusste Fest nicht, oder vielleicht er wollte es auch nicht wissen. Fest ist mit Speer berühmt geworden. Er hat sein Leben lang von diesem Ruhm gelebt. Es ist schwer, sich einzugestehen, dass man sich geirrt hat. Vielleicht ist es sogar unmöglich.
STANDARD: Ihr drittes Buch "Der Fall Collini" handelt auch von deutscher Schuld.
Von Schirach: Ja, der Nachkriegsschuld. Das Buch hat etwas erreicht, wovon ein Schriftsteller nur träumen kann. Es hat etwas in der Politik bewirkt, die Justizministerin setzte eine Historikerkommission ein, die diese Vorgänge aufklären soll. Ich bekam zum Beispiel einen Brief von einem Hochschullehrer in Korea, der schilderte, dass sie dort vor denselben Problemen stehen. In Japan wird es demnächst als Theaterstück aufgeführt. Hier wird bald ein Film daraus gemacht, und in einigen Bundesländern gehört es zum Abiturstoff. Das Buch bewegt die Menschen. Das ist es, wofür man schreibt.
STANDARD: Schauen Sie eigentlich "Tatort"?
Von Schirach: Nein.
STANDARD: Weil das Fernsehen zu fern von der Wirklichkeit ist?
Von Schirach: Beim Tatort geht es immer um ein aktuelles gesellschaftliches Problem, aber in der Realität gibt es keine Kommissare, die Helden sind, die Aufklärung eines Verbrechens ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Der Film braucht aber diese herausgehobenen Figuren, das hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Außerdem sehe ich kaum fern.
STANDARD: Der Tatort hat ja etwas Beruhigendes. Verbrechen passt seit vielen Jahrzehnten immer in das 90-Minuten-Format. Ihr neues Buch spielt mit seinem Titel auf das Pathos der Aufklärung an. Ist eine Überwindung des Verbrechens durch Verbesserung der Gesellschaft denkbar?
Von Schirach: Nein, das glaube ich nicht. Sie können die Lebensumstände der Menschen verbessern, dann gibt es weniger Verbrechen. Das betrifft aber Verbrechen, bei denen es um Geld geht, das sind ohnehin die langweiligeren. Die Struktur des Menschen, dass er Liebe empfinden kann und Eifersucht, das wird sich nicht ändern. Verbrechen wird es immer geben.
STANDARD: Die postheroische Gesellschaft bringt keine leidenschaftslosen Menschen hervor?
Von Schirach: Das wäre doch furchtbar. Bleiben wir beim Fußball - schauen Sie sich eine Sekunde die Menschen in einem Stadion an, pure Leidenschaft, oft bis ins Extrem gesteigert. Ein Leben ohne Leidenschaft wäre unerträglich, blass und letztlich unmenschlich. Aber diese Gefühle sind auch die Ursprünge von Verbrechen. Es gibt also immer zwei Seiten.
STANDARD: Ohne Leidenschaft gäbe es vielleicht keine Geschichten mehr.
Von Schirach: Und wir leben von Geschichten. Was tun wir abends? Wir erzählen uns Geschichten.
STANDARD: Ihr viertes Buch "Tabu" ist ziemlich umstritten. Was bedeutet es Ihnen?
Von Schirach: Es ist im Feuilleton umstrittener als bei den Lesern - und ich schreibe ausschließlich für die Leser. Das Buch war ein Experiment. Es ist auf zwei Ebenen geschrieben, eine ist leicht und schnell lesbar, und darunter liegt eine zweite Geschichte, die des Ödipus. Im Ausland ist die Aufnahme positiver als in Deutschland, vielleicht liest man es auch hier in ein paar Jahren anders. Es ist aber am Ende auch nicht so wichtig. Ich selbst halte es für mein bisher bestes Buch. Es hat mich jedenfalls am meisten Kraft gekostet.
STANDARD: Wenn Sie mit Patrick Süskind verglichen werden, an dem sich auch die Geister scheiden - stört sie das?
Von Schirach: Überhaupt nicht. Ich bewundere Süskind, er ist einer der Großen. Das Parfüm ist ein wunderbares Buch. Aber Vergleiche sind auch eher etwas für das Feuilleton, sie sagen nicht wirklich etwas über den Autor. Die New York Times verglich mich mit Kafka und den Gebrüdern Grimm, der britische Independent mit Kleist. Was soll das bedeuten? Im Grunde genommen gar nichts.
STANDARD: Woran arbeiten Sie derzeit?
Von Schirach: Ich habe vor vier Wochen ein Theaterstück fertig geschrieben, das geht gerade an die Schauspielhäuser, und wir verhandeln die Filmrechte. Ich kann mir vorstellen, dass es eine größere Diskussion auslösen wird. Es geht um Terrorismus.
STANDARD: Und in der Prosa?
Von Schirach: Ich werde vielleicht noch einmal Kurzgeschichten schreiben, danach habe ich ein großes Projekt, für das ich viel Zeit brauchen werde.
STANDARD: Wie sieht ein idealer Tag aus?
Von Schirach: Gleich. Immer gleich. Ich stehe auf, frühstücke im Café, gehe in meine Wohnung, in der ich schreibe, schreibe, mache Mittagsschlaf, danach mache ich Korrespondenz, gehe Abendessen und früh ins Bett.
STANDARD: Jetzt wissen wir über Ihr Privatleben immer noch ziemlich wenig.
Von Schirach: Ich bin ja kein Filmstar. Das ist also gar nicht nötig. (Bert Rebhandl, Album, DER STANDARD, 9./10.8.2014)