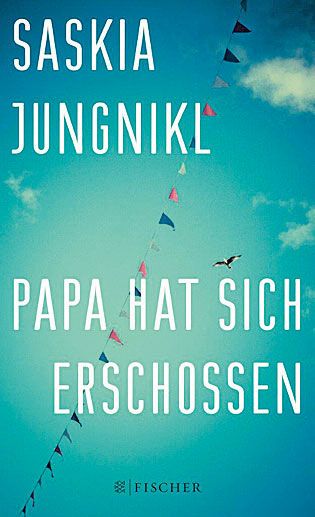Die Rückkehr in das normale Leben ist schwieriger, als ich es mir in guten Momenten gedacht, und genauso schwierig, wie ich es in meinen schweren Momenten befürchtet habe. Manchmal, wenn ich am Abend im Bett liege, sehe ich die Toten als schwarze, unheilvolle Geister an der Decke. Eine Phase in meinem Leben beginnt, in der ich mich so einsam fühle wie noch nie zuvor. Ich schaffe es nicht, andere in mein Leben zu lassen, weil ich nicht glaube, ihnen begreifbar machen zu können, was in mir vorgeht.
Der Suizid hat alles in mir erschüttert, was ich bis dahin zu wissen glaubte. Das Bild, das ich von mir hatte, das Vertrauen in meine Fähigkeiten: Alles ist weg.
Als ich eines Morgens aufwache, kann ich nicht aufstehen. Ich sehe an die weiße Decke, durch die geschlossenen Jalousien dringen Sonnenstrahlen. Warum soll ich aufstehen? Pflichtgefühl? Ich fühle mich, als wäre ich hundert Jahre alt, als hätte ich alles gesehen. Was soll in meinem Leben denn noch auf mich warten? Und vor allem: Was soll das für ein Leben werden, in dem ich mich für immer an den Tod meines Vaters und den Tod meines Bruders erinnern werde?
Der Gedanke lässt mich verzweifeln. Dieser Schmerz wird für immer in mir bleiben, wie soll ich damit leben lernen? Ich drehe mich zur Seite. Vier Tage lang bleibe ich im Bett, stehe nur auf, um auf die Toilette zu gehen und um mir ein wenig Wasser zu holen. Ich schreibe meiner Chefin, dass ich krank bin, und dann schalte ich mein Telefon aus. Ich rede mit niemandem. Ich esse nicht, ich lese nicht, und ich sehe nicht fern. Ich dämmere dahin und schlafe und schlafe und schlafe, und nur anfangs weine ich noch, irgendwann mache ich nicht einmal mehr das.
Mir fehlt die Kraft, mich meinem Leben zu stellen. Wenn in meinem Kopf Bilder auftauchen, von meinem Vater, wie er mich das letzte Mal in den Arm nimmt, wälze ich mich auf die andere Seite und schlafe wieder ein. Ich wünsche mir jedes Mal, dass ich nicht wieder aufwache, und jedes Mal wache ich wieder auf.
Nach vier Tagen tut mir von dem ständigen Liegen mein Körper weh. Der körperliche Schmerz beginnt wichtiger zu werden als der seelische. Ich stehe auf und gehe ins Badezimmer und wasche mein Gesicht. Ich sehe mich an, ich erkenne mich nicht wieder. Alles ist wie in Watte gepackt, in mir ist nichts, ich bin teilnahmslos, immer noch in einem leichten Dämmerzustand. Aber ich lege mich zumindest nicht mehr ins Bett. Ich esse eine Suppe, und dann rufe ich meine Mama und meine Freundinnen an, die sich Sorgen gemacht haben. (...)
***
Als ich das erste Mal spüre, dass es bergauf geht, ist es drei Jahre nach dem Tod meines Vaters. Ich stehe an einer Straßenecke. Mir gegenüber ist ein Coffeeshop. Der Coffeeshop. Ich bin am selben Ort wie an jenem Montag im Jahr 2008. Ich starre auf die Frontscheibe und warte darauf, dass der Schmerz einsetzt.
Nichts passiert.
Ich bleibe ein paar Minuten stehen, dann drehe ich mich um und gehe ganz langsam die Treppe hinunter zur U-Bahn.
Auf einmal, vollkommen unerwartet und aus dem Nichts, bin ich glücklich. Eine unglaubliche Leichtigkeit ist in meiner Brust, in meinem Bauch ein leichtes Kribbeln. Das eine treibt das andere an. Pure Euphorie.
Nur nicht bewegen, nur nichts machen, denke ich mir. Hinauszögern, solange es geht. Ich setze mich auf eine der Bänke. Ganz ruhig weiteratmen. Die U-Bahn kommt, ich lächle den einsteigenden und aussteigenden Menschen glücklich zu, sie sehen mich misstrauisch an. Die U-Bahn fährt ab, ich bleibe sitzen.
Es ist, als hätte jemand eine schwere dunkle Decke von mir genommen. Auf einmal kann ich wieder den Himmel sehen und riechen, schmecken, fühlen. Es versetzt mich in ein unglaubliches Hochgefühl.
Ich warte noch ein paar weitere U-Bahnen ab. Langsam flaut das Gefühl in mir ab. Irgendwann steige ich dann ein, zu meinem Termin komme ich fast eine halbe Stunde zu spät, und noch nie war mir etwas so egal. Heute weiß ich nicht mehr, wohin ich überhaupt musste, aber an diesen Moment werde ich mich für immer erinnern.
In den kommenden Monaten, wenn alles wieder beim Alten ist, kann ich mir das Gefühl sogar manchmal wiederholen, wenn ich nur lange und intensiv genug daran denke.
Es wäre falsch zu sagen, dass es danach steil bergauf geht. Es ist wie vorher auch: Es geht besser und dann wieder schlechter, die Wellen kommen und gehen. Aber die Momente, in denen es mir besser geht, werden merklich besser, und die schlechten Momente bleiben nur so schlecht, wie sie es zuvor schon waren.
Trauer hat keine Deadline.
Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ein Kopfmensch, wenn ich mich zu etwas entschließe, dann will ich es auch schnell umsetzen. Es ist eine harte Lektion, die ich in diesen Jahren nun lerne: Trauer gibt einen Dreck auf meine Ungeduld.
In unserer Gesellschaft lernen wir, dass wir nach einer gewissen Zeit wieder zu funktionieren haben. Der Tod hat keinen Platz im Leben. Unsere Gesellschaft drängt das Sterben und das Lebensende immer weiter an den Rand, und dabei ist doch beides immer mehr unter uns. Nur sichtbar gemacht wird es nicht. Dabei wäre das wichtig. Es braucht Raum für Trauer.
Denn sie ist gegenwärtig. Das Mitgefühl, das man anfangs Trauernden gegenüber aufbringt, ist schön - aber weder hält es über Monate, noch muss das sein. Es reicht Respekt. Trauernde dürfen nicht unter Druck gesetzt werden, nach zwei Monaten ihr Leid abzulegen und wieder zu funktionieren, weil sie Angst davor haben, dass sie anderen sonst auf die Nerven gehen oder belächelt werden.
In manchen Kulturen ist es immer noch so, dass nach dem Tod eines geliebten Menschen ein Jahr lang Schwarz getragen wird - so dass alle sehen: Dieser Mensch ist in Trauer. Wir glauben, nach dieser oder jener Zeitspanne kann der Tod abgehakt werden. Das ist nicht so.
Wir verlernen, Geduld mit uns selbst zu haben. Wir verarbeiten nicht mehr nach unserer eigenen inneren Uhr, sondern orientieren uns an anderen. Anstatt auf uns zu hören, lesen wir lieber Ratgeberbücher: Ah, der hat acht Monate gebraucht, dann ging es ihm besser. Ah, das ist also die vierte Phase der Trauerbewältigung.
Aber vielleicht brauche ich acht Jahre statt acht Monate. Vielleicht kommt bei mir nach Phase vier der Trauerbewältigung wieder Phase eins. Wer weiß das schon. Wer kann es mir schon sagen? Und ist das überhaupt wichtig? (...)
***
Ein Suizid zieht immer weitere Kreise, als angenommen wird. Er erschüttert Menschen, die eigentlich nicht auf dem Radar sind.
Viele Menschen wissen nicht, wie sie das Thema ansprechen oder wie sie den unmittelbar Betroffenen begegnen sollen. Sie wollen helfen, aber sie wollen nicht aufdringlich sein. Sie wissen nicht, ob und was sie fragen dürfen und was zu intim ist. Ich bin mir sicher, es ist ganz egal, welche Frage es ist, die gestellt wird. Hauptsache, es wird eine Frage gestellt.
Es ist das Wichtigste, dass es möglich ist, über das Entsetzen zu reden und das Gefühl zu haben, damit niemandem zur Last zu fallen. Ich möchte lieber sagen können, nein, heute will ich bitte nicht darüber reden, als sagen zu müssen, bitte, können wir darüber reden, dass mein Vater sich getötet hat? (Saskia Jungnikl, Album, DER STANDARD, 25./26.10.2014)