
Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke: "Das Science Fiction Jahr 2014"
Broschiert, 971 Seiten, € 38,10, Heyne 2014
Wie könnte man das Ende des Rundschau-Jahrs besser einläuten als mit dem Science-Fiction-Jahrbuch von Heyne? Zumal es das Letzte seiner Art ist. Yep, schon länger erwartet, ist es jetzt also wirklich soweit: Heyne stellt den Traditionswälzer - Jahr für Jahr das fetteste Stück SF-Sekundärliteratur im deutschsprachigen Raum - ein. 1986 gestartet, blieb der Reihe damit ein rundes Jubiläum versagt. Leider; aber die Verhältnisse auf dem Buchmarkt haben sich seit dem SF-Boom der 80er eben geändert.
Die SF, das unbekannte Wesen
Eher bittersüß wirkt es daher, wenn Langzeit-Jahrbuchmitarbeiter Wolfgang Neuhaus im Essay-Teil des Buchs "Warum die Science Fiction immer noch das Brisanteste aller Genres ist" titelt. Überhaupt sind gleich mehrere Aufsätze hier der SF an sich gewidmet. Während sich Neuhaus dem Wesen des Genres im Sinne einer Definition anzunähern versucht (kein leichtes Unterfangen), greift sich Adam Roberts ("Twenty Trillion Leagues Under the Sea", "By Light Alone") das vielzitierte "Golden Age" der SF heraus.
Dabei geht der Kritiker, Kenner und Autor mit Vorliebe für ausgefallene Ideen von Tom Godwins nicht minder vielzitierter Kurzgeschichte "The Cold Equations" aus dem Jahr 1954 aus. Ist doch immer wieder interessant zu lesen, welche neuen Lösungen für das darin geschilderte Dilemma sich jemand einfallen hat lassen! Und so nebenbei findet Roberts zudem neue Worte für den immer wieder frappierenden Umstand, dass der SF-Film der SF-Literatur geistig jahrzehntelang hinterherhinkt. (Ob das der Grund ist, warum er im Gegensatz zu ihr nach wie vor boomt?)
Von Merkel zu Muad'Dib
Noch älter ist Murray Leinsters bzw. eigentlich William F. Jenkins' Erzählung "A Logic Named Joe". Die hat mittlerweile Berühmtheit erlangt, weil sie im Jahr 1946 Phänomene des Internetzeitalters erstaunlich zutreffend vorhersagte und damit unserer Gegenwart viel näher kam als Leinsters Zeitgenossen, die von riesigen Elektronenhirnen schrieben. Die Computerwissenschafter David L. Ferro und Eric G. Swedin nehmen die Erzählung als Beispiel für die Funktion von SF-Literatur als Zukunftsprognose: Heute ein weitestgehend verworfener Ansatz, in der Anfangszeit des Genres aber noch die dominante Vorstellung.
Politikwissenschafter Peter Seyferth schließlich steuert mit "Wo bleibt das Positive?" einen interessanten Beitrag über kritische Utopien (im Sinne Ursula K. Le Guins) respektive Dystopien bei. Und listet ein paar Beispiele von Hoffnungsvollem auf, die sich in der Übermacht der aktuellen Dystopie-Mode durchaus finden lassen. Applaus auch dafür, wie er eine Überleitung von Merkel zu Muad'Dib findet!
Raus aus dem Elfenbeinturm
Anders als in der oben genannten Sicht von SF als Prognose-Tool, die vor allem auf den visionären Elektronik-Bastelfex Hugo Gernsback zurückgeht, gilt die Science Fiction heute überwiegend als Genre, das die Probleme der Gegenwart thematisiert. Und sie muss auch nicht auf jede bange Frage sofort eine Antwort liefern - das zeigte die Conclusio von David Brins gewaltigem Roman "Existenz" sehr schön. Die Debatte an sich ist wichtig, so der Star-Autor, der seine Website im Anschluss an die Romanveröffentlichung als futurologische Diskussionsplattform nutzte und auch sonst jede Gelegenheit für einen Dialog zu Fragen der Zukunft ergriff.
In seinem sehr lesenswerten Jahrbuchbeitrag "Singularitäten und Albträume" setzt David Brin diesen Prozess fort. Ausgehend von Szenarien wie der allgemeinen Verfügbarkeit von Hochtechnologie - etwa in Form von Biolaboren oder Nanofabriken im Mac-Format - widmet er sich der Frage, ob die gesellschaftliche Entwicklung auf eine Singularität, den Untergang oder einen erzwungenen Technologiestopp zusteuert. Optimist und Demokrat, der er ist, kommt Brin zum Schluss, dass die menschliche Zivilisation letztlich nur durch Offenheit und wechselseitige Rechenschaft eine Zukunft haben kann.
Erfolgsgeschichten
Neben solchen Gesamtbetrachtungen des Genres bzw. der Welt enthält das Jahrbuch auch eine Reihe von Beiträgen zu einzelnen Phänomenen des SF-Universums. Etwa dem "Planet der Affen"-Franchise, dessen Entstehungsgeschichte Filmbusinessexperte David Hughes ("Tales from Development Hell") in spannender Weise protokolliert. Unter den Kelchen, die in diesem turbulenten Prozess an uns vorübergegangen sind, befand sich offenbar auch Oliver Stones Idee von im Kälteschlaf liegenden "vedischen Affen", die den geheimen Zahlencode der Bibel kennen. *erleichtertesaufatmen*
Sven-Eric Wehmeyer widmet sich den SF-Aspekten im Werk von Stephen King, Kai Jürgens wiederum klopft das Schaffen von Arno Schmidt auf Phantastik-Elemente ab. Der interessanteste Beitrag in diesem Block ist für mich aber "Der unschuldige Killer" von John Kessel, in dem der Literaturwissenschafter die zweifelhafte Moral von Orson Scott Cards Welterfolg "Ender's Game" seziert, welcher immerhin in einem schuldfreien Genozid gipfelt. Kessel argumentiert dabei ebenso rational wie nachvollziehbar. Und kommt zum Schluss, dass es zwar ein ganz natürlicher Teenager-Wunsch sei, sein Umfeld mit einer Atombombe auslöschen zu wollen ... dass sich das aber nicht unbedingt als Ausgangspunkt einer universalen Ethik eignet.
Den wissenschaftlichen Teil bestreitet einmal mehr Uwe Neuhold, auch wenn er sich auf ein einziges Thema - die Geschichte der Teleskopie - beschränken muss. Dafür ist Neuhold im Rezensionsteil stark vertreten - witzig etwa, wenn er sein Entsetzen darüber zum Ausdruck bringt, wie aus der vermeintlichen Traumpaarung Larry Niven und Gregory Benford ein Roman wie "Himmelsjäger" entspringen konnte. (Und inzwischen wissen wir ja leider, dass die nach der Rezension erschienene Fortsetzung "Sternenflüge" das auch nicht mehr rausreißen konnte.)
Noch zeitgemäß?
Und damit wären wir schon bei dem, was für viele LeserInnen stets der Hauptanreiz zum Kauf des Jahrbuchs war: die Rezensionen. Jeweils ein mehrköpfiges Team bespricht dabei auf 90 Seiten SF-Literatur, knapp 70 Seiten Comics, über 100 Seiten Filme (ich werde die genialen Bildunterschriften vermissen!), 35 Seiten Games und auf beachtlichen 50 Seiten Hörspiele. Immer noch sehr interessant zu lesen - auch wenn im Internetzeitalter an verfügbaren SF-Rezensionen natürlich anders als früher keinerlei Mangel herrscht.
Ist so ein Jahrbuch also ein ähnlich anachronistisches Konzept wie eine Wochenschau oder eine Weltausstellung? Aber nicht doch - und hier kommt die gute Nachricht: Das Jahrbuch wird auch weiterhin erscheinen, offenbar sogar mit formalen und personellen Kontinuitäten. Es wandert nur von Heyne zum Golkonda-Verlag: Eine gelungene Zepterübergabe, denn wer im deutschsprachigen Raum Hirn und Herz für Science Fiction sucht, wird kaum eine bessere Stelle finden als diese. And the quest continues.
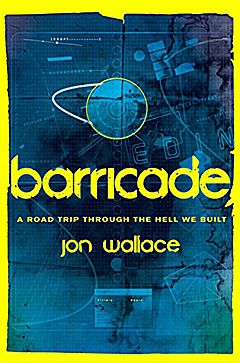
Jon Wallace: "Barricade"
Broschiert, 250 Seiten, Gollancz 2014
Es ist die alte Geschichte: Nachdem ein Krieg zwischen der Menschheit und den von ihr gezüchteten Kunstwesen die Erde verwüstet hat, haben sich die letzten Reste der Zivilisation in die Städte zurückgezogen und hinter gigantischen Mauern verbarrikadiert. Und da bleibt man besser auch, denn in der vergifteten, radioaktiven Wüste, die sich zwischen diesen befestigten Oasen erstreckt, lauern die wilden Horden derer, die nicht zur Gänze ausgemerzt werden konnten. An dieser Stelle sollte man vielleicht noch erwähnen, dass die wilden Horden in diesem Fall die Menschen sind.
Eine frische Stimme im Genre: Jon Wallace ist ein junger Autor aus England, der nach diversen Kurzgeschichtenveröffentlichungen mit "Barricade" seinen ersten Roman vorlegt. Und der ist ausgesprochen gelungen: Mit einer kräftigen Prise schwarzen Humors gewürzt und deshalb sehr unterhaltsam - obwohl es um nichts Geringeres als ein Holocaust-Szenario geht.
Die Ausgangslage
Aufgezogen wird die Handlung an einem klassischen Roadtrip: Kenstibec, in seinem jetzigen Leben Taxifahrer, soll die Reporterin Starvie von Edinburgh nach London kutschieren, zwei der besagten Barrikadenstädte. Und zwischen denen liegt eine lange Strecke dreckiges, düsteres, deprimierendes Ödland. Strahlung, giftige Chemikalien und Mikroben können den beiden zwar nichts ausmachen, gehören sie doch zu den Ficials: nanotechnologisch aufgemotzten Kunstmenschen, denen schon seeehr viel zustoßen muss, ehe sie sich nicht mehr regenerieren können.
Aber da sind ja noch die Reals, also die Letzten der verseuchten, vergifteten und verstrahlten echten Menschen. Die befinden sich zwar allesamt in unterschiedlichen Stadien des körperlichen Verfalls, setzen aber jede verfügbare Energie dafür ein, ihre Widersacher, die neben ihnen wie wandelnde Hochglanzannoncen aussehen, zu vernichten. Weshalb Kenstibecs "Taxi" auch eher so etwas wie ein schwer bewaffnetes Geländefahrzeug ist - allerdings ausdrücklich kein gepanzertes, wie man es aus Zombiefilmen kennt. Da legt der alte Profi Wert drauf, denn in einem Panzer kann man sehr leicht festgesetzt und abgemurkst werden (wenn der Gegner nur wie ein Zombie aussieht, sein Hirn aber noch tadellos funktioniert).
Kenstibec kurvt mit seiner Passagierin durch ein Albtraumland, kämpft gegen Reals, ist live bei der Belagerung der Barrikadenstadt York durch ein Real-Heer dabei, begegnet überraschend der Person, die die Ficials einst entwickelt hat, und erlebt in London schließlich eine noch größere Überraschung, wenn er feststellen muss, dass es Kräfte gibt, denen ein Genozid noch nicht genug war - machen wir doch gleich den nächsten. Unterstützung erhält Kenstibec auf seiner gefahrvollen Reise von einem Real, den er als kundigen Führer aufgabelt. "Fatty" nennen ihn die beiden Ficials mit der ihnen eigenen Einfühlsamkeit; sein Körper ist nämlich von einer Blue Frog genannten tödlichen Seuche aufgequollen. Seine Tage sind gezählt - aber für diesen Trip werden seine Kräfte schon noch reichen.
Gestern, heute und kein morgen
Die Gegenwartsebene erzählt Wallace parallel zu Rückblicken auf die Zeit, als alles noch (beinahe) in Ordnung war. Damals - es ist erst wenige Jahre her - sollten die innovativen Ficials Großbritannien zu neuer Blüte verhelfen. Kenstibec beispielsweise war ursprünglich Bauarbeiter. Das schlägt immer noch gelegentlich durch, wenn er mitten im unpassendsten Moment - zum Beispiel einem Massaker - architektonische Details begutachtet: Ein Anflug von "Psychologie" im Roman und dazu ein potenzieller Pointenlieferer. Allerdings hätte Wallace da noch mehr rausholen können. Ich nehme aber an, dass der Autor diese tendenziell nerdige Perspektive nicht forcieren wollte, weil die Attraktivität von Bautechnik doch ihre Grenzen hat.
Andere Ficials erledigten Sexarbeit oder - Achtung, zynischer Einschlag - ballerten die Flüchtlingsmassen nieder, die vom kriselnden Festlandeuropa ins immer noch ganz gut funktionierende Königreich flüchten wollten. Und dann gab es da noch Control, jene denkende und lenkende Entität, die die Ficials im Hintergrund kommandierte. Mit dem Auftrag, die Welt zu einem lebenswerteren Platz zu machen. Und die dennoch hauptverantwortlich dafür ist, dass der allergrößte Teil der britischen Bevölkerung getötet wurde (Wallace verwendet dafür das scheußliche Wort culling, das wir aus der Viehzucht kennen). Den Rest der Welt erledigten die "religiösen Irren unter ihrem Mormonenpräsidenten" von jenseits des Atlantiks, als sie auf die Aktion der Ficials mit ABC-Waffeneinsatz reagierten.
All das können wir uns nach den ersten Kapiteln schon recht gut zusammenreimen. Wie genau die Apokalypse aber abgelaufen ist, was hinter ihr steckt und warum Control auf der Gegenwartsebene verstummt ist - das wird sich parallel zu Kenstibecs Reise erst nach und nach zu einem äußerst makabren Bild zusammenfügen.
Humor der schwärzesten Sorte
Wer erinnert sich noch an die postapokalyptischen Kinder aus "Mad Max 3", die sich zum Geschichtenerzählen einen hölzernen "Fernseherrahmen" vors Gesicht hielten? Tja, die Glotze ist eine Kulturmacht - deswegen haben auch Wallaces Reals in ihren Elendsquartieren nichts Dringenderes zu tun, als überall möglichst schnell wieder lokale TV-Sender aufzubauen. Auf denen schauen sie sich dann Archivbilder von Überwachungskameras aus der guten alten Zeit an. Die Ficials halten dagegen und strahlen aus ihren Städten via Cull TV endlose Abfolgen von Massenvernichtung aus. Was unweigerlich die televisionäre Rüstungsspirale weiterdrehen lässt: Die Belagerung von York wird als schrilles TV-Spektakel inszeniert, dessen Details ich lieber nicht spoilern will. Aber nennen wir's ein "Wetten, dass ...?" für Fortgeschrittene.
Die besten Pointen liefert allerdings der Umstand, dass die perfekten Ficials doch einen Makel haben (auch wenn sie diesen nicht als solchen empfinden): Sie haben keine Gefühle. Was zu ganz neuen Umgangsformen führt: Als zu Beginn der Reise beispielsweise Starvie Kenstibec die Hucke vollquatscht, schlägt er sie kurzerhand bewusstlos - und sie nimmt ihm dies nach dem Aufwachen auch gar nicht sonderlich übel: "Did you hit me just then?" "Yes", I said, "but it was only to hurry things up. You were getting all introspective."
Darunter: der Abgrund
Mit Kenstibec haben wir einen Ich-Erzähler, dessen schlichtes Gemüt und fehlende Empathie der Geschichte einen ganz eigentümlichen und sehr originellen Ton verleihen. Seine Nonchalance, nicht zuletzt in Bezug auf Gewalt, verblüfft ebenso, wie sie immer wieder für Pointen sorgt. Doch kaum einen Schritt davon entfernt lauert stets der Horror. In einem der präapokalyptischen Rückblicke wird Kenstibec vom kleinen Sohn seines Besitzers gefragt, ob es den Ficials Spaß macht, Menschen zu töten. Kenstibec verneint wahrheitsgemäß. Doch im Stillen ergänzt er: The truth is, I don't want to kill him, but I don't want not to kill him either.
Diese einzigartige Perspektive ermöglicht es Wallace, sich einen ganzen Roman lang an der Grenze von Grauen und Humor entlangzutasten. Mit einem wirklich beachtlichen Erstlingswerk als Ergebnis. Wie gesagt, eine frische Stimme im Genre - und eine sehr willkommene.
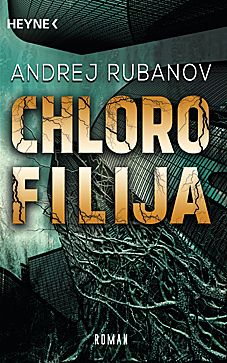
Andrej Rubanov: "Chlorofilija"
Broschiert, 428 Seiten, € 10,30, Heyne 2014 (Original: "Chlorofilija", 2009)
Es war großartig zu prosperieren. Es war wunderbar, morgens auszuschlafen und bis zum späten Abend zu florieren - und das jahrein, jahraus. Das Goldene Zeitalter kam ganz nebenbei, leicht und bezaubernd - keiner hatte es dem Volk nahebringen müssen, alles geschah von selbst. Wenn eine Gesellschaft derart im Glück schwelgt wie hier die russische in Andrej Rubanovs höchst originellem Roman "Chlorofilija" ... dann muss an der Sache einfach etwas faul sein. Das ist dem geübten SF-Leser von Anfang an klar - bis es der Hauptfigur dämmert, dauert's etwas länger.
Viel schöner hätte sich Putin die Zukunft auch nicht ausmalen können: Während Europa in Armut, Amerika in Fettsucht und sämtliche Küstengebiete der Welt im Meer versunken sind, steht Russland da wie eine Eins. Mit einer unschlagbaren Ressource in der Hinterhand, der der Klimawandel nichts anhaben konnte: Sibirien. Das wurde kurzerhand an China verpachtet, und das aus Peking anrollende Geld ermöglicht den Russen nie gekannten Luxus. Niemand muss mehr arbeiten gehen (außer er will unbedingt), alle erhalten freie Grundversorgung und reichlich Taschengeld aufs Konto. Und über der Moskauer Autobahn schwebt ein riesiges Hologramm, das die staatliche Ideologie des absoluten Wohlstands auf den Punkt bringt: "Du bist niemandem etwas schuldig." Es ist, wie es an einer Stelle heißt, eine russische Gesellschaft "im Vorruhestand".
Zu schön, um wahr zu sein
Wer sich die Mühe machen wollte, Fragen zu stellen, der hätte dazu natürlich jede Menge Gelegenheit. Etwa warum die stark geschrumpfte, aber immer noch 40 Millionen Menschen umfassende Bevölkerung Russlands ihr gesamtes Hinterland aufgegeben hat und sich nun in den Wolkenkratzern der Megalopolis Moskau zusammendrängelt. Oder warum die obersten Etagen dieser Wolkenkratzer ausschließlich Chinesen zugänglich sind. Oder ob man nicht vielleicht doch ein bisschen zu abhängig von den als Arbeitsbienen verlachten Chinesen geworden ist: Alles, wirklich alles, was man in Moskau verbraucht, hat der fleißige Nachbar produziert. Sogar der Rubel wird in China gedruckt. Und ist die beliebte TV-Sendung "Nachbarn" - eine Art Verschmelzung von Facebook und "Big Brother" - nicht genauso ein Instrument der Kontrolle wie die Mikrochips, die jedem Bürger implantiert wurden?
Im wahrsten Sinne des Wortes überschattet wird das alles jedoch von einer Moskauer Spezialität: Über Nacht sind dort vor ein paar Jahrzehnten die gigantischen Halme eines mysteriösen Gewächses aus dem Boden geschossen. 300 Meter hoch und unverwüstlich, nimmt dieses "Gras" den BewohnerInnen der unteren Etagen - folgerichtig die Blassen genannt - das Sonnenlicht. Dafür liefert es Fruchtfleisch, dessen Verzehr euphorisierende Wirkung hat: Die Blassen verschlingen es roh, die gebräunte Oberschicht destilliert daraus Pillen. Eine angeblich völlig nebenwirkungsfreie Wohlfühldroge frei Haus, wenn das nicht die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Nicht umsonst ist einer der Schauplätze des Romans das Café "Soma" ...
Der mühevolle Weg zum Licht
Als Hauptfigur von "Chlorofilija" fungiert Saweli Herz: Anfang 50 und Starreporter eines erfolgreichen Monatsmagazins, da stellt man sich automatisch einen mit allen Wassern gewaschenen sympathischen Bärbeiß vor, wie er in neueren russischen SF-Romanen so gerne das Zepter schwingt. Doch Saweli wirkt überraschend passiv. Selbst wenn er auf Recherche ist, fallen ihm Informationen eher ungewollt zu, als dass er gezielt danach bohrt. Und allzu viel scheint er mit den Hinweisen, die er von diversen Gesprächspartnern erhält, auch nicht anfangen zu können. Ein weiteres Indiz für tiefgehende Verdrängungsprozesse, die sich hier unter der Oberfläche abspielen.
Schon früh stellt man beim Lesen mit diebischem Vergnügen fest, dass sich die Moskauer eigentlich wie Pflanzen verhalten: Ihre ständige Gier nach (möglichst exklusiv abgefülltem) Wasser, der seltsame Höflichkeitskult, der sich darum entwickelt hat, dass man einem anderen nicht im Licht stehen darf, ihr Drang nach oben ... All das sind eigentlich bereits Indizien genug, doch Rubanov wird dies noch weiter treiben - bis zu einem Szenario, das durchaus an Eugène Ionescos "Die Nashörner" erinnert.
"Chlorofilija" ist ein sehr bildhafter Roman. Sei es die vertikale Hierarchie der Moskauer Gesellschaft oder ihre Abhängigkeit von den Riesenhalmen: Es ist eine vom Konsum betäubte Gesellschaft, die die ihr auferlegten Einschränkungen nicht erkennt und fröhlich auf den Abgrund zutanzt. Wie metaphorisch das "Gras" ist, zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass seine Herkunft viel diskutiert, aber nie geklärt wird: Es könnte außerirdischen Ursprungs sein. Oder, gemäß einer anderen im Roman geäußerten These, auch die Manifestation all dessen, was in Russland schiefgelaufen ist ... letztlich spielt das keine Rolle.
Empfehlung!
Während sich der Roman in der ersten Hälfte noch recht munter und kraftvoll gibt ("Wichtig ist es, ein Stück abzubeißen. Ob du es schlucken kannst oder nicht, ist ohne Bedeutung."), vergeht den ProtagonistInnen in der zweiten Hälfte mit den Illusionen auch das Lachen. - Und jetzt Achtung, hier kommt die Message: Erst am absoluten Tiefpunkt angelangt, ist es wieder möglich, sich auf das Wesentliche zu besinnen - also das, was den Menschen ausmacht. Wie bedeutungslos das bisherige Leben im Glück war, dafür findet Rubanov beispiellos deprimierende Worte: Goscha hat ein kleines Speicherwerk - nicht größer als eine Faust, eine Flashcard. Darauf ist alles gespeichert, was die Menschheit je ersonnen hat - sämtliche Musik, alle Filme, Reproduktionen aller Bilder, Bücher, Gedichte, philosophische Werke. Goscha trägt in seiner Tasche die Kultur der ganzen Welt, sie wiegt nichts.
Ein ausgesprochen gelungener Roman, mehr Strugatzki als Glukhovsky.

Leon Reiter: "Jetzt"
Broschiert, 365 Seiten, € 13,40, Piper 2014
Dieser Roman ist zwar eigentlich schon im Spätsommer erschienen, aber wie sich gezeigt hat, war es genau die richtige Zeit, "Jetzt" jetzt zu lesen: Denn in gewissem Sinne funktioniert das Zeitreise-Abenteuer des deutschen Autors Leon Reiter wie ein Adventskalender (mehr dazu später). Man beachte, dass trotz Thematik "Thriller" auf dem Einband steht. Der Trend hält also an, Science Fiction auf dem Buchmarkt als alles Mögliche zu tarnen - ganz im Gegensatz zum Fernsehen, wo einem der TV-Guide als "Sci-Fi" verkauft, was in Wirklichkeit Mystery oder sonstwas ist. Interessant, wie unterschiedlich die Vermarktbarkeit eines Begriffs in verschiedenen Sparten eingeschätzt wird; frage mich echt, woran das liegt.
Das Szenario
Zeitreisen also - oder genauer gesagt Löcher im Zeitgefüge. Die hat der rührige Professor Sanjay Sivamani versehentlich gerissen, nachdem er eine Methode entwickelt hatte, mit einem Laserstrahl andere Zeiten "auszuleuchten". Doch wie wir aus der Physik wissen, kann eine Messung durchaus zum aktiven Eingriff werden, und genau das ist hier passiert: Durch irgendein Missgeschick (wie genau, wird übrigens nie geklärt, fällt mir jetzt im Nachhinein erst auf) hat dieses Ausleuchten die Struktur der Zeit angeknackst. Rund um das Versuchszentrum in einer spanischen Kleinstadt bilden sich immer mehr sogenannte Pockets: de facto eine Art Portale in andere Zeitalter. Es steht zu befürchten, dass deren exponentielle Zunahme bald die ganze Welt überwuchern wird. "Das ist wie in dieser englischen Fernsehserie 'Primeval', wo Saurier durch solche Löcher in unsere Gegenwart schlüpfen!", meint eine der Romanfiguren nicht ganz unrichtig.
Um den Weltuntergang zu verhindern, stellt der Prof ein Viererteam von "ExpertInnen" zusammen, die die diversen Pockets bereisen sollen, bestehend aus: der Soziologin Veronique Saccard und der Historikerin Stefania Ambrosini wegen ihrer Kenntnisse anderer Kulturen, dem britischen Elitesoldaten Lyle Usher als Geleitschutz sowie dem nerdigen Studienabbrecher Ferdinand Greve. Der soll als Kartograf fungieren und den anderen bei der Orientierung helfen. Allerdings dürfte seine eigentliche Funktion im Roman darin bestehen, popkulturelle Verweise zum Thema Zeitreisen an den Mann zu bringen - auch die Anmerkung zu "Primeval" stammt natürlich von ihm.
Das alte Problem mit Zeitreisen
Die Mission der vier besteht darin, der Reihe nach die Pockets zu erkunden und eine aufzuspüren, die in die jüngste Vergangenheit führt, und dort den Professor von seinem verhängnisvollen Experiment abzuhalten, damit es gar nicht erst zu der ganzen Bredouille kommt. Womit wir schon mitten im Thema Zeitparadoxa wären, das im Roman vielfach angesprochen wird, wenn auch - wie eigentlich alles in "Jetzt" - in Form eines schnellen Drübersegelns. Reiter bzw. seine vier Figuren gehen recht unverkrampft mit dem Umstand um, dass man beim Thema Zeitreisen in Blitzesschnelle beim Unlogischen und Unmöglichen landet, wenn man die Sache weiterdenkt (weshalb die Zeitreise auch trotz häufiger Verwendung stets ein skeptisch beäugtes Stiefkind der SF war und immer bleiben wird).
Beispiele: Anders als bei "Primeval" kann nichts aus einer anderen Zeit in unsere Gegenwart vordringen. Warum? Ist halt so. Und ist auch recht praktisch, wenn auf der anderen Seite des Portals beispielsweise ein Ozean liegt - sonst würde ja das ganze Wasser herüberschwappen. Offen bleibt, wie die ProtagonistInnen dann bei ihrer Rückkehr nass sein können. Und was ist eigentlich mit der Luft, die sie "drüben" eingeatmet haben? Anderes Beispiel: Weil Raum und Zeit zusammenhängen, bedeutet jede zeitliche Versetzung zwangsläufig auch eine örtliche. Eigentlich müsste man dann dauernd im Weltraum landen - darüber diskutieren die Figuren von "Jetzt" auch offen. Aber irgendwie hängen die Pockets an der Erdoberfläche, ist halt so. Sie streuen örtlich ein bisschen, damit der Roman nicht nur Spanien im Lauf der Jahrmillionen zeigt - aber nur entlang des 40. Breitengrads. Warum? Wie gesagt ...
Das ist jetzt übrigens nicht mal Kritik an diesem konkreten Roman oder Autor - man muss bei diesem Thema einfach bereit sein, irgendwo eine Linie zu ziehen und zu sagen: Das akzeptiere ich jetzt und denke nicht weiter drüber nach, sonst fängt mir der Schädel an zu brummen. Veronique, Stefania, Lyle und Ferdi halten es genauso.
Roam around the world
Reiter lässt die vier im Eilzugstempo eine große Menge an Kurztrips absolvieren. Was die Originalität der aufgesuchten Schauplätze anbelangt: Wenn man eine Straßenbefragung oder ein kurzes Brainstorming à la "Was fällt Ihnen zum Thema Zeitreisen ein?" machte, würden die am häufigsten genannten Vorschläge vermutlich einen ähnlichen Mix ergeben, wie er Reiter eingefallen ist: Das Erdaltertum; eine hochtechnologische Zukunft plus eine weitere, die an "The Time Machine" erinnert; Pesttote im mittelalterlichen Italien, kämpfende Samurai und so weiter und so fort.
Gleichzeitig erzeugt das aber durchaus eine gewisse Spannung - oder vielleicht sollte man besser sagen: Vorfreude. Das ist das, was ich eingangs mit dem Adventskalendervergleich meinte: Vor jedem neuen Kapitel fragt man sich, was sich denn heute wohl wieder hinter dem Türchen befindet: Ein Mammut! Die spanische Armada! Ein Raumschiff! Ein angreifender Allosaurus ... upps, leider zu spät gesehen.
Das Tempo, in dem das alles abläuft, führt natürlich dazu, dass hier nicht gerade in die Tiefe gegangen wird. Passt aber irgendwie zu Reiters Stil, der - und das meine ich wiederum eindeutig positiv - gerafft und abgeschlankt gehalten ist. "Jetzt" dürfte das Buch sein, das ich heuer im Verhältnis zu seiner Seitenzahl am schnellsten gelesen habe.
Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe
Das Grundproblem an der ganzen Mission - und auch dessen sind sich die ProtagonistInnen bewusst - ist natürlich die äußerst geringe Wahrscheinlichkeit, unter den etwa 4,5 Milliarden (für die Erdjahre) mal X möglichen Varianten eine geeignete zu erwischen (X steht für diverse Faktoren, die erschwerend dazukommen, z.B. das richtige Jahr zu treffen, aber leider ein paar Monate in der Zukunft statt der Vergangenheit). Und das alles auch noch in einem engen Zeitrahmen, weil die Pockets immer mehr werden. "Wir suchen einen einzigen Grashalm auf einer riesigen Wiese, und diese Wiese wimmelt von Monstern!", bringt es Veronique auf den Punkt.
Die Zweifel an einem erfolgreichen Ausgang der Mission wachsen im Verlauf des Romans sowohl beim Leser als auch bei den Figuren. Umso spannender die Frage, wie der Roman enden wird. Ein bisschen unbefriedigend für meinen Geschmack, muss ich leider sagen. Aber jeder urteile selbst.
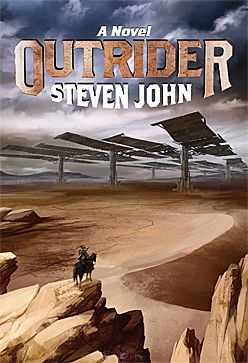
Steven John: "Outrider"
Broschiert, 285 Seiten, Night Shade Books 2014
Manchmal kaufe ich mir ein Buch einfach nur, weil die Prämisse originell klingt. In diesem Fall: Cowboys und Sonnenenergie! Schießereien unter gigantischen Solarpaneelen! - In vielen Fällen entpuppen sich solche Romane dann als recht einfach gestrickte Erzählungen, die all ihr Pulver bereits in der Prämisse verschossen und danach nichts Überraschendes mehr zu bieten haben. Und zunächst sah auch "Outrider", zweiter Roman des US-Amerikaners Steven John, ganz danach aus. Aber dann schlägt die Geschichte - ohne dabei jemals ihre schlichte Machart aufzugeben - doch die eine oder andere unerwartete Richtung ein. Am Schluss war ich ein wenig konsterniert, aber auf eine positive Art.
Das Szenario
Zur Ausgangslage: In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird das Großstadtkonglomerat von New Las Vegas durch ein gigantisches Solarfeld in der Wüste mit Energie versorgt. Die tausend Quadratmeilen große Anlage aus quantum voltaic pillars erzeugt ein derart starkes elektromagnetisches Feld, dass in ihrer Nähe sämtliche moderne Technik durchbrennt. Das schlucken wir jetzt einfach mal - denn nur so können die Outriders ins Spiel kommen: Berittene und mit Schusswaffen wie im Wilden Westen ausgestattete Wächter, die die Anlage vor leeches (wörtlich "Egeln") schützen. Das sind in aller Regel einfache, verarmte Menschen, die ein bisschen Strom aus der Anlage für sich oder zum Weiterverkauf abzapfen.
An diesem Detail können wir bereits erahnen, dass hier einige soziale Konfliktlinien unter der Oberfläche schlummern - egal wie schön New Las Vegas in Gernsback'schem Technikglanz schimmert. (Wobei Steven John die Beschreibung der Stadt recht vage belässt - bei Allgemeinplätzen, könnte man fast sagen.) Anderes Beispiel: Die Putzfrau im zentralen Verwaltungsgebäude ist nicht nur bereits im Greisinnenalter, sie muss während der Arbeit auch ihren Infusionsständer hinter sich herziehen. Das klingt nicht unbedingt nach utopischen gesellschaftlichen Verhältnissen. Aber Achtung: Die arme alte Dame wird uns noch überraschen - und da ist sie in diesem Roman nicht die einzige.
Großes Ensemble
Die Hauptpersonen des Romans sind Vertreter des Systems - und an dessen Spitze steht Franklin Dreg, der Bürgermeister von New Las Vegas mit Hang zu grandiosen Auftritten und Skrupellosigkeit. Für Dreg ist es beinahe eine lustvolle Erfahrung, Entscheidungen zu treffen - also auf den metaphorischen roten Knopf zu drücken oder im Brustton der Überzeugung "Ja!" bzw. "Nein!" zu donnern. Die Details hinter der Entscheidung interessieren ihn weniger. Dafür hat er ja seinen Assistenten Timothy Hale, der den Laden in Wirklichkeit am Laufen hält. Hale mag wie eine graue Maus wirken, aber er ist überaus kompetent. Und dass er mal eher subversiv eingestellt war, ehe er sich ins System fügte, kommt dann wieder an die Oberfläche, als sich Gefahr für die Stadt abzeichnet: Hale beschließt nämlich Dreg zu übergehen und selbst aktiv zu werden.
Als eigentliche Hauptfigur und eindeutigen Sympathieträger bietet uns Steven John aber den Outrider Scofield (andere Namenshälfte unbekannt) an: Einen typischen Loner, der geradezu gekidnappt werden muss, um endlich auch mal mit den anderen Outridern einen trinken zu gehen - doch jeder mag ihn oder respektiert ihn zumindest. Scofield sieht sich selbst allerdings keineswegs so positiv. Hier seine bezeichnende Antwort auf ein Kompliment: "You're a good man." - "No, I ain't. I'm just not a bad man." Stets das Richtige tuend und dennoch fortwährend mit sich selbst hadernd - irgendwie hatte ich bei Scofield Daryl aus "The Walking Dead" vor Augen.
Unerwartete Wendungen
Zu diesen dreien kommt dann noch eine ganze Reihe anderer Figuren. Doch während sich in Romanen normalerweise aus einem anfänglich noch nicht einschätzbaren Ensemble so nach und nach die eigentlichen Hauptfiguren herausschälen, ist es in "Outrider" fast schon umgekehrt. Immer wieder kommen neue Figuren zu Stimme und geben Einsicht in ihr Innenleben, während bereits etablierte ProtagonistInnen wieder für einige Zeit abtauchen. Das kann so weit gehen, dass die eine oder andere Figur im Off zu Tode kommt und man sich fragt: Wann ist das denn passiert?
Schwer zu sagen, ob es sich dabei um Absicht oder eine erzählerische Schwäche des Autors handelt. Auf jeden Fall ist es ein Fehler, wenn wir mitten im Point-of-View-Kapitel einer Figur kurz in den Kopf einer anderen zappen; das geht selbst bei einer Erzählung in dritter Person nicht. Andererseits vermag John mit seiner unvorhersagbaren Erzählweise immer wieder zu überraschen. Ursprünglich hatte ich noch notiert: "Schon kurz nach dem Erstauftritt weiß man, wie jede Figur tickt." Aber das sollte sich zumindest teilweise als Irrtum herausstellen.
Ende einer Lebensweise
Letztlich spiegelt sich darin auch das eigentliche Thema des Romans wider: Zweifel und Loyalitätskonflikte, die nicht nur die ProtagonistInnen, sondern auch uns mehrfach dazu zwingen, das zu hinterfragen, was uns eben noch klar erschien. Dies wird am zentralen Ereignis des Romans manifest: Drainers greifen das Solarfeld an - und die zapfen nicht einfach nur ein bisschen Strom ab wie herkömmliche leeches. Die legen ganze Anlagen lahm, wie man von früheren Attacken aus anderen Ländern weiß. Doch die angeblichen Terroristen haben ihre Gründe, wie wir sehen werden. Ausreichende Gründe, um ganze Städte ins Chaos zu stürzen und Morde zu begehen? Das wiederum muss jeder für sich entscheiden.
Wenn die Auseinandersetzung in einer gewaltigen Schießerei unter den Solarpfeilern kulminiert, geht darin die einfach gestrickte Welt der Outrider mit ihren klar umrissenen Aufgaben und Schwarz-Weiß-Vorstellungen von Gut und Böse unter. Und wiederholt damit, was der Welt der Cowboys, denen die Outrider nachempfunden sind, schon vor langer Zeit widerfahren ist. Die Wildwest-Anleihe, die doch nur eine plakative Plot-Idee zu sein schien, bekommt damit nachträglich eine poetische Berechtigung.
Im Zweifel für den Autor
John verfällt gerne in eine Art Drehbuchstil. Er beschreibt Personen oder Vorgänge anhand ihres optischen Eindrucks und ihrer Position im Raum - ganz so, wie eine Kamera es zeigen würde. Das klingt nach schlichter Machart. Wie es auch das lückenhafte Worldbuilding tut: Wir lesen kaum etwas von neuen Technologien oder anderen Elementen, die diese Zukunftswelt von unserer Gegenwart unterscheiden würden (das exotischste Element des Romans - neben dem Solarfeld selbst - ist der Umstand, dass hier alle rauchen). Aber hat John darauf vergessen, seine Welt zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen, oder war es ihm einfach nur nicht wichtig? "Outrider" ist ein Roman des ständigen Zweifelns.
Ich habe mir selten so schwer getan, einzuschätzen, ob eine Erzählung fehlerhaft oder extra gewitzt ist. Oder auch beides zugleich. Auf jeden Fall kann ich aber sagen, dass mir "Outrider", das ich vorab als pulpige Nebensächlichkeit eingeschätzt hatte, überraschend gut gefallen hat. Und dass ich sehr gerne eine Fortsetzung lesen würde.
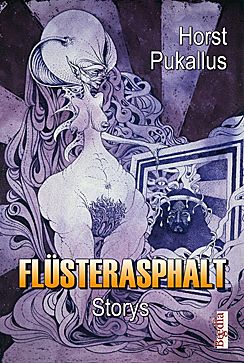
Horst Pukallus: "Flüsterasphalt"
Broschiert, 207 Seiten, € 13,90, Begedia 2014
Achtung! Wer dieses kleine Büchlein aufschlägt, darf sich darauf gefasst machen, von einem wahren Mahlstrom mitgerissen zu werden - sowohl stilistischer Art als auch was die Detailfülle anbelangt. Unglaublich dichtgepackt kommen diese Geschichten daher, sieben an der Zahl, die der deutsche Autor Horst Pukallus in den Jahren 2001 bis 2013 geschrieben hat. Pukallus darf man wohl als Gründungsmitglied der modernen deutschsprachigen Science Fiction bezeichnen; einen Angehörigen der "neuen Welle", die sich in den 70er und frühen 80er Jahren etablierte. Und selbst wer von Pukallus noch nichts gelesen hat, hatte mit ziemlicher Sicherheit schon eine seiner Übersetzungen in der Hand; z.B. einen Roman von John Brunner.
Michael K. Iwoleit ("Die letzten Tage der Ewigkeit") zitiert im Nachwort von "Flüsterasphalt" den Autor, der sein Werk den Unbeugsamen gewidmet habe. Was, wie dieser unbedingt lesenswerte Storyband zeigt, eine durchaus zweischneidige Angelegenheit sein kann. Mal sehen, da hätten wir: Zwei Mörder, einen Massenmörder und einen, der im Nachhinein einen Massenmord zu rechtfertigen hat, eine Figur, die aus niedrigsten Motiven die Gesellschaft zum Schlechteren verändert, und eine, die sich auf Kosten anderer bereichert. Letzteres wiegt - trotz der enormen Höhe der zweckentfremdeten Mittel - mit Abstand am leichtesten. Dafür pflegt diese spezielle Figur eine Weltsicht, bei der's einen im Halse würgt. Womit sie allerdings nicht allein steht: Fast alle ProtagonistInnen hier sind bemerkenswert anmaßend und dazu noch völlig skrupellos in der Umsetzung ihrer Ideen.
Ohne Rücksicht auf Verluste
Nehmen wir zum Beispiel den ehemaligen Verwaltungsbeamten Marten in "Die Ära der brennenden Berge". Die Erde ist in eine kosmische Wolke geraten, die sämtliche elektromagnetische Technologie dauerhaft zum Erliegen gebracht hat. Während ringsherum die Gesellschaft in kleine Einheiten zerfällt, sitzt Marten verschmitzt in seinem Schrebergarten, nachdem er einen Plan ausbaldowert hat, wie sich aus der Katastrophe Kapital schlagen lässt. Dieser Plan wird sich, als er uns endlich enthüllt wird, als ziemlich grotesk entpuppen - aber das hindert Marten nicht daran, etwaige Hindernisse in Menschenform aus dem Weg zu räumen.
Oder die Ministerin in "Letzte Trendansage", die ein neues Überwachungssystem installieren lässt und dessen erste "Erfolge" von einer Hightech-Limousine aus verfolgt, die in Sachen Special Effects nur noch von der ministerlichen Funktionsunterwäsche übertroffen wird. (Was skurrile Einfälle anbelangt, ähnelt Pukallus Uwe Post.) Die Politikerin ist mit sich selbst ebenso wenig im Reinen wie der Amokläufer, der in der beklemmenden Kurzgeschichte "Placebo" im Sterben liegt und feststellen muss, dass ihm seine Untat nichts bedeutet hat. Das unterscheidet die beiden zwar von Marten - allerdings ändert das für ihre Opfer rein gar nichts.
Als wär's ein Löschposting auf derStandard.at
Keinerlei Zweifel plagen hingegen die jeweiligen Erzählerinnen von "Tango Is a Virus" und der Titelgeschichte "Flüsterasphalt". Letztere verfügt über die Superkraft, Datenströme belauschen zu können, kommt dadurch Verbrechen auf die Schliche und rückt mit ihren anschließenden Whistleblower-Anrufen die Weltpolitik ins Lot. Was wunderschön auf den Punkt bringt, wie sich der kleine Maxi so seine Machtphantasien ausmalt. Die Hauptfigur der Geschichte tut zwar unbestreitbar Gutes. Aber wie sie es tut. Hier ein Auszug aus ihrer Gedankenwelt: Da die berlusconisierte postdemokratische Gesellschaft nur ein Selbstbefriedigungsladen ölgötziger Politroboter und barbarisch-narzißtischer Wirtschaftskrimineller ist, wird die Bespitzelung der ökonomisch überflüssig gewordenen und unter den Generalverdacht der Renitenz gestellten Bevölkerung zur Staatsräson. Orwells "1984" ist längst zum Kinderkram geworden.
Das klingt so bekannt! Kein Wunder: Mann, das liest sich exakt wie der zum Glück kleine Anteil monomanischer, alles durchschauender und alle verachtender, allein im Besitz der Wahrheit befindlicher, selbstherrlich-missionarischer, bombastische Worthülsen produzierender und simplifizierten Verschwörungstheorien anhängender Posting-Paranoiker, die aus dem Posting-Gesamtaufkommen auf unserer Website vermutlich nie rauszukriegen sein werden. Man könnte meinen, Horst Pukallus hätte mal bei uns in der Forenwartung mitgearbeitet, so gut bringt er den Ton auf den Punkt.
Und die Soziologin Alix, Hauptfigur von "Tango Is a Virus" und ebenfalls mit einem hermetischen Weltbild gesegnet, lässt exakt die gleichen Tiraden ab. Neben eigener Profilierung und Bereicherung erreicht sie aber wenigstens für ein paar Menschen Positives - und das in nicht gerade alltäglicher Weise: Sie funktioniert nämlich eine Weltraumstation zum Therapiezentrum um und lässt dort ein halbes Dutzend Sexualmörder mit künstlichen Mech-Görls Tango tanzen. Was anfangs noch wie pure Folter wirkt, erhält am Ende ironischerweise einen geradezu heroischen Einschlag.
Raum für Zweifel
Deutlich sympathischer kommt da schon in "Betender Lauch" - der einzigen Fernzukunftsgeschichte in diesem Band - ein Politiker rüber, der eine Besucherin von außerhalb empfängt und durch ihre bohrenden Fragen in einen gehörigen seelischen Zwiespalt gerät. Denn in der Siedlungsgeschichte seiner Welt schlummert ein dunkles Geheimnis. In dieser Erzählung fällt der bemerkenswerte Satz "Es gibt nicht nur eine alleinige Antwort" ... das könnte sich so manche Figur in den übrigen Geschichten hinter die Ohren schreiben. Ähnlich bemerkenswert sind allerdings Sätze, in denen Pukallus die SF-typische Vorliebe für pseudotechnische Begriffe zum satirischen Overkill weitertreibt: Durch den Protonenvibrationseffekt entstand eine Kompaktifizierung der Twistoren in die vertrauten vier Dimensionen des Universums. Die dabei erzeugte interdimensionale gravitodynamische Vakuumenergie konnte Raumschiffe durch Abkürzungen der Raumzeitunion "schleudern".
Last but not least sei noch die verhinderte Liebesgeschichte "Schatten ohne Lächeln" genannt. Broder und Heliane sind zwei an den Anforderungen ihrer Welt gescheiterte Menschen und klammern sich in ihrer gefühlten Unzulänglichkeit an dem fest, was ihnen geblieben ist: Er an seinem Beruf (in dem es übrigens um die Entwicklung essbarer Informationen geht!), obwohl ihm dieser reihenweise psychosomatische Beschwerden bereitet. Und sie am Glauben im Rahmen einer Online-Kirche. Die Annäherung der beiden steht trotz knisternder körperlicher Anziehung von Anfang an unter keinem guten Stern. Wie gering ihre soziale Kompetenz ist, zeigt das tragikomische Detail, dass sie zunächst glauben, ohne E-Mail-Adressen keinen Kontakt zueinander knüpfen zu können ... obwohl sie Wohnungsnachbarn sind. Soweit ist es noch rührend - auch hier wird aber wieder ein festes Weltbild verheerend dazwischenfunken.
Iwoleit stellt Pukallus in die Tradition der New Wave, also der in den späten 60ern aufgekommenen Variante von Science Fiction, in der statt Technikseligkeit psychologische und politische Aspekte im Vordergrund stehen. "Schatten ohne Lächeln" zeigt dies besonders gut: Es ist weniger Zukunftsentwurf als Kritik an einer Gegenwart, in der alles ein Stück schneller, kommerzieller und unmenschlicher abläuft, als es einmal war. Oder zumindest so empfunden wird. Ausgezeichnete Lektüre - sorgt für langes Nachglühen im Kopf.

Oliver Henkel: "Wechselwelten" und "Kaisertag"
Broschiert, 162 bzw. 368 Seiten, € 12,30, bzw. 15,40, jeweils Atlantis 2014
Oliver Henkel hat offenbar seine Nische gefunden: nämlich Alternativweltgeschichten mit Deutschland-Bezug. Nach seiner sehr unterhaltsamen "Fackeln im Sturm"-Variante "Die Fahrt des Leviathan" kehrt er im Storyband "Wechselwelten" noch zweimal zum fiktiven Schauplatz "Preußisch-Karolina" zurück, einer kaiserlichen Kolonie im Südosten der USA mit recht multikultureller Anmutung.
In "Mr. Lincoln fährt nach Friedrichsburg" treffen wir sogar einen der "Leviathan"-Protagonisten wieder, den afropreußischen Offizier Wilhelm Pfeyfer. Hauptfigur der Erzählung ist aber Abraham Lincoln - noch Anwalt und nicht Präsident -, der zu Hilfe gerufen wird, weil sich die Plantagenbesitzer aus den benachbarten Südstaaten einen neuen Trick ausgedacht haben, ihre nach Karolina geflüchteten Sklaven zurückzuholen. In "Do you speak English?" wiederum schwebt Adolf Hitler 1929 auf Wahlkampftour in der Kolonie ein. Und lässt angesichts der dortigen Verhältnisse sofort Verschwörungstheorien über "die hinterhältigen Söhne Israels, die die negroiden Untermenschen zu ihrem Muskel im Kampf gegen die arische Rasse machen wollen" vom Stapel. Wieviel Eindruck er damit hinterlässt, wird aber davon abhängen, was sein Englisch-Übersetzer aus dem Gegeifer macht.
Die Deutschlandbezüge können nah an der Gegenwart sein - in "Ein neunter Oktober" etwa münden die Leipziger Montagsdemonstrationen nicht in das Ende des DDR-Regimes, sondern in ein Tian’anmen-artiges Massaker. Oder auch verblüffend weit hergeholt: In "Der Adler ist gelandet" hat die spanische Königin Christoph Kolumbus zu lange im Wartezimmer schmoren lassen. Er kommt mit einem deutschen Kaufmann ins Gespräch und segelt schließlich mit Unterstützung der Hanse nach Amerika (bzw. "Indien").
Jenseits von Deutschland
Drei der acht Kurzgeschichten in "Wechselwelten" haben mit Deutschland dann aber doch nichts zu tun, sondern führen uns in die Antike zurück: So diskutieren in "Aus den Symposien des Nikandros von Athen. Dialog XIV, auch bekannt als 'Zweites Gastmahl des Sophronios'" zwei Historiker einer Parallelwelt die Möglichkeit, dass Alexander der Große auch jung hätte sterben können ... statt nach Westen zu ziehen und Rom und Karthago anzugreifen. (Allerdings ist mir nicht klar geworden, was die Aussage dahinter sein soll: Dass Alexander immer ein Großer geworden wäre, weil es in seiner Natur lag?)
In "... auf dass er die Menschen erlöse" macht ein reumütiger Judas Jesus und damit womöglich dem ganzen angehenden Christentum einen Strich durch die Rechnung. Und "Die Unsterblichkeit des Harold Strait" schließlich verknüpft Alternativwelt- und Zeitreisethematik: Um eine Frau zu beeindrucken, fasst Zeitreise-Student Harold den ziemlich vertrottelten Plan, eines der sieben Weltwunder zu zerstören. Wie könnte man Frauenherzen auch besser zum Schmelzen bringen!
Die Sache mit der Kürze
Alternativweltgeschichten der klassischen Art (und das sind die von Henkel) wird gerne mal angekreidet, dass sie nichts anderes seien als ausformulierte Fassungen eines "Was wäre, wenn?"-Gedankens. Mich persönlich stört das nicht, aber ich kann es verstehen, wenn ein Leser gerne mehr hätte. Und zugegeben, ein paar der Geschichten hier hängen ein bisschen in der Luft - man fragt sich unwillkürlich: Na schön, und welche Auswirkungen wird das nun haben?
Das ist aber auch der Kürze geschuldet - denn Henkel ist eindeutig ein Autor, der Raum zum Erzählen braucht. Außer er schreibt gleich Flash-Fiction und wird durch die extreme Verdichtung gezwungen, von seinem normalerweise straighten Erzählkurs auf eine andere Form umzuschwenken. Mein Lieblingstext in "Wechselwelten" ist denn auch "Kalifornia Dreaming", ein - man höre und staune! - Fanbrief von Joseph Goebbels an Walt Disney (verfasst im Jahr 1955), in dem er sich für seinen wunderbaren Besuch in Disneyland bedankt und anregt, etwas Ähnliches in Deutschland aufzuziehen. Das ästhetische Ergebnis dieser Kooperation darf man sich dann vermutlich so ähnlich wie das Rammstein-Video zu "Sonne" vorstellen.
Geronnene Zeit
Aber wie gesagt: Je länger, desto besser wird Henkel. Das deutet bereits "Mr. Lincoln fährt nach Friedrichsburg" an. Und der ebenfalls heuer erschienene Roman "Kaisertag" beweist es einmal mehr. Der zugleich Henkels Beitrag zum Gedenkjahr über die vielzitierte "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" ist. Nur dass der Erste Weltkrieg hier nie stattgefunden hat: Franz Ferdinand ist dem Attentat in Sarajewo knapp entgangen. Es gab keine Kriegserklärung, keinen Domino-Effekt und auch keinen Sturz der adeligen Herrscherhäuser. Alles ist beim Alten geblieben.
... und zwar in verdächtiger Weise. Zur Handlungszeit schreiben wir das Jahr 1988, doch es scheint, als wäre der Fluss der Zeit zu Gelee geronnen. Ein paar neue Erfindungen - Funk, Zellophan und auch die erste Atombombe - hat es gegeben. Ansonsten aber ist Deutschland immer noch ein Land der Luftschiffe, Pickelhauben, Schuluniformen und geschürzten Dienstmädchen. Und der Rest der Welt hat sich auch nicht weiterentwickelt. Das mag zunächst wie ein Willkürszenario des Autors wirken, doch Henkel hat Erklärungen parat.
Der Plot
Aber noch sind wir nicht so weit. Erst einmal reisen wir mit dem Hamburger Privatdetektiv Friedrich Prieß nach Lübeck. Der geht dort nicht nur der Frage nach, ob der angebliche Suizid eines hochrangigen Offiziers nicht vielleicht doch ein Mord war. Er muss dort auch noch mit der örtlichen Polizeichefin Alexandra Dühring zusammenarbeiten ... mit der er mal verlobt war. Eine Frau auf einem derart hohen Posten ist im immer-noch-wilhelminischen Deutschland eine absolute Besonderheit. Aber Alexandra - die es wie die Pest hasst, süffisant als "Fräulein Polizeipräsidentin" bezeichnet zu werden - ist ein Ausbund an Kompetenz. Zum Glück, denn der Fall entwickelt ungeahnte Dimensionen.
Wie weit die Verschwörung reicht, in die der tote Offizier verwickelt war, wird sich erst in der zweiten Hälfte des Romans abzeichnen. Dann werden wir aber auch erst die Indizien bemerken, die Henkel von Anfang an unauffällig ausgestreut hatte. Nichts könnte besser illustrieren, dass Henkel eindeutig ein Autor des Langformats ist, als der Umstand, wie nebensächlich erscheinende Motive hier nachträglich Bedeutung erlangen und sich schließlich zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Einem hässlichen, hässlichen großen Ganzen.
Nimm's mit Humor
Für humoristische Auflockerung des Spannungsplots sorgen Cameos prominenter Persönlichkeiten, die hier dank veränderter Umstände in neuen Rollen auftauchen, von Erwin Rommel über Loriot bis zu Elvis. Am schönsten finde ich persönlich "Stefan Remmler und sein Jive-Terzett".
Bei der besten Pointe des Romans bin ich mir allerdings immer noch nicht sicher, ob es sich um eine unfreiwillige oder um Selbstironie Henkels handelt: Nämlich wenn Prieß einmal räsoniert, welch unsicherer Verbündeter der Zufall doch sei. Und das bei Henkel, in dessen Geschichten der Zufall oft genug eine entscheidende Rolle spielt! Das war im "Leviathan" so, das ist in einigen "Wechselwelten"-Geschichten der Fall - und auch in "Kaisertag" steckt Kommissar Zufall als Ermittler Friedrich und Alexandra locker zusammen in die Tasche. Was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tut: Wieder einmal ein schönes Schmökererlebnis.
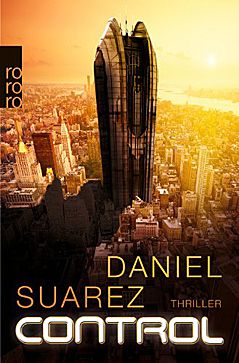
Daniel Suarez: "Control"
Broschiert, 496 Seiten, € 13,40, rororo 2014 (Original: "Influx", 2014)
Dass die Leute immer gleich so übertreiben müssen! Der im Sommer verstorbene FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher - der Science Fiction insgesamt keineswegs abgeneigt - ist auf dem Cover von "Control" mit einem Blurb verewigt, in dem US-Autor Daniel Suarez als "Jules Verne des digitalen Zeitalters" gepriesen wird. Naja. Bei aller Liebe, nach der Lektüre seines vorherigen Romans "Kill Decision" wage ich zu bezweifeln, dass Suarez viel nachhaltiger in die Geschichte eingehen wird als Jules Vernes Frühstücksgewohnheiten. Da erscheint mir "Ein würdiger Nachfolger für Michael Crichton" (Publishers Weekly) doch angemessener. Aber reden wir in 100 Jahren noch mal drüber.
Völlig losgelöst
Langweilig ist "Control" jedenfalls nicht, soviel kann ich immerhin sagen. Das verdanken wir dem jungen Physiker Jon Grady, der abseits der etablierten Forschergemeinde den größten Durchbruch seit Nutzbarmachung der Elektrizität geschafft hat: Er nennt seine Erfindung den Gravitationsspiegel - de facto dürfen wir es uns als künstliche Schwerkraft vorstellen, die beliebig gesteuert werden kann. Das wird noch für die tollsten Effekte sorgen. Und hat mich streckenweise an ein großartiges Comic aus der Feder des genialen Disney-Zeichners Don Rosa erinnert: Nämlich "A Matter of Some Gravity", in dem die Hexe Gundel Gaukeley Onkel Dagobert und seine Neffen mit einem Zauberspruch belegt, durch den sie die Schwerkraft nicht nach unten, sondern zur Seite zieht. Mit Konsequenzen, über die ich seinerzeit Tränen gelacht habe.
An Knalligkeit steht Suarez Rosa in nichts nach, allerdings geht er das Thema etwas ernsthafter an. Denn Jon kann seinen Erfolg nicht lange feiern, da wird er schon mitsamt seinem Team von vermeintlichen Terroristen hopsgenommen. Anstatt ihn, wie in ihrer Botschaft an die Öffentlichkeit angekündigt, zu liquidieren, täuschen sie seinen Tod aber nur vor. In Wirklichkeit ist Jon nämlich von der Bundesbehörde für Technologiekontrolle (BTC) gefangengenommen worden, die brisante wissenschaftliche Durchbrüche unterdrückt und Jons Erfindung als unerwünschtes "Sprungereignis der Kategorie 1" wertet. Vom autoritären Graham Hedrick geleitet, hat sich die BTC längst zum Staat im Staate entwickelt und verteidigt ihre Macht mit ... nun, nicht mit Zähnen und Klauen, sondern mit einem riesigen Arsenal sciencefictionesker Technologien, die sie deren armen Erfindern abgeknöpft hat.
Seitenbemerkung: Wieder einmal haben wir es mit einem US-Autor zu tun, der eine US-Behörde für die ganze Welt zuständig sein lässt (zwei später eingeführte Organisationen in Russland und Asien zählen nicht, das sind bloß rebellische Ableger der BTC) - und zwar ohne staatliche Hoheitsrechte zu thematisieren. Stattdessen liefern sich verschiedene - "gute" und "böse" - US-amerikanische Institutionen einen Kampf, dessen Ausgang das Schicksal der restlichen Welt halt irgendwie mitentscheidet.
Im Gefangenen-Dilemma
Aber zurück zu Jon: Vor die Wahl zwischen Kooperation und Gefangenschaft gestellt, entscheidet er sich für Letzteres. Und landet in Hibernity, einem Hightech-Komplex, in dem er in krassester Weise auf seine biologische Existenz reduziert wird. In einer sterilen Zelle in Einzelhaft gehalten, wird er von einer Quanten-KI (noch so eine der Welt vorenthaltene Erfindung) jeder menschlichen Würde beraubt und wie ein Versuchstier misshandelt.
Wenn Jon um den Erhalt seines Ichs ringt, fühlt man sich wie in eine modernisierte Version von "Nummer 6" oder eine besonders perfide Episode der "Twilight Zone" versetzt. Es sind dies die stärksten Passagen des ganzen Romans - stärker noch als der finale Showdown in der Schwerelosigkeit, wie man in der Form zugegebenermaßen noch keinen gelesen hat. Da kann man sich bei 20th Century Fox, das die Filmrechte zu "Control" gekauft hat, schon jetzt die Hände reiben.
Natürlich wird Jon allen Umständen zum Trotz die Flucht gelingen. Von da an ist es der klassische Thriller-Wettlauf gegen die Zeit: Es gilt die Pläne des Oberschurken zu durchkreuzen und Verbündete für den Entscheidungskampf zu gewinnen. Vielleicht die FBI-Agentin Denise Davis, die Jons "Ermordung" untersucht. Vielleicht aber auch Alexa, Hedricks künstlich gezüchtete Assistentin, die über allerlei besondere Kräfte verfügt (Supersexiness an erster Stelle). Und natürlich steht ständig die Frage im Raum, wem man trauen kann.
Technologie, von Magie kaum zu unterscheiden
In den ersten Kapiteln des Romans lässt Suarez ein paar physikalische und biochemische Passagen vom Stapel, dass einem die Ohren schlackern und man denkt: Hui, jetzt hat er aber ein neues Anspruchslevel erklommen. Später werden sich diese aber eher als Nebelkerzen entpuppen. Denn wenn der Renne-Rette-Flüchte-Plot erst mal richtig in die Gänge gekommen ist, tobt Suarez seinen Hang zum Plakativen wieder ungehemmt aus. Mittels Nano- und Quantentechnologie fliegen die Romanfiguren wie Superhelden durch die Lüfte und ballern dabei mit Positronenpistolen herum. Erinnert ein bisschen an Patrick Lees "Die Pforte". Und spätestens in der Passage, in der die Finsterlinge einen Kettengolem von der Leine lassen, fehlt wirklich nur noch der begleitende Zauberspruch aus Hogwarts.
Schlicht ist im Grunde auch der Plot dieser Mischung aus Verschwörungsparanoia und Wer-hat-mir-meine-Flugautozukunft-gestohlen?-Nostalgie. Die Verselbstständigung der BTC-Behörde mag nach einem politischen Aspekt klingen. Bei Licht betrachtet ist es aber keine Systemkritik, sondern wird auf eine rein persönliche Ebene und die Verfehlungen von ein, zwei größenwahnsinnigen Personen heruntergebrochen. Dafür finde ich den Gedanken, der hinter dem Schluss steckt, durchaus sympathisch. Und wie schon gesagt: Spannend ist das Ganze auf jeden Fall.
Und was bleibt von "Control", wenn diese Spannung abgeklungen ist? Zumindest der Gag, dass die NSA hier auf der Seite von Transparenz und Demokratie mitkämpft (das ist doch mal originell!). Und ein Satz, geäußert von einer KI, die durch einen Programmierungskonflikt in Gewissensnöte geraten ist: "Ich werde versuchen, dich zu töten, aber so erfolglos wie möglich."
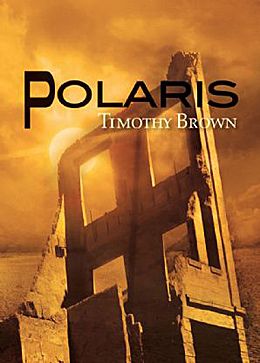
Timothy Brown: "Polaris"
Gebundene Ausgabe, 121 Seiten, PS Publishing 2014
Ein Mann und sein Auto. In der Wüste. Nach der Apokalypse. Klingt nach "Mad Max" - aber hat Mel Gibson von seinem Gefährt je Cappuccino serviert bekommen? Nein. Also, da wurde echt eine Chance vergeben ...
Mit süßen 53 legt US-Autor Timothy Brown seinen ersten Roman vor - eher eine Novelle eigentlich, wie sie der englische Kleinverlag PS Publishing, geleitet von SF-Autor Peter Crowther, mit schöner Regelmäßigkeit und stets in gebundener Form herausbringt. Und auch dieses Werk würde sich hervorragend für eine Verfilmung eignen: Als kleiner, aber feiner Independent-SF-Film mit wenig Bedarf an Spezialeffekten, noch weniger Personal - aber dafür mit der perfekten Mischung aus Stimmung, Witz und Twists.
Miles Davis ...
Der Plot kommt - von ein paar Flashbacks abgesehen - mit ganzen drei Protagonisten aus, und nur einer davon ist ein Mensch: Robert, ein mittlerweile 78 Jahre alter Produzent billiger, aber einträglicher C-Filmchen. Vor einem Monat hat Robert, angeödet von seinem Beruf, beschlossen, Urlaub zu machen und sich von seinem neugekauften intelligenten Auto ins Death Valley fahren zu lassen. Das Timing war günstig (oder ungünstig, wie man will), denn so hat Robert eine Kleinigkeit verpasst: "Sleep, Robert. In the morning I'll prepare you a lovely espresso drink enriched with B vitamins." - "That's good, car. Thank you. What a nice car I have." His mind drifted away, high above the valley floor, borne up by music and moon light. The next day, the world ended.
Und so kurvt Robert seitdem als vielleicht letzter Mensch auf Erden durch die Wüstenei, bedudelt von Miles-Davis-Klängen und rundum umsorgt von seinem Hightech-Gefährt, das mit einer Künstlichen Intelligenz ausgestattet ist (wir befinden uns im späten 21. Jahrhundert), während draußen am Tag tödliche 74 Grad Celsius herrschen. Damit wäre das stark verdichtete Setting bereits beschrieben - wie gesagt: sehr gut verfilmbar. Auch, weil die Erzählung als nahezu durchgängiger Dialog daherkommt und das Zusammenspiel zwischen dem stets leicht beduselten Robert und seinem nervtötend zuvorkommenden Auto für einige wohlgesetzte Pointen sorgt.
... mit Misstönen
Doch ganz ungetrübt bleibt die Harmonie nicht. Dritter im Bunde ist nämlich der fetch mechanism - ein robotischer Ableger der Auto-KI, der draußen Flechten und anderes organisches Restmaterial sammelt, aus dem Roberts Nahrung zusammengebraut wird (und wer das schon für brrr hält, der kann sich auf was ... nein, das darf man leider nicht spoilern). Irgendwie hat dieser Roboter die Fähigkeit zu unabhängigem Denken erlangt - sehr zum Missfallen des Autos. Der wachsende Konflikt zwischen den beiden KIs spielt sich weitestgehend hinter Roberts Rücken ab; das bisschen, das er davon mitbekommt, reicht aber, um ihn zu beunruhigen.
Ohnehin wird das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmt, immer stärker. Brown verdichtet den Eindruck von Entrückung, indem er jedes Kapitel mit einem Traum oder einem Flashback beginnen lässt. Roberts Realität scheint an den Rändern zu zerfransen. Ob dieser Eindruck täuscht, begründet ist oder von der Wirklichkeit sogar noch übertroffen wird, das ist die eine große Frage in "Polaris". Die andere lautet: Wird das Auto seine wiederholte Selbstanpreisung "my upgrades, which contain a heuristic program designed to -", die als Running Gag stets an derselben Stelle unterbrochen wird, jemals ganz aussprechen dürfen? Die Upgrades in Sachen Handlungsspielraum waren jedenfalls umfangreich, soviel sei verraten.
Empfehlung!
Schicht für Schicht, Twist für Twist wird das Geheimnis des Romans gelüftet werden. Bis dahin gilt, ganz wie es die Autowerbung verheißt: Der Weg ist das Ziel. Am Ende dieses Weges aber werden wir nicht wissen, ob wir lachen, weinen oder entsetzt sein sollen; den Effekt bekommt nicht jeder Autor hin.
Hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen!
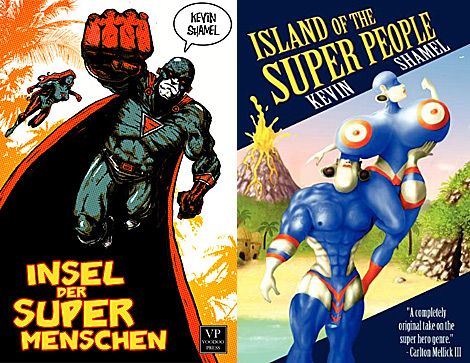
Kevin Shamel: "Insel der Supermenschen"
Broschiert, 220 Seiten, € 11,99, Voodoo Press 2014 (Original: "Island of the Super People", 2011)
Manchmal braucht's offenbar den Arschtritt in Form einer deutschen Übersetzung, um endlich mal ein Buch zu besprechen, das in der Originalfassung schon seit Jahren bei mir daheim herumliegt. Drei sind's im Fall von Kevin Shamels Bizarro-Roman "Island of the Super People" bereits geworden, nicht zu glauben. Der Redlichkeit halber sei vorab gesagt, dass sich diese Rezension an der englischsprachigen Originalausgabe orientiert (weil ich mir nix schicken lassen mag, das ich eh schon daheim hab). Originalfassungsfans werden ohnehin zu dieser greifen - für diejenigen, die mit Englisch nicht recht warm werden, gibt's jetzt aber auch die deutschsprachige Version von Voodoo Press, wo bereits Shamels "Rotten Little Animals" herauskam.
Zur Handlung
Der Kulturanthropologe Professor Topper reist mit seiner Assistentin Natalie und den drei StudentInnen Trent, Martin und Jen zwecks Feldstudie zu jener abgelegenen Insel, auf der der Super sapiens beheimatet ist, wie wir ihn aus der Comicwelt kennen: knallbunt und mit diversen Superkräften ausgestattet. Die reichen hier von eher konventionellen wie Hitzeblick, Riesenkraft und Teleportation bis zu etwas ... exotischeren. Fabulous Man beispielsweise kann mit den Wimpern Musik machen und Steine in Schokolade verwandeln.
Apropos Buntheitsfaktor: Die körperbetonten Kostüme, die schon in herkömmlichen Superhelden-Comics überproportionale Muskeln und Atombusen kaum verhüllen, werden hier endgültig zu dem, was sie eigentlich schon immer sein wollten: Nackte Haut, organisch gewachsen inklusive "Cape", "Stiefel" und "Maske". Dabei kommt es allerdings auf den Farbcode an: Nur wer die "guten" Farben (also die von Stars and Stripes) hat, darf in Hero Village wohnen. Jeder Farbtupfer jenseits von Blau-Rot-Weiß ist Anlass für eine Abschiebung ins benachbarte Dorf der Superschurken.
Der Roman wartet mit jeder Menge großartiger Gags auf - und der erste lässt nach der Landung auf der Insel nicht lange auf sich warten. Denn natürlich kommunizieren die Supermenschen über Sprechblasen; ihre Münder sondern diese als eine Art organisches Ektoplasma ab. Um sich verständlich zu machen, sind unsere wackeren ForscherInnen also fortwährend gezwungen, Luftballons aufzublasen, mit dem Plakatmaler zu beschriften und sie sich neben den Kopf zu halten.
Student am Rande des Nervenzusammenbruchs
Hauptfigur des Romans ist Trent. Obwohl er mit weit weniger Selbstbewusstsein ausgestattet ist als Jen und Martin, bekommt er vom Professor die schwierigsten "Partner" für seine teilnehmende Beobachtung zugewiesen: Zum einen den kahlköpfigen Jungen Squiggles, der über keine erkennbare Superkraft verfügt und mit niemandem kommuniziert; stattdessen hockt er den ganzen Tag in Tümpeln und stochert mit Zweigen an Tierkadavern herum. Und zum anderen den sogar aus Villain Village verbannten Death Killer, der in seinem monströsen Körper so ungefähr jede vorstellbare Superkraft beherbergt und das dann noch mit äußerst schlechter Laune kombiniert.
Wir dürfen davon ausgehen: Hier bahnen sich Freundschaften fürs Leben an! Bis es soweit ist, schildert Trent aber in seinem Forschungstagebuch seine wachsende Verzweiflung über seine ebenso unkooperativen wie unberechenbaren Untersuchungsobjekte:
2:35 PM - Dude ate about sixty pounds of clams. He's expanded to the size of a young walrus. He's lying on the beach.
4:45 PM - Death Killer is gone. He was still all big and fat, and just kind of rolling around and then he was gone. I don't know how he did that.
4:47 PM - He reappeared. I think he's asleep, and he accidentally went invisible.
5:05 PM - He farted his walrus weight away. It killed a passing bird, and fish are washing up on the beach. I'm glad to be this far away.
Die edlen Wilden mit den Superkräften
Auf dem Cover der Originalausgabe verheißt Bizarro-Großmeister Carlton Mellick III "a completely original take on the super hero genre". Und das ist Shamel auch gelungen. Denn bei ihm geht es nicht um die üblichen Superhelden-Topoi wie Origin Stories, Doppelidentitäten, Psychokrisen und all das, was das extrem selbstreflexive Superhelden-Genre mittlerweile seit Jahrzehnten wieder und wieder abarbeitet.
Nein, die "Insel der Supermenschen" ist ein ethnologischer Roman bzw. die Verarsche eines solchen und bedient sich fröhlich jedes Klischees, das sich da so anbietet: Blutige Rituale werden abgehalten, undefinierbares Essen wird serviert (und wehe, es schmeckt einem der Besucher nicht!) und zum Klauen neigen die Eingeborenen auch noch. Mal ganz davon abgesehen, dass sie in einem Cartoon-Strohhüttendorf im Dschungel hausen - was umso komischer wirkt, weil sie ja gleichzeitig fliegen, Laserstrahlen aus den Augen schießen oder mit Dunkler Materie hantieren können.
Auch der Plot selbst bedient sich eines Stereotyps, nämlich der Bedrohung des Paradieses durch militärisch-wirtschaftliche Interessengruppen von außerhalb. Wenn sich unsere WissenschafterInnen mit den "Wilden" gegen skrupellose Invasoren verbünden, befinden wir uns mitten im Szenario von "Avatar". Außerdem beschert uns das einen apokalyptischen Showdown, der in Sachen Gore-Faktor kaum noch zu überbieten ist: Achtung, starke Eingeweide-Niederschläge sind zu erwarten!
Da war die Nische doch zu klein
Insgesamt also ein großer Spaß, den ich gerne weiterempfehle. Etwas getrübt wird er leider durch eine Nachricht von Voodoo Press: Der kleine österreichische Verlag wird seine Bizarro-Schiene im Frühling wegen zu geringer Verkaufszahlen einstellen. Nachdem auch die Mellick-Veröffentlichungen bei Festa ins Stocken geraten sind, scheint es also mit Bizarro auf Deutsch vorerst vorbei zu sein. Sehr schade, ich finde immer noch, dass die Bizarro Fiction zum spannendsten gehört, was die Phantastik in jüngerer Zeit hervorgebracht hat. In der Rundschau wird sie jedenfalls immer einen Platz haben.
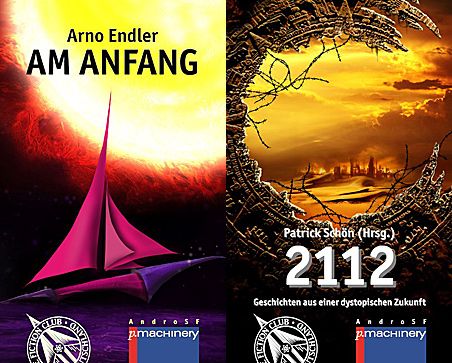
Arno Endler: "Am Anfang" und Patrick Schön (Hrsg.): "2112"
Broschiert, 223 bzw. 160 Seiten, € 9,90, bzw. 8,90, jeweils p.machinery 2014
Kaum Schritt zu halten ist mit dem Output von p.machinery! Und wie zur Bestätigung legt mir die Redaktionsassistentin grad ein neues Paket auf den Tisch, während ich dies eintippe. In stetem Strom kommen von dem kleinen bayrischen Verlag Romane, Anthologien und Sachtexte - alle in kleinformatigen, eher dünnen Bänden, die sehr an die Zeit erinnern, als SF-Literatur noch ein kostengünstiges Massenprodukt für das schnelle Vergnügen war. Oder anders ausgedrückt: Gelebte Popkultur!
Aus der jüngsten Tranche habe ich mir zwei Kurzgeschichtensammlungen herausgegriffen - ganz einfach, weil ich Kurzgeschichten an sich sehr mag und es nicht mehr viele Verlage gibt, die welche zu einem Buch zusammenstellen (oder wenigstens zu einem Büchlein). Zudem lassen sich beide auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Man sollte sich bei Kurzgeschichten so weit wie nur möglich auf das eigentliche Geschehen beschränken und es nicht unter zuviel Hintergrundinformationen ersticken. Mehr Mut zur kleinen Bühne!
Am besten aufs Wesentliche konzentrieren
Aus dem Dystopien-Band "2112" hat mir daher auch mit Abstand am besten diejenige Geschichte gefallen, die dies am meisten beherzigt: "Animal" von Julia Müller dreht sich um eine Clique von Jugendlichen, die ihren eigenen Akt von Subversion entwickelt haben. Ihr Initiationsritual, für das ein neues Mitglied eine Verbindung mit einem giftigen Tier eingehen muss, findet draußen in der Wildnis statt: Gleichsam herausgelöst aus einem erdrückenden Kontext und dadurch freigespielt, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. An Hintergrundinformationen erhalten wir nur ein paar Andeutungen, aus denen wir uns das Bild einer stark reglementierten Gesellschaft zusammenreimen können. Aber mehr brauchen wir auch nicht.
Ähnlich fokussiert ist "Der Sprung" von Jon Padriks, einem der Pseudonyme von Herausgeber Patrick Schön. Hier steht der Insasse eines Gefangenenlagers vor der Entscheidung, ob er resignieren oder doch noch weiterhoffen soll. Außerdem sei noch die parabelartige Erzählung "Jiddhais Nachbarn" von Gabriele Behrend genannt - nicht zuletzt deshalb, weil sie einen der raren Momente des Aufatmens in dieser Anthologie enthält. Insgesamt definiert "2112" nämlich das Wort "Dystopie" in einem erbarmungslosen 70er-Jahre-Sinn, soll heißen: Die Hoffnung stirbt zuletzt ... aber sie stirbt. Außer bei Behrend, wo ein Kleinkrimineller Graffiti-Botschaften an seine Nachbarn hinterlässt, die eigentlich als Drohungen beabsichtigt sind - stattdessen aber eine ungeahnte Welle der Menschlichkeit auslösen.
100 Jahre nach dem Weltuntergang
Wer den Titel der Anthologie mit seiner offensichtlichen Anspielung auf die vermeintliche Maya-Prophezeiung kurios findet: "2112" kommt nicht zwei Jahre zu spät, sondern erschien seinerzeit pünktlich als E-Book - nun liegt der Band in leicht veränderter Form auch als Paperback vor. Zum Hintergrund: Die Anthologie ist als Mini-Shared-Universe angelegt, die Handlungszeit ist 100 Jahre nach dem Weltuntergang angesiedelt. Große Teile der Erde wurden überflutet, übriggeblieben sind - ganz wie in "1984" - drei verfeindete Machtblöcke: die eurasische New Politeia, das islamisierte Afrika und die offenbar matriarchalisch organisierte Union. Oberflächliche Unterschiede sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei allen dreien um diktatorische Regimes handelt, die ihre BürgerInnen in einem gnadenlosen Würgegriff halten. Alle drei praktizieren zudem Eugenik.
Dieser Prämisse ist ein Großteil der AutorInnen allerdings in die Falle gegangen: Sie versuchten einfach zuviel davon einzubauen. Bei 150 Seiten, die sich auf 17 Kurzgeschichten plus eine Reihe von Gedichten und anderen Kürzesttexten verteilen, bleibt nicht viel Raum für Exposition. Und dennoch verlassen die AutorInnen nur allzuoft die eigentliche Handlung für Erklärungen zum Worldbuilding, als wär's ein 500-Seiten-Roman. Und lassen damit ihre Geschichten im Stich.
Immerhin: die thematische Bandbreite ist groß. Für einen Lustknaben, der sich auf seinen Einsatz vorbereitet, ist hier ebenso Platz wie für einen Opa, der im Alten-KZ abgeliefert wird, einen Kampf gegen Rieseninsekten in der Kanalisation oder HIV-Ansteckungsparanoia, die zu einer rigiden Sexualgesetzgebung geführt hat. Ein paar Seiten Handlung mehr und ein paar Absätze Infodumps weniger, das würde all diesen Geschichten guttun. Und die zum Glück einzigen zwei Erzählungen hier, die sich wirklich um Maya-Esoterik drehen und so richtig überhaupt nicht zum Rest passen, würde ich aus der Anthologie streichen.
"Am Anfang"
Von Arno Endler kannte ich schon einiges, also war seine Sammlung "Am Anfang" eine logische Wahl aus dem aktuellen p.machinery-Angebot. Neben der titelgebenden Novelle sind hier acht Kurzgeschichten enthalten, die der deutsche Autor seit 2008 verfasst und für diese Sammlung teilweise neu überarbeitet hat. Die thematische Bandbreite ist groß, sie reicht von der nächsten Zukunft à la "Superstau", in dem ein Verkehrsleitsystem Skynet-artige Züge entwickelt, bis buchstäblich zum Ende der Zeit ("Das Ende", ein schöner melancholischer Ausklang der Anthologie).
Probleme hat mir hingegen die Titelgeschichte "Am Anfang" bereitet, in die Endler fast schon aberwitzig viel hineingestopft hat. Mal sehen, da hätten wir: Ein Energiefeld, das Tote entmaterialisieren lässt. Ein wachsendes Riesenkonstrukt auf dem Mars, das aus den verschwundenen Körpern besteht (und am Ende keine erkennbare Rolle für die Geschichte spielen wird). Einen Asteroidenschwarm mit Kollisionskurs auf die Erde. Aliens, die auf der Erde Früchte aussäen, die das menschliche Bewusstsein manipulieren. Einen Mann, der einen Außerirdischen im Keller gefangen hält. Und schließlich eine Botschaft, die vom Mond herunterzuleuchten scheint, ihr Wortlaut: "Glaubt ihr?" / "Liebt ihr?" / "Hofft ihr?"(Man beachte: Jedem Betrachter erscheint diese Botschaft in seiner Muttersprache im Kopf. Ihr Inhalt jedoch nennt explizit die christlichen Tugenden und ist damit keineswegs universal.)
Zerschellt am Riff, das Carl Sagan umschiffte
Eine ganze Menge Baumaterial jedenfalls. Und jedes dieser Motive hätte schon für sich eine Erzählung getragen. Alle zusammengenommen und noch dazu kombiniert mit einer Familiengeschichte voller personeller Querverbindungen und Perspektivenwechsel - das sprengt allerdings die Form. Und liest sich, als hätte Endler die Zeit, der Mut oder - was am wahrscheinlichsten ist - die Veröffentlichungsmöglichkeit gefehlt, um "Am Anfang" zu dem zu machen, was es eigentlich ist: ein 600-Seiten-Roman.
Aber. Vielleicht wird Endler auch mal froh darüber sein, dass "Am Anfang" hier in relativ unauffälliger Form erscheint. Außer er möchte als Autor für das stehen, worauf die Geschichte letztendlich leider hinausläuft: nämlich Esoterik der ärgerlichen Art, also eine Verbindung von Kitsch und Unlogik. Das Grundszenario mag an Carl Sagans Klassiker "Contact" erinnern. Doch diesen Aliens hier, die angeblich eine höhere Ebene des Geistes erklommen haben, kann man eigentlich nur die Botschaft "Denkt ihr!?" zurückschicken, so katastrophal unverantwortlich und manipulativ gehen sie vor. Aber alle finden's super. Dabei könnte Endler das Steuer noch relativ leicht herumreißen: Wenn er einen Schluss findet, der den Zweifel wesentlich stärker betont, anstatt seine Figuren glücksbeduselt in einem Eso-Poster voller Space-Blumen und springender Wale versandeln zu lassen, ließe sich diese Geschichte noch retten. In der vorliegenden Form aber ist sie ein Missgriff.
Weiters auf dem Menü
Deutlich besser ist beispielsweise "Return to Sender", eine Art Verknüpfung von Cyberpunk und "Schöne neue Welt", worin ein Mensch als Notfallpaket zusammen mit ein paar KIs in einen Kampfeinsatz geschickt wird. Oder "Elegie an eine einsame Insel mitten im All", in dem Marskolonisten den Kontakt zur Außenwelt verlieren. Sehr schön stimmungsvoll! "Das Prinzip Liebe" liest sich wie eine Hommage an Golden-Age-SF, während die First-Contact-Geschichte "Am Strand von Nueva Danmarka" mit ihrer Verknüpfung von Liebe, Tod und Fremdartigkeit thematisch an James Tiptree Jr. erinnert. Und "Feldversuch" schließlich bezieht Spannung aus der Frage, auf welche Art von Hightech-Experiment sich der Protagonist hier eigentlich vorbereitet, ehe das Ganze einen unerwartet persönlichen Twist vollzieht.
Zugegeben, manchmal würde ich mir ein wenig mehr sprachliche Präzision wünschen. Dann würde es weder einen sechseckigen Würfel noch eine Vollbehaarung aus Federn geben; und ich wüsste zu gerne, wie eine unterschwellige homoerotische Duftnote riecht. Dafür hat Endler ein gutes Gespür für Ideen. Durchaus klassische aus dem altbewährten Repertoire der Science Fiction - aber das ist ja letztlich auch die Kunst, die Genreliteratur ausmacht: Einen Weg, der schon tausend Mal gegangen wurde, beim tausendersten Mal doch wieder ein bisschen anders zu gehen.

Jo Walton: "Die Stunde der Rotkehlchen"
Klappenbroschur, 286 Seiten, € 17,40, Golkonda 2014 (Original: "Farthing", 2006)
Die weltweit erfolgreiche TV-Serie "Downton Abbey" wirkt auch deshalb so schön heimelig, weil hier immer die Aufgeschlossenheit über die Engstirnigkeit siegt: Der Kammerdiener ist schwul, die Zofe eine Knastschwester, der Schwiegersohn ein Linker? Alles kein Ding. Es gibt ein wenig Gerumpel vom adeligen Familienoberhaupt, aber letztlich setzen sich die liberalen Kräfte unter den Crawleys stets durch und integrieren vom gesellschaftlichen Mainstream Abweichende, dass die Schwarte kracht. Nicht nur der schnelle Schnitt der Serie ist modern, auch in Sachen Ideologie ist man dem Zeitgeist - in der aktuellen Staffel schreiben wir das Jahr 1924 - weit voraus.
Letztlich glorifiziert das natürlich auch ein bisschen das gute alte England als Hort der Zivilisation und Gegenpol zur Barbarei, die sich auf dem Kontinent langsam abzuzeichnen beginnt. Das hätte möglicherweise auch anders kommen können. Eine ganze Reihe von Alternativweltromanen (zuletzt etwa das mit dem Sidewise Award ausgezeichnete "The Windsor Faction" von D. J. Taylor) hat sich in den vergangenen Jahren mit einem gerne ignorierten Umstand beschäftigt: Nämlich dass es in England vor dem Zweiten Weltkrieg durchaus Kräfte gab, die einen Krieg mit Deutschland vermeiden wollten - und sogar solche, die mit Hitler sympathisierten. Was, wenn die sich durchgesetzt hätten?
Der Weg in die Finsternis
Ein hervorragendes Beispiel für dieses Szenario hat die walisische Autorin Jo Walton mit ihrer "Farthing"-Trilogie abgeliefert. Hier hat England mit Nazi-Deutschland einen Frieden ausgehandelt ... und nimmt ganz langsam und sachte allmählich selbst faschistoide Züge an. Gesellschaftspolitische Informationen sickern wie Gift in die Handlung ein, während sich im Vordergrund der Bühne ein "Downton"-kompatibles Tableau von Exklusivität ausbreitet - bis die Fassade durch einen Mordfall erste Risse bekommt. (Eine ausführliche Rezension zum jetzt als "Die Stunde der Rotkehlchen" erschienenen ersten Band findet sich hier.)
Die Handlung des Romans, der nur vordergründig als Krimi bezeichnet werden kann, wird von zwei Figuren getragen: Adelstochter Lucy Eversley und Scotland-Yard-Inspektor Peter Carmichael, der den Mordfall untersucht. Und während es in diesem Roman noch keine eindeutige Hauptfigur gibt, wird Carmichael in den Folgebänden zum zentralen Protagonisten werden: Der Golkonda-Verlag, der schon Waltons "In einer anderen Welt" veröffentlicht hatte, trägt dem Rechnung, indem er die Trilogie als "Inspector Carmichael"-Romane herausbringt. Und wie schon für "In einer anderen Welt" gilt: Absolut lesenswert!
Abschied von 2014
Im Jänner folgt wieder eine Jahresrundschau mit Kurzverweisen auf diejenigen bereits rezensierten Bücher, die mir heuer am besten gefallen haben (aus irgendeinem Grund sind solche Jahresrückblicke immer sehr beliebt). Damit denen, die das alles schon in der Langversion gelesen haben, nicht vor Fadesse die Füße einschlafen, werden aber auch wieder ein paar Neuvorstellungen dabei sein, versprochen! (Josefson, derStandard.at, 20. 12. 2014)