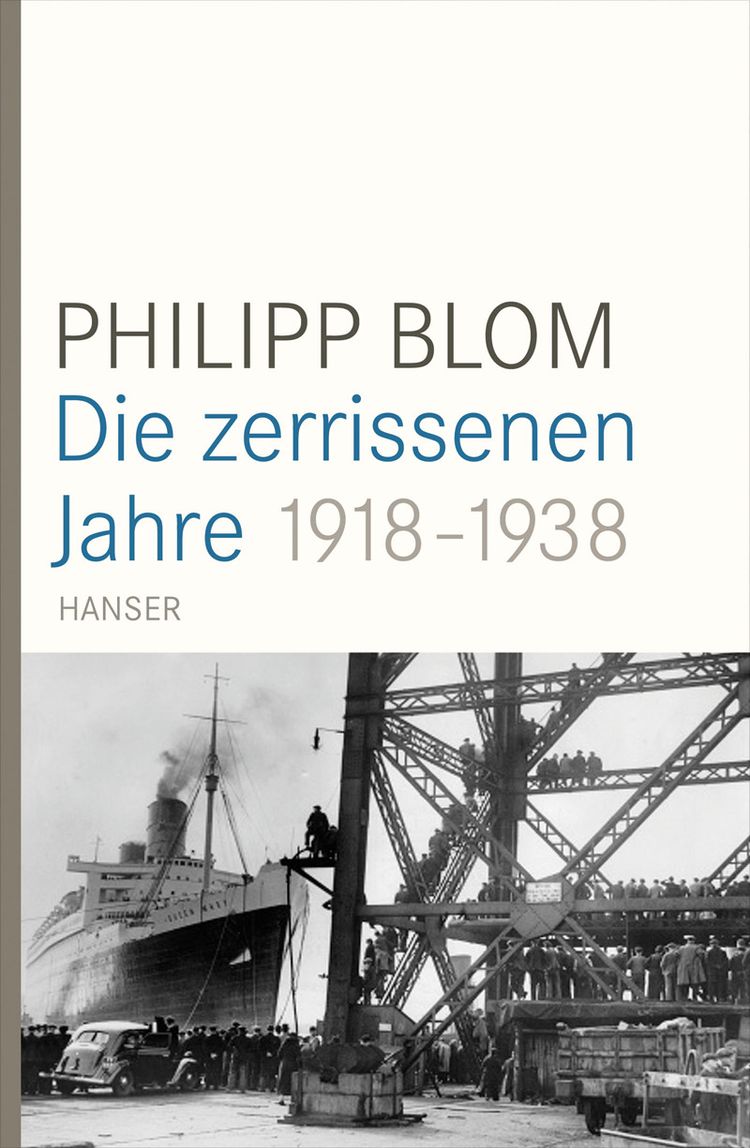
Philipp Blom, "Die zerrissenen Jahre". 1918-1938. € 28,70 / 572 Seiten. Hanser, München 2014
Europa hat keinen Glauben mehr: Es gibt religiösen Werten keine wirkliche Bedeutung mehr und betet nur noch das Geld an, den individuellen und kollektiven Überlebensinstinkt, es jagt dem Vergnügen nach und will ein friedliches Leben."
Stimmt es, dass sich Geschichte nicht wiederholt oder höchstens als Farce? Man liest das obige Zitat und fragt sich, ob es geradewegs vom Kreml kommt oder von westeuropäischen Nationalisten. Doch es war Mussolini, der 1927 diesem Trauerbild Europas das "vitale Prinzip" des Faschismus gegenübergestellt hat.
Philipp Blom zitiert ihn in seinem Buch über die zwei Jahrzehnte nach dem Ersten Weltkrieg. Es ist nicht seine erklärte Absicht, Parallelen zwischen jener und unserer Zeit herzustellen. Vielmehr geht es ihm darum zu zeigen, was für einen Modernisierungsschub der Erste Weltkrieg bedeutete - im negativen Sinn, indem er die Fortschritte von Vernunft und Aufklärung gegen die Menschen kehrte -, und wie die Menschen mit den Folgen nicht fertig wurden. Der Leser aber kommt nicht umhin zu fragen, ob wir nun klüger geworden sind, umsichtiger handeln und Konsequenzen besser abschätzen können als nach jener Illusion eines "war to end all wars".
Dass die Friedensschlüsse von Versailles, Trianon etc. ihren Namen nicht verdienten, war hellsichtigen Zeitgenossen klar. Die Stationen, die den Weg zum nächsten Weltkrieg säumten, sind in der Geschichtsforschung, also retrospektiv, unbestritten: Inflation, Wirtschaftskrisen, Radikalisierung, Außerkraftsetzung demokratischer Verhältnisse. Dazwischen gärte es in der Kultur, der Technik, Wissenschaft, im Alltag insgesamt. Die Menschen, die den Krieg überlebt hatten, mussten in Europa und in Amerika mit neuen Gegebenheiten zurechtkommen. Die psychischen Herausforderungen waren so ungeheuer wie vielerorts die politischen.
Linien des Zerfalls
Hier setzt der Historiker Blom an. Wie schon in Der taumelnde Kontinent, seinem Buch über die Zeit vor 1914, behandelt er in jedem Jahr, chronologisch, einen je anderen Schwerpunkt. Das beginnt 1918 mit den "Kriegszitterern", den traumatisierten Überlebenden aus den Grabenkämpfen, und geht bis zum letzten Konzert, im Jänner 1938, das Bruno Walter im Wiener Musikverein dirigierte (Mahlers Neunte). Dazwischen geht es um symptomatische Themen, die in der großen Historiografie selten wahrgenommen werden, aber umso mehr das Bewusstsein jener Epoche verdeutlichen: die Selbstverständlichkeit "eugenischer" Sichtweisen, die Mäander der surrealistischen Bewegung, die Ausstrahlung des Jazz, die auffallenden Parallelen bei der Bekämpfung revoltierender Arbeiter in der Sowjetunion, den USA und der Weimarer Republik.
In spannenden Details zieht der Autor die Linien des Zerfalls und der immer gefährlicheren Orientierungslosigkeit nach. Man liest von den Abgründen des Berliner Nachtlebens und der paranoiden Stimmung im eingekesselten republikanischen Barcelona; von Charles Mauriac, einem reaktionären Monarchisten, dem der gemeine Rassismus "zu deutsch" war; oder von Oscar Levy, einem verwirrten deutschen Juden, der in England Nietzsche propagierte und nach der Machtergreifung der Nazis diagnostizierte: "Dieser Hitlerismus ist nichts als eine jüdische Häresie."
Aus solchen exemplarischen Skizzen, verbunden mit makrohistorischen Daten, formt Blom virtuos das Bild einer "ruderlosen" Zeit. Sie habe es nicht geschafft, das "No Future", das in den Schützengräben begonnen hatte, in eine lebbare Zukunft umzuformen. Er belegt seine Recherchen mit umfangreichen Quellenangaben - Wolfgang Schivelbuschs Entfernte Verwandtschaft hätte vielleicht den Blick weiter geschärft dafür, wie erstaunlich ähnlich die verfeindeten politischen Systeme mit der Weltwirtschaftskrise fertigwerden wollten. (Nebenbei fällt die Kleinigkeit auf, dass dem Lektorat des renommierten Hanser-Verlags entgangen ist, dass 1895 plus 29 Jahre nicht 1914 ist; Seite 31). Im Epilog klopft Blom die damalige Zeit auf Vergleiche mit der Gegenwart ab und schwankt zwischen Beunruhigung und der Hoffnung, dass wir, die Heutigen, eines Tages positiver beurteilt werden können als unsere Vorfahren. Vielleicht schreibt er rechtzeitig ein Buch über die zweite Nachkriegszeit. Lesenswert wird es allemal wieder sein. (Michael Freund, DER STANDARD, 20.12.2014)