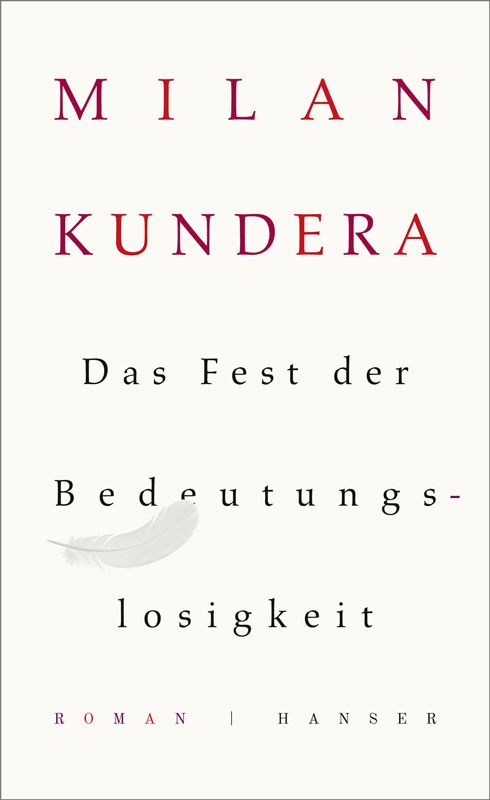
Eine hervorstechende Art des französischen Intellektualismus äußert sich mit Vorliebe im Salon. Dort scheint das hochtrabende Gespräch, die "causerie", schwerelos wie eine vom Plafond schwebende Feder - und ist ebenso dünn. Diese Posierlichkeit ist eine mit Selbstbewunderung vorgeführte Formgewissheit, die mehr verspricht, als dahintersteckt.
In Milan Kunderas Buch Das Fest der Bedeutungslosigkeit sehen die Mondänen bei der Salonparty eine Feder herabgleiten, und die Pariser Kritik zeigt sich beglückt: So leicht sei der Roman, er gleiche dem "tänzerischen Schweben". Kein Wunder, dass Rezensenten um die Boulevards des feinen Unterschieds begeistert sind, finden sie sich doch in der ihnen genehmen Umgebung wieder.
Tatsächlich jedoch hat Kundera, dessen Werke zu Recht Bewunderung erregt haben und dessen Unerträgliche Leichtigkeit des Seins unsereinen über die tolle Lektüre hinaus begleitete, eine dünne Oberfläche konstruiert. Er setzt vier Männer in Szene, lässt sie um den Jardin du Luxembourg und ein paar existenziell ausstaffierte Fragen kreisen, sich im Geplauder ergehen.
Einer sieht den Weltgeist im freien Nabel junger Frauen und landet natürlich bei seinem Muttertrauma. Ein anderer erzählt, wie Stalin seine Genossen im ZK mit ihrer Lächerlichkeit traktierte, und schließt daraus umstandslos auf die Witzlosigkeit unserer "neuen Zeit". Einem Dritten sind die Warteschlangen vor der Chagall-Ausstellung zu lang, folglich macht er sich zu einer Party auf, wo ihm auch nicht wohler wird. Dort gibt ein arbeitsloser Schauspieler den Diener und spricht in seinem Fantasiepakistanisch.
Text ohne Gewicht
Die vier Stränge ordnet Kun- dera in sieben Teilen an, klas- sisch vom (ungenau ausgedrückten) "Die Helden stellen sich vor" über die zentrale Salonszene bis zum Titelkapitel am Ende, einer Farce im Jardin du Luxembourg, wo sich Posen von gestern und heute treffen.
Das Ganze dürfte im Typoskript höchstens vierzig Normseiten füllen. In der aufgeblasenen Buchform sind trotz der Kürze Druckfehler verblieben, und der Verlag lanciert die falsche Angabe "Kundera wurde in der tschechischen Republik" (gibt es erst seit 1993) geboren. Quantität und simple Ungenauigkeit wären freilich belanglos, wenn der Text Gewicht hätte.
Zwar beziehen sich Pariser Rezensionen auf Kunderas Essay Der Vorhang (Hanser, 2005), der gegen die "Diktatur der Story" plädierte. Nun aber liefert der Autor den Versuch einer Story, die sich immerhin als Epochenbilanz geriert. Unsere Zeit sei komisch, weil sie ihren Humor verloren habe.
In seiner Kunst des Romans (Hanser, 2007) hatte Kundera betont, der Roman sei die ironische Kunst schlechthin; nun bleibt seine Ironie eine Behauptung. Oder ist es ironisch, wenn Reflexionen wie Dialoge mit Tiefsinn auftrumpfen und läppisch ausfallen? Der Nabel einer Frau spreche "von etwas anderem, was nicht die- se Frau ist", nämlich "vom Fötus". Ist es ironisch, wenn der Elitäre "die Langeweile" in Gesichtern von Wartenden zu sehen meint und die Menge seiner Kunstbetrachtung ungebührlich im Wege stehe?
Er erkenne "einen immer tieferen Sinn" darin, sagt jener, der die Stalin-Geschichtchen schildert, beendet seine Rede, "und alle waren bewegt": Die Ankündigung allein rührt schon. So simpel, so oberflächlich; jedoch bezeichnend für die Erzählhaltung der Pose. Den Bruch der Wirklichkeitsdarstellung spielt ein müder Trick vor. Die Figuren nennen ihren Erzähler "unser Meister, der uns erfunden hat", und dieser streckt gleich den narrativen Zeigefinger aus: "Ich wiederhole mich? Ich beginne das Kapitel mit denselben Worten, die ich ganz am Anfang des Romans benutzt habe?"
Mit dem Holzhammer
Das ist keine Ironie, das ist Holzhammer. Andererseits soll es sich offenbar gut machen, dass "unser Meister" doch nicht alles weiß: "Als Alain seine Kumpane eine Woche später in einem Bistro (oder bei Charles, ich weiß nicht mehr) wiedersah". Und eine Szene will der Erzähler gar einem anderen andrehen: "Als hätte ein unsichtbarer Regisseur es arrangiert, gingen zwei blutjunge Mädchen mit elegant entblößtem Nabel an ihnen vorbei."
Zudem glänzt das französische Original nicht gerade vor sprachlicher Brillanz - die Übersetzung bringt das tapfer ins Deutsche. Frauen "geben sich hin"; aus einem Mund "kam ein wahres Feuerwerk von Esprit". Die Dialoge wirken oft hölzern ("Als Geschenk bringe ich dir eine Cocktailparty mit. - Gut gemacht!"), die Aussagen banal, und das Vanitas-Motiv kennen wir origineller: "Die Zeit rennt. Dank ihr sind wir zunächst Lebende, was bedeutet: Angeklagte und Verurteilte. Dann sterben wir."
Ein Teil trägt den Titel "Das Marionettentheater". Die Figuren erscheinen aber weniger als Marionetten denn als grobe Scherenschnitte. Der Schauspieler ist als derart unbeleckt gezeichnet, dass er weder weiß, wer Chruschtschow war noch sich den Namen Immanuel Kant zu merken vermag. Der "Gebildete" hingegen teilt in seiner "Vorlesung" die große Erkenntnis mit: "Grad bedeutet im Russischen Stadt."
Der heutigen Welt fehle der Witz - die Welt aber beschränkt sich hier auf einen kulturmondänen Teil von Paris. Von der Epochenbilanz ist dieses Fest der Bedeutungslosigkeit weit entfernt, es bietet wie die "causerie de salon" nur die Simulation von Tiefsinn.
Die Professoren Alan Sokal und Jean Bricmont haben derartige Auswüchse Pariser Salongeplauders in ihrem Band Intellectual Impostures (Profile Books, 2003) analysiert; für einen solchen Zeitgeist ist Milan Kunderas Bändchen ein Beleg. Anstelle von Humor und Posse ist er auf die Pose gekommen. (Klaus Zeyringer, Album, DER STANDARD, 21./22.2.2015)